.jpg) Kulmbach/Hollfeld
- Rekord bei der Waldbesitzervereinigung Hollfeld:
im zurückliegenden Jahr wurde erstmals die Menge von
100000 vermarkteten Festmetern übertroffen.
Christian Dormann, der Vorsitzende der WBV, spricht
von einem erfolgreichen und arbeitsintensiven Jahr.
Die WBV Hollfeld erstreckt sich über drei
Landkreise. Sie hat rund 1700 Mitglieder aus
Bamberg, Bayreuth und Kulmbach.
Kulmbach/Hollfeld
- Rekord bei der Waldbesitzervereinigung Hollfeld:
im zurückliegenden Jahr wurde erstmals die Menge von
100000 vermarkteten Festmetern übertroffen.
Christian Dormann, der Vorsitzende der WBV, spricht
von einem erfolgreichen und arbeitsintensiven Jahr.
Die WBV Hollfeld erstreckt sich über drei
Landkreise. Sie hat rund 1700 Mitglieder aus
Bamberg, Bayreuth und Kulmbach.Den Kindern zuliebe: Nordmanntannen statt Kunststoffbäume / Christbaumsaison 2025 ist eröffnet
Kulmbach. Die Adventszeit steht vor der Tür und damit steigt für Groß und Klein die Vorfreude auf weihnachtliche Gemütlichkeit. Ein Christbaum gehört ohne Zweifel dazu. Für mehrere hunderte Christbaumbauern beginnt damit die intensivste Zeit im Jahr. „Ein Christbaum aus Bayern bringt nicht nur den Glanz der Weihnachtszeit ins Haus, mit ihm bringen wir auch ein Stück Heimat in unsere Wohnzimmer“, sagte Forstministerin Michaela Kaniber vor wenigen Tagen bei der offiziellen Saisoneröffnung im unterfränkischen Landkreis Hassberge. Auch im Kulmbacher Land stehen die Christbaumbauern bereits in den Startlöchern. So zum Beispiel Uwe Witzgall, Landwirt aus Petschen bei Stadtsteinach.
Uwe Witzgall, Petschen bei Stadtsteinach
Im
Einzelverkauf werden wir die Preise schon halten
können, sagt Uwe Witzgall. In den kommenden Jahren
werde eine Steigerung aber unumgänglich sein. Als
Hauptgrund dafür nennt er den beschlossenen Anstieg
des gesetzlichen Mindestlohns ab 2026. Derzeit
kostet der Meter Nordmanntanne bei ihm zwischen 20
und 25 Euro.
Uwe Witzgall blickt auf ein „ganz normales Jahr“ zurück. Trotz Nachtfrost nach den Eisheiligen im Mai sei er mit einem blauen Auge davongekommen. Die Wasserzufuhr sei in der Folge ausreichend gewesen und auch die Hitzetage im Juli hätten seine Bäume gut überstanden. Ungeziefer habe es kaum gegeben, deshalb habe er auch kaum Insektizid gebraucht.
Seit mittlerweile 13 Jahren baut der 55-Jährige auf rund 30 Hektar Fläche im Kulmbacher Oberland Christbäume, hauptsächlich Nordmanntannen, in geringerer Stückzahl auch Nobilis-Tannen, Blaufichten und Schwarzkiefern, an und beliefert damit Händler in ganz Deutschland. Der Hof und die Plantagen liegen direkt auf der Fränkischen Linie auf rund 540 Meter über Normalnull.
Ein wenig Angst hat Uwe Witzgall schon vor dem Trend zu Plastikbäumen. Wer einen Plastikbaum kauft fällt als Kunde erst mal für ein paar Jahre aus. Auf der anderen Seite sieht er aber auch eine Rückbesinnung auf Traditionen, gerade in einer zeit, in der Inflation, Kriege und schlechte Stimmungen die Nachrichten beherrschen. Da freuten sich die Menschen auf Weihnachten und da gehört ein Baum dazu, sagt er.
Uwe Witzgall legt allergrößten Wert auf Qualität. Das heißt, dass alle Bäume aus Petschen seit 2018 das Siegel „geprüfte Qualität Bayern” tragen dürfen. Das Gütesiegel besagt, dass festgelegte Produktionskriterien eingehalten und auch regelmäßig kontrolliert werden. Dazu gehört zum Beispiel ein späterer Schnittzeitpunkt. Außerdem wurde der Betrieb zertifiziert, was die Erfüllung noch höherer Standards bedeutet. Sie beginnen von der Anpflanzung über die Produktion bis hin zur Ernte, praktisch in allen Bereichen.
Die Christbäume von Uwe Witzgall gibt es unter anderem bei Samen Hühnlein am Eulenhof in Kulmbach, am Rathausplatz in Hof, in Hallstadt und Stammbach und direkt am Hof in Petschen am 2. und 3. Advent jeweils Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr zum selbst aussuchen und selbst schneiden.
Einen Tipp hat Uwe Witzgall für alle Christbaumbesitzer: „Der gekaufte Baum sollte vor dem Aufstellen schattig und im Freien liegen, dann hält er am längsten“. In der Wohnung sollte anschließend ein kleines Stück abgesägt und der Ständer mit Wasser gefüllt werden. So hat man am längsten seine Freude an den Weihnachtsbäumen aus dem Frankenwald.
Norbert Grass, Wahl bei Presseck
Auch Norbert Grass von Christbaumgrass in Wahl bei Presseck legt großen Wert auf Qualität. Mitte November sei mit dem Einschlag begonnen worden. Norberg Grass muss seine Preise etwas anheben. „Wir müssen um einen Euro teurer werden“, sagt er und geht davon aus, dass die Käufer dies verschmerzen könnten. „Irgendwie müssen wir unsere Kosten schon ein wenig abfangen.“
Dafür seien die Bäume aber auch sehr gut gewachsen. „Unsere Bäume schauen sehr gut aus.“ Dank entsprechender Behandlung und Düngezugaben seien die Bäume im besten Zustand. Die Temperaturen seien heuer ideal gewesen, auch wenn der Frühling fast schon ein wenig trocken war, so habe es noch rechtzeitig genügend geregnet, so dass sich die Bäume sehr gut entwickeln konnten.
„Die Tendenz zu kleineren Bäumen ist da“, das stellt Norberg Grass fest. Die Nachfrage sei aber kontinuierlich gleichgeblieben. Dass manche Menschen Plastikbäume kaufen, weiß er auch. Norbert Gross ist aber fest davon überzeugt, dass die Kunststofftannen ihren Besitzern irgendwann überdrüssig werden und dass sie zum Naturbaum zurückfinden. Meist geschehe das den Kindern oder Enkelkindern zuliebe.
Norbert Grass baut in eigener Kultur ausschließlich Nordmann-Tannen an, an seinen Ständen gibt es auch Blaufichten und Kiefer, die von Berufskollegen aus Unterfranken kommen. Die Christbäume von Norbert Grass gibt es ab Hof in Wahl 5 bei Presseck immer donnerstags bis sonntags und ab dem 1. Advent auf den Plätzen, unter anderem in Helmbrechts, Münchberg (Rewe) und in Hof (Möbel SB-Halle in der Schaumbergstraße gegenüber dem Landratsamt). Norbert Grass baut auf etwa sieben Hektar Christbäume an.
Auch Norbert Grass hat wertvolle Tipps für alle Christbaumbesitzer, um die Haltbarkeit zu verbessern: Die Bäume sollten auf jeden Fall schattig und im Freien gelagert werden, nicht in der Garage, nicht im Keller und auf keinen Fall in der Sonne. Am besten ist ein Platz unter einer Hecke, wo der Baum auch weiterhin Feuchtigkeit bekommt, denn der Baum nimmt ja auch weiterhin Feuchtigkeit über die Nadeln auf. Da könne es ruhig drauf regnen oder schneien. Zweit Tage vor dem Aufbau sollte der Baum in einen temperierten Raum gestellt werden, damit der Baum auftauen kann. Und ab Heiligabend würde Norbert Grass auf jeden Fall einen Wasserständer bevorzugen.
Peter Gäbelein „Kroawäldla“ Kulmbach
Seit 40 Jahren baut Hans-Peter Gäbelein „Christbaamla unterm Kroawäldla“ am Rande von Mangersreuth an. Er ist Verwaltungsbeamter im Ruhestand und hat vor vier Jahrzehnten begonnen, Christbäume auf etwa einem Hektar Fläche anzupflanzen. „Für uns ist da auch viel Hobby dabei“, gibt er unumwunden zu, Gleichwohl sei das Ganze auch mit viel Arbeit verbunden. Hans-Peter Gäbelein legt großen Wert darauf, dass seine Bäume frisch und günstig sind. Bei ihm kostet der laufende Meter Nordmanntanne heuer 22 Euro. Auch einige Blaufichten und Kiefern wachsen unter dem „Kroawäldla“, doch die würden kaum mehr nachgefragt.
Seine Bäume hätten in diesem Jahr genug Wasser gehabt. Gepflanzt werde ausschließlich im Herbst. Bei einer Frühjahrspflanzung wäre der Aufwand aufgrund der kleinen Kultur zu groß. Der Klimawandel sei auf jeden Fall spürbar, so Hans-Peter Gäbelein, denn auch im Herbst müsse noch bewässert werden. „Das ist schon schwieriger geworden, man muss mehr hinterher sein als früher.“ Auch heuer hätten Spätfröste noch einige Bäume erwischt.
Hans-Peter Gäbelein hat sehr viele Stammkunden und verkauft das allermeister frisch aus der Kultur. Das wüssten seine Kunden zu schätzen, deshalb mache ihm Billigkonkurrenz nicht zu schaffen. Auch für Plastikbäume hat er nichts übrig: „Wenn man der Umwelt etwas Gutes tun will, kauft man keinen Plastikbaum.“ Man könne nicht wissen, was da ausdünstet, man weiß aber genau, dass er für die Produktion und den Transport sehr viel CO2 benötigt.
Damit der Baum länger hält, empfiehlt Hans-Peter Gäbelein die Aufbewahrung in einen Eimer Wasser und an einen windgeschützten Platz. Und auf keinen Fall dürfe man den Baum von der Eiseskälte direkt ins warme Wohnzimmer stellen. Jeder Baum benötige ein bis zwei Tage Übergangszeit. Für Wohnzimmer mit Fußbodenheizung entflieht der Fachmann eine Korkmatte unter den Baum zu legen. Andernfalls stehe der Baum permanent in einem Warmluftkanal, was die Feuchtigkeit wegnimmt und für schnelles Nadeln sorgt.
Die Bäume im „Kroawäldla“ gibt es direkt vor Ort am 1. Adventssamstag, sowie an den übrigen drei Adventswochenende Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 15 Uhr. Außerdem steht Hans-Peter Gäbelein am 13. Dezember ab 10 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt im Lehental und am 14. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt im Bräuwerck in Neudrossenfeld.
Josephine Steidl, Weihnachtsbaumverkauf Martin, Vorderreuth bei Stadtsteinach
Josephine Steidl vom Weihnachtsbaumverkauf Martin bei Stadtsteinach schließt Preiserhöhungen aus. „Wir halten seit Jahren die Preise unserer Bäume konstant“, sagt sie. Wie sich der Preis in den nächsten Jahren entwickelt, könne man aktuell nicht sagen, da dies von vielen Faktoren wie Ernteeinbußen durch Hitze oder Spätfröste, Preise für Dünger und Zubehör, und vieles mehr abhängt.
„Dieses Jahr hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter, da es keine andauernden Hitzeperioden und stattdessen sehr viel Regen gab“, so Josephine Steidl. Auch der Spätfrost habe die Kulturen dieses Jahr verschont. So viel Glück hatten leider nicht alle: Vor allem in Dänemark, aber auch bei Produzenten in Deutschland, habe der Spätfrost viele Triebe zerstört und damit eine komplette Wachstumsperiode gekostet. Dies hat in vielen Bereichen Dänemarks zu erhöhten Einkaufspreisen für deren Bäume geführt, welche vermutlich auch auf den Endkunden übertragen werden müssen. „Die Preiserhöhungen finden jedoch bei uns nicht statt, da wir seit diesem Jahr an unseren Ständen ausschließlich eigene, heimische Weihnachtsbäume verkaufen.“
Die Bäume aus Vorderreuth bei Stadtsteinach gibt es unter anderem in Kulmbach (Rewe Markt), Stockheim (Edeka Höhn), Bayreuth (Freiheitsplatz, Volksfestplatz, Edeka Supercenter), Bindlach (Edeka Schneider) und Hof (Kirchplatz). Tagesstände gibt es außerdem in Neudrossenfeld, Konradsreuth, Weißenstadt und Arzberg. Bei den städtischen Plätzen würden vor allem mittelgroße Bäume und eine schmale Form bevorzugt. Dies habe vor allem platztechnische Gründe da viele Kunden in Wohnungen leben, die keine hohe Deckenhöhe oder Platz für ausladende Bäume zulassen. „Diese Tendenz berücksichtigen wir bereits bei der Züchtung der Bäume, indem wir versuchen, sie in eine möglichst schmale Form zu bringen.u regionalen Bäumen und w
Von der Billigkonkurrenz abheben möchte sich der Christbaumverkauf Martin vor allem dadurch, dass sehr viel Zeit und Handarbeit in die Pflege und Qualität der Weihnachtsbäume gesteckt wird. „Neben dem Düngen investieren wir sehr viel Herzblut in den sogenannten Formschnitt. Der Schnitt sorgt dafür, dass wir bei jedem Baum die schönstmögliche Form und Dichtheit erhalten.“
Damit der Baum möglichst lange hält empfiehlt Josephine Steidl, einen „Hitzeschock“ beim Aufstellen zu vermeiden, eine frische Scheibe abzuschneiden, den Baum regelmäßig mit Feuchtigkeit zu versorgen und direkte Hitzequellen zu vermeiden.
Info: Der traditionelle Christbaummarkt in Kulmbach findet heuer vom 5. Dezember bis einschließlich Heiligabend, 24. Dezember, in einem Teilbereich der Parkflächen Luitpoldstraße/Georg-Hagen-Straße (Nähe Kulmbacher Hallenbad) statt. Die Verkaufszeiten sind werktags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. An Heiligabend erfolgt der Christbaumverkauf von 11 bis 13 Uhr.
Mehr Vorgaben und Regeln oder mehr Vertrauen auf Privatwaldbesitzer? / Forum Waldkontroversen an der Universität Bayreuth diskutierte über Förderung, Regulierung und Eigenverantwortung
Bayreuth.
En düsteres Bild vom Zustand des Waldes hat Ralf
Straußberger (Bild links), Waldreferent des Bundes
Naturschutz, beim „Forum Waldkontroversen“ an der
Universität Bayreuth gezogen. Die ungebremste
Klimakrise bringe die heimischen Wälder an ihre
Grenzen und darüber hinaus. Politik und Waldbesitzer
würden sehenden Auges in die Katastrophe laufen,
sagte er und forderte ein Mindestmaß an gesetzlichen
Vorgaben und Regeln, wie etwa ein Kahlschlagverbot,
das es in Bayern bislang nicht gebe.
Nicht
alle Redner stimmten bei den 7. „Waldkontroversen“
in die Thesen von Ralf Straußberger ein. Justus Bork
(Bild links), stellvertretender Referatsleiter im
Bayerischen Landwirtschaftsministerium etwa sprach
sich dafür aus, mit Hilfe von Fördermaßnahmen und
Beratungsleistungen bei Waldbesitzern die
„Befähigung zur aktiven Waldpflege“ zu schaffen. Nur
durch aktives Handeln könnten Bayerns Wälder den
Klimawandel meistern und dauerhaft ihre Funktionen
erfüllen. Das Ministerium habe dafür eine ganze
Reihe von Instrumenten, wie etwa die
Waldumbauoffensive 2030, das Waldförderprogramm, das
Vertragsnaturschutzprogramm Wald oder die Initiative
Zukunftswald Bayern. Beinahe unzählige
Einzelmaßnahmen seien damit bereits unterstützt
worden. Allein im Waldförderprogramm würden 50 bis
60 Millionen Euro pro Jahr für die
Wiederaufforstung, zur Jungbestandspflege sowie für
Praxisanbauversuche, Saat und Naturverjüngung
ausgegeben.
Andy
Selter (Bild links) vom Lehrstuhl Forst- und
Umweltpolitik an der Universität Freiburg sprach
sich ebenfalls dafür aus, mehr auf die Befähigung
der Privatwaldbesitzer zu vertrauen. Allerdings
gingen die Meinungen bei den vielen verschiedenen
Interessensvertretern oft weit auseinander. Deshalb
sollte man sich auf die zentralen Aufgaben
staatlicher Steuerung einigen: den Schutz des Waldes
und seiner Ökosystemleistungen und einen fairen
Zugang zu den Ressourcen.
Aber genau das sei in Gefahr, warnte Ralf Straußberger vom Bund Naturschutz. Konkret kritisierte er unter anderem die Wegebaumaßnahmen, die seiner Meinung nach ein rein betriebswirtschaftliches Ziel hätten. „Da sollte der Naturschutz mehr beteiligt werden“, forderte er. Deutlich unterbelichtet in de Förderung sei das Thema Naturverjüngung. Praxisanbauversuche für neue Baumarten fehlten gänzlich.
Seit Jahrzehnten nicht gelöst werde das Verbissproblem in den bayerischen Wäldern. „Wald und Jagd, das ist ein dokumentiertes Versagen“, fand Straußberger deutliche Worte. Seit fünf Waldinventuren sei die Verbisssituation nur bei 23 Prozent der Hegegemeinschaften durchgehend günstig oder zumindest tragbar. Für den BN-Sprecher sind das eindeutig gesetzeswidrige Zustände und deshalb sei staatliches Handeln notwendig.
Bilder:
1.
„Politik und Waldbesitzer laufen sehenden Auges in
die Katastrophe“: Ralf Straußberger, Waldreferent
beim Bund Naturschutz.
2. "Befähigung zur aktiven Waldpflege schaffen“:
Justus Bork, stellvertretender Referatsleiter im
Bayerischen Landwirtschaftsministerium.
3. „Mehr
auf die Befähigung von Privatwaldbesitzer
vertrauen“: Andy Selter vom Lehrstuhl Forst- und
Umweltpolitik an der Universität Freiburg.,
Ansprechende Ernte, unbefriedigende Preise / Verhaltene Nachfrage nach der „Königin im Ackerbau“ - Oberfränkische Braugerstenschau
Kulmbach.
In diesem Jahr konnte in Oberfranken eine sehr
ansprechende Braugerstenernte eingefahren werden.
Diese Bilanz hat der Vorsitzende Hans Pezold bei der
Braugerstenschau im Kulmbacher Mönchshof gezogen.
„Extrem unbefriedigend“ sei dagegen seit Frühsommer
2025 die Preissituation für freie Ware gewesen.
Trotzdem komme so mancher Landwirt für die Ernte
2025 „noch mit einem Kratzer oder zumindest mit
einem blauen Auge“ davon, da bereits im
Herbst/Winter 2024/2025 Vorverträge mit einem
auskömmlichen Preis geschlossen worden seien.
Als Grund für die unbefriedigende Preissituation nannte Hans Pezold in erster Linie die Situation auf dem Biermarkt. Er sprach von saisonal markanten Absatzeinbrüchen und von einem veränderten Konsumverhalten. „Die Generation der Bierkonsumenten wird merklich kleiner.“ Kastenware gehe meist in der Aktion über den Ladentisch und in den Gaststätten verzichte man auf das zweite und dritte Bier.
Damit sei für die Mälzer der Absatz im Inland durch fehlende Abrufe der Brauereien begrenzt. Das für viele Mälzer wichtige Standbein des Exports werde durch teure Energiekosten, insbesondere dem hohen Gaspreis, in der Produktion massiv geschwächt. Bei den Mälzereien werde über eine Auslastung von nur 75 bis 80 Prozent gesprochen. Die Läger seien voll und die Nachfrage nach Braugerste allenfalls verhalten.
Trotzdem blickte Hans Pezold optimistisch in die Zukunft: Veränderungen werde es geben, aber die Braugerste werde nicht aus dem Anbauplan verschwinden. Der Vorsitzende bezeichnete das Bier als Grundnahrungsmittel in Bayern und die Sommergerste als die „Königin im Ackerbau“. „Wir sind stolz, dass wir den Rohstoff für ein hervorragendes natürliches Produkt herstellen können. Die ganze Welt beneide uns um die Qualität des bayerischen und des fränkischen Bieres.“
Nach
den Worten von Fritz Ernst vom Landwirtschaftsamt
Bayreuth ist die oberfränkische Anbaufläche für
Sommergerste 2025 um rund zehn Prozent auf 19.473
Hektar angestiegen. Das entspreche etwa zehn Prozent
der gesamten Ackerfläche im Regierungsbezirk. Trotz
des Anstiegs habe der Anbau 2025 immer noch auf dem
zweitniedrigsten Wert seit Jahrzehnten gelegen. Die
Wintergerste inklusive Winterbraugerste war dagegen
um rund 3000 Hektar auf 22444 Hektar zurückgegangen.
Nach Winterweizen und Mais nehme damit die
Wintergerste Platz und die Sommergerste Platz vier
der oberfränkischen Feldfrüchte ein.
„Bayerisches Bier ist ein Getränk, das Identität schafft“, so Stephan Sedlmayer, Präsident der Landesanstalt für Landwirtschaft Weihenstephan/Freising. Auch er bedauerte den zurückgehenden Bierkonsum, seit 1003 um immerhin ein Viertel. Aktuell müsse man den niedrigsten Bierkonsum aller zeiten feststellen. Dabei stehe Bier wie kaum ein anderes Produkt für Regionalität und Nachhaltigkeit. Der Anbau und die gesamte Verarbeitung, alles finde in Bayern statt. Chancen für die Zukunft sah Sedlmayer vor allem auf dem Markt der alkoholfreien Biere, aber auch in der Möglichkeit, Reis durch Gerste zu ersetzen. Nicht zuletzt sei die Gerste auch in der Fruchtfolge absolut positiv zu sehen, denn sie benötige einen sehr geringen Stickstoff- und Pflanzenschutzeinsatz.
Aus den 71 eingereichten Mustern wurden bei der Braugerstenschau anhand verschiedenster Kriterien wie Eiweißgehalt oder Kornausbildung drei Bezirkssieger gekürt: Auf den 1. Platz kam Stefan Grasser aus Königsfeld (Landkreis Bamberg) mit der Sorte LG Caruso, gefolgt von Alexander Müller aus Großheirath (Landkreis Coburg) mit der Sorte KWS Donau. Dritter wurde der Vorsitzende Hans Pezold aus Marktleugast (Landkreis Kulmbach) mit der Sorte Sommerset.
Bilder:
1. 71
Muster wurden diesmal zur Braugerstenschau von
oberfränkischen Landwirten eingereicht und bei der
Braugerstenschau ausgestellt.
2. Vorsitzender
Hans Pezold, Staatssekretär Martin Schöffel und der
Präsident der Landesanstalt für Landwirtschaft
Stephan Sedlmayer (von rechts) blicken auf de
Ergebnisse der Braugerstenschau.
Repräsentatives Bekenntnis zum eigenen Produkt / WBV Bamberg plant Bau eines neuen Geschäftsgebäudes – Kritik am “Bürokratiemonster EUDR“
Scheßlitz,
Lks. Bamberg. Die Waldbesitzervereinigung Bamberg
will in den kommenden Jahren ein neues
Geschäftsgebäude mit integrierter Lagerfläche
errichten. Ein entsprechender Beschluss wurde bei
der Jahreshauptversammlung in Scheßlitz gefasst. Das
rund 4000 Quadratmeter große Grundstück im
Gewerbegebiet Brandäcker Süd am Rande von Scheßlitz
hatte die WBV bereits für rund 260000 Euro erworben.
Bei der Versammlung stellten die Vorsitzende
Angelika Morgenroth und Beiratsmitglied Hans-Jürgen
Knoblach die Pläne vor. Der ermittelte Kostenrahmen
für den Neubau geht von rund 540000 Euro aus.
Derzeit ist die WBV in einem Gebäude zusammen mit dem Bereich Forsten des Bamberger Landwirtschaftsamtes untergebracht. Die Lagerflächen befinden sich im gut zwölf Kilometer entfernten Königsfeld. Im Amtsgebäude leide die WBV nicht nur unter Platz- und Raummangel, sondern auch unter der fehlenden Barrierefreiheit und dem schlechten Parkplatzangebot. Die entfernt liegenden Lagerflächen ließen ein effizientes Arbeiten kaum zu. „Mit Büros, Lager, Werkstatt und Schulungsräumen an einem Standort wollen wir optimale Arbeitsbedingungen schaffen“, sagte Beirat Hans-Jürgen Knoblach.
Als sichtbares Zeichen gelebter Wald- und Forstwirtschaft sowie als „repräsentatives Bekenntnis zum eigenen Produkt“ soll das Gebäude in Holzbauweise errichtet werden. „Eine Blechhalle wird dem Bild unserer WBV nicht gerecht“, so Hans-Jürgen Knoblach. Er sah im Bau eines neuen Geschäftsgebäudes eine sinnvolle Investition in die Zukunftsfähigkeit der WBV. Zumal die Aufgaben dem forstlichen Zusammenschluss in den kommenden Jahren nicht ausgehen werden
Dafür sorgt unter anderem die EU mit ihrer neuen Verordnung über entwaldungsfreie Produkte, kurz EUDR. Am Rande der Jahreshauptversammlung kritisierte Andreas Täger, Forstwissenschaftler und Geschäftsführer der WBV-Westallgäu, die EUDR als „unglaubliches Bürokratiemonster“. „Es ist der totale Wahnsinn“, sagte er. Schon allein deshalb, weil es in Deutschland gar kein Entwaldungsproblem gebe, was aber von Seiten der Politik und der Verwaltung suggeriert werde. Grundgedanke der EUDR sei es, die weltweite Entwaldung, also die Umwandlung von Wald zu Produktionszwecken, einzudämmen.
Für die Waldbesitzer bedeute dies, dass sie künftig bei jedem Einschlag Sorgfaltspflichterklärungen abgeben müssen. Dazu gehört eine Registrierung bei der EU, bei der für jeden Einschlag unter anderem das genaue Flurstück, der wissenschaftliche Name der eingeschlagenen Baumart, die eigene Steuernummer und viele weitere Daten eingegeben werden müssten. „Sie wollen, dass der kleine Privatwaldbesitzer nichts mehr macht und der Privatwald auf der Strecke bleibt“, vermutete Andreas Täger und forderte die EBV-Mitglieder auf, sich gegen das Vorhaben, das bereits zum Jahreswechsel in Kraft treten soll einzusetzen. „Wenn wir es nicht machen, dann macht es keiner.“
Die WBV Bamberg hatte im Jahr 2024 im Auftrag ihrer 2443 Mitglieder eine Holzmenge von genau 29109 Festmetern vermarktet, so Geschäftsführer Frank Kaiser. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies einen gewaltigen Rückgang um rund 46 Prozent. Ursache dafür ist, dass im Vorjahr eine extreme Menge an Käferholz angefallen ist.
Bild: Warnung vor dem „Bürokratiemonster EUDR: Forstwissenschaftler Andreas Täger von der WBV-Westallgäu mit der Vorsitzende der WBV Bamberg Angelika Morgenroth.
Lichterketten und Girlanden statt politischer Botschaften / Am 28. November rollen wieder festlich geschmückte Schlepper durch die Stadt
Kulmbach.
Immer wenn sich die Landwirte zur Vorbereitung der
alljährlichen Lichterfahrt treffen, dann ist die
Adventszeit nicht mehr weit. Auch in diesem Jahr
wird es wieder eine stimmungsvolle Rundfahrt mit
etwa 30 fantasievoll geschmückten Schleppern durch
Kulmbach geben. Termin ist der 28. November und
damit der Freitag vor dem 1. Advent. Los geht es um
17 Uhr in Melkendorf. Nach der Rundfahrt treffen
sich alle Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen auf dem
Parkplatz des Globus-Baumarktes an der Lichtenfelser
Straße. Dort gibt es Glühwein, Punsch und
selbstgebackene Plätzchen auf Spendenbasis. Der
Erlös geht an eine gemeinnützige Initiative.
1800 Euro seien im vergangenen Jahr zusammengekommen, sagt Lukas Schütz vom Organisationsteam. Das Geld wurde damals an den Hospizverein übergeben. Heuer sollen die Spenden an die Diakonie Kulmbach gehen.
Auch in diesem Jahr sind die Kulmbacher Landwirte wieder die ersten, die ihre Traktoren polieren und mit Lichterketten und Girlanden schmücken. Die Landwirte beispielsweise in Bayreuth werden die Rundfahrten durch ihre Städte erst eine Woche später zum 2. Advent starten.
Ziel
der Aktion ist es, wie schon in den zurückliegenden
Jahren, sich bei den Menschen zu bedanken, ihnen
eine Freude zu machen und die Werbetrommel für die
heimische Landwirtschaft rühren. Um politische
Botschaften soll es dagegen nicht gehen.
Transparente wird man an den Schleppern vergebens
suchen, dafür aber jede Menge weihnachtliche Deko,
Girlanden und Lichterketten. „Wir würden uns aber
schon freuen, wenn wir mit den Verbrauchern ins
Gespräch kommen könnten“, so Kathrin Erhardt aus
Motschenbach, die ebenfalls zu den
Hauptorganisatoren gehört.
Auch die Kritiker der Rundfahrt, die im Nachgang regelmäßig beispielsweise die Kommentarspalten bei Facebook füllen und sich über den aus ihrer Sicht unnötigen Dieselverbrauch, über Abgase und die großen Fahrzeuge beschweren, seien herzlich eingeladen. „Gerne sprechen wir mit möglichen Gegnern der Rundfahrt“, sagt Kathrin Ehrhardt. Die Rundfahrt soll ja nicht nur Spaß sein, die Landwirte wollen auch Verständnis für ihre Arbeit in der Bevölkerung wecken. Schließlich seien es die Bauern, die alle Menschen mit Lebensmitteln versorgen.
Einzige Neuerung heuer: die Fahrt geht über den Schießgraben und durch die Obere Stadt und ist damit noch ein wenig länger als im vergangenen Jahr. Hintergrund ist, dass zur gleichen zeit der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz eröffnet wird. „Wir machen das aus Sicherheitsgründen“, sagt Lukas Schütz. Freilich haben die Kulmbacher damit och mehr Möglichkeiten die Fahrzeuge aus der Nähe zu bewundern.
Am
Globus-Parkplatz ist allerdings noch lange nicht
Schluss. Bratwürste, Steaks und andere Leckereien
hält die Gastronomie des Baumarktes vor, die
Landwirte selbst bringen Glühwein, Kinderpunsch,
selbstgebackene Plätzchen und Knabbereien mit. Die
Organisatoren bitten allerdings darum, im Sinne der
Nachhaltigkeit, und um Plastik möglichst zu
vermeiden, dass Tassen selbst mitgebracht werden. In
den zurückliegenden Jahren habe das hervorragend
funktioniert.
Ein wenig wehmütig denken die Teilnehmer diesmal auch an Sabine Weich, die im zurückliegenden Jahr unerwartet verstorben ist. Sie gehörte vor fünf Jahren zu den Mitbegründerinnen der Lichterfahrt und zu den Organisatoren der ersten Stunde. Auch die diesjährige Rundfahrt hatte sie noch eifrig mitgeplant und organisiert. „Sabine Weich wird uns fehlen, sie wird auf keinen Fall vergessen“, so Kathrin Erhardt.
Der Korso startet am Freitag, 28. November, um 18 Uhr auf dem Betrieb von Hermann Grampp in Melkendorf / Unterkodach. Von dort aus geht es Richtung Kulmbach zur Schauer-Kreuzung, rechts auf die B85 zur Fröbel-, Friedrich-Schönauer- und zur Weiher-Straße. Über die Wilhelm-Meußdorfer- und Pestalozzistraße gelangen die Traktoren dann zum Kressenstein. Die weiteren Stationen sind Holzmarkt, Klostergasse, Schießgraben, Obere Stadt und dann über die Kronacher, die Heinrich-von-Stephan- und die Lichtenfelser Straße zum Globus Baumarkt. Dort werden die Schlepper ab 19 Uhr erwartet und etwa zwei Stunden stehen bleiben.
Bilder: So sehen sie aus, die geschmückten Traktoren, die am Freitag, 28. November im Korso durch Kulmbach rollen und für funkelnde Kinderaugen sorgen werden.
Landwirte als Problemlöser unserer Zeit / Megathema ländlicher Raum: BBV-Generalsekretär Carl von Butler beim Forchheimer Landwirtschaftsforum
Forchheim.
Der ländliche Raum kann der Problemlöser für viele
Herausforderungen unserer Zeit sein. Bei sämtlichen
Megatrends unserer Zeit spielt der ländliche Raum
eine rolle, darauf hat der Generalsekretär des
Bayerischen Bauernverbandes Carl von Butler beim
Landwirtschaftsforum der Sparkasse Forchheim
hingewiesen. Egal ob Sicherheit, Urbanisierung,
Gesundheit oder Mobilität, stets kommt dem
ländlichen Raum eine wichtige Rolle zu, das konnte
Carl von Butler in seinem Vortrag überzeugend
nachweisen.
Zum Beispiel beim Thema Sicherheit: da gehe es nicht nur um militärische Konflikte und Verteidigung, sondern auch um die Sicherheit von Energie, Wasser und Lebensmitteln. Leider hätten viele Menschen die Zusammenhänge aus den Augen verloren. Für sie kommen Strom aus der Steckdose und Lebensmittel aus dem Supermarkt. Doch produziert wird in der Landwirtschaft und damit im ländlichen Raum. Wer hier glaubt, Flächen stilllegen zu können, befinde sich auf dem Irrweg. „Am Ende des Tages bedeute dies nicht weniger Ernte von der Fläche, sondern den deutlichen Bedarf nach mehr Ernte von der Fläche“, so der Generalsekretär.
Auch bei der Urbanisierung, also der zunehmenden Ausbreitung städtischer Lebensformen, komme der ländliche Raum ins Spiel. Dabei gehe es nicht darum Städte unattraktiv zu machen, sondern den ländlichen Raum attraktiv zu halten. Das sei sogar eine wichtige Vorgabe unserer verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen: gleichartige Lebensverhältnisse im ganzen Land. Nur wenn der ländliche Raum attraktiv gehalten werden kann, werden junge Leute bleiben.
Eine wichtige Rolle spiele der ländliche Raum nach den Worten Carl von Butlers beim Thema Gesundheit. Zukünftig werde sich nicht mehr jeder die qualitativ hochwertigen Lebensmittel aus heimischer Produktion leisten können, sondern auf qualitativ fragwürdige Importprodukte zurückgreifen müssen, warnte er. „Auch hier könnte der ländliche Raum mehr leisten, wenn dies politisch gewollt wäre“, so der Generalsekretär.
Eine ganz besondere Bedeutung habe der ländliche Raum in Sachen Mobilität. Ohne die Sicherstellung von Mobilität werde der ländliche Raum abgehängt. „Das wäre gesellschaftspolitisch fatal“, so der Sprecher, weil dann sämtliche Vorteile des ländlichen raumes gar nicht mehr genutzt werden könnten.
Zuvor hatte der Forchheimer Kreisobmann und oberfränkische BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif die Besonderheiten seines Landkreises herausgestellt. Mit 85 Prozent Nebenerwerb habe der Landkreis Forchheim die höchste Nebenerwerbsquote in Bayern. Egal ob Spargel, Erdbeeren oder Meerrettich: dies und viele andere Sonderkulturen seien in Forchheim zu finden. In besonderer Art und Weise präge der Obstbau die Region, während die Tierhaltung dagegen immer weiter abnimmt. „Oft sind die Hühner noch die einzigen Nutztiere im Dorf“, so Hermann Greif. Auch die zahl der Bäckereien und Metzgereien gehe rapide zurück. Ungerechtfertigte mediale Kritik und völlig aus dem Ruder gelaufener Bürokratismus machte der BBV-Präsident dafür in erster Linie verantwortlich. Dabei könnten die Bauern Problemlöser für viele Herausforderungen unserer Zeit sein, sagte er: „Wir Bauern sind die Startups, die unser Land braucht.“
In der anschließenden Diskussion spielte die Frage, ob der Verzicht auf Fleisch ebenfalls ein Megatrend in unserer Gesellschaft sei, eine wichtige Rolle. So ganz von der Hand weisen konnte das Carl von Butler nicht. „Solange wir nicht mehr stärker körperlich arbeiten müssen, werden wir auch nicht wieder mehr Fleisch essen“, machte er sich keine Illusionen. Das Gleiche gelte im Übrigen auch für Alkohol, den große Teile der jungen Generation als giftig und schädlich ablehnten. Für die Forchheimer Bierkönigin Karolin Kübel eine schreckliche Vorstellung. Immerhin ist Oberfranken für seine einmalige Bierkultur und Biervielfalt bekannt. Allein dem Verein Bierland Oberfranken gehörten 180 Brauereien an.
Bild: Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Forchheim Harald Reinsch (links) und der Forchheimer Kreisobmann und oberfränkische BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif (rechts) bedankten sich beim BBV-Generalsekretär Carl von Butler mit einem Korb voller typischer Produkte aus der Region.
Original und regional vom Knoblauchsland zur Genussregion / Marktplatz der Gastlichkeit: Verbrauchermesse Consumenta setzt auf Landwirtschaft - Metropolregion will „Welterbe Agrarkultur“ werden
Nürnberg.
Die Europäische Metropolregion Nürnberg will sich
künftig mit dem Prädikat „Welterbe Agrarkultur“
schmücken. „Einfach wird es nicht, aber wir sind
optimistisch“, sagte Christa Standecker, die
Geschäftsführerin der Metropolregion bei der
Eröffnung der Verbrauchermesse Consumenta auf dem
Gelände der Messe Nürnberg. Eine 150 Seiten starke
Bewerbung sei von ausgewiesenen Agrarexperten
erstellt worden. Auf der Grünen Woche Berlin werde
man die Bewerbung im Januar vorstellen. Der Titel
soll unter anderem die regionale Land- und
Ernährungswirtschaft international sichtbar machen,
neue Märkte und Kooperationen erschließen. Die
Bewerbung geht zunächst an das
Bundeslandwirtschaftsministerium, letztlich wird die
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO) darüber entscheiden. Im
Falle eines Erfolges wäre die Metropolregion das
erste deutsche „Welterbe Agrarkultur“.
„Wir
stehen absolut dahinter“, sagte BBV-Präsident
Günther Felßner. Agrarkultur bedeute stets auch
Weiterentwicklung. So gesehen sei das Prädikat eine
Riesenchance, schon allein aufgrund des sinkenden
Selbstversorgungsgrades mit Lebensmitteln in
Deutschland. Kaum eine andere Gegend sei aber auch
aufgrund seiner unglaublichen Vielfalt so
prädestiniert dafür, wie die Metropolregion, sagte
der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner,
Vorsitzender des eigens gegründeten Beirats
„Welterbe Agrarkultur“.
Nach
einigen Jahren Consumenta-Pause ist der Bayerische
Bauernverband in diesem Jahr wieder ganz groß mit
von der Partie und trägt mit einem umfangreichen
Programm zum Gelingen der Messe bei. Hotspot ist
dabei die „Regionalhalle 4a“. Zahlreiche Aktive
verwandeln die Halle an den insgesamt neun
Messetagen in einen Marktplatz der Gastlichkeit.
Herzstück ist das große Bäuerinnencafé mit der
Landfrauenküche. Der Bauernverband zeigt Landtechnik
von gestern und heute, präsentiert Urlaubsangebote
auf dem Bauernhof und informiert über die heimische
Landwirtschaft. Die Landfrauen backen „Küchla“ und
„Feuerspatzen“, während zahlreiche Direktvermarkter
ihre regionalen Spezialitäten anbieten.
Gleich
nebenan hat die Bayerische Forstverwaltung ihren
Stand errichtet. In diesem Jahr gibt es Infos über
die Waldgebiete um Nürnberg, Fachleute stellen das
Konzept des „Urban Gardening“ vor und klären über
die Herausforderungen des Waldumbaus sowie über die
verschiedenen Möglichkeiten der Holznutzung auf.
Die dritte große Präsentation liefert die Metropolregion. Der Zusammenschluss zeigt zahlreiche fränkischen Genuss- Aushängeschilder unter dem Motto „Original - Regional“. Verschiedene regionale Brauereien sind dabei, Marmeladen, Brotaufstriche, Honig, Liköre, Edelbrände und vieles mehr wird angeboten, außerdem gibt es einen Biergarten.
Die
Consumenta gilt als bedeutendste Publikumsmesse in
Süddeutschland. „Die Consumenta ist auch die größte
Messe der Region“, so die Veranstalter Henning und
Thielo Könicke, die an der Spitze der AFAG-Messen
und Ausstellungen GmbH stehen. Knapp über 1000
Aussteller aus den Bereichen Handel, Industrie,
Dienstleistung und Gastronomie sind diesmal auf dem
Nürnberger Messegelände dabei. Bei der Eröffnung
freute sich Finanz- und Heimatstaatssekretär Martin
Schöffel darüber, dass die Land- und
Ernährungswirtschaft wieder so stark vertreten ist.
Vom Genuss guter Biere und Weine bis zum Kauf eines
Caravans sei auf der Consumenta alles möglich, sagte
er.
Die
Consumenta hat noch bis Sonntag, 9. November jeweils
von 10 bis 18 Uhr (Einlass bis 17 Uhr) geöffnet. Der
Eintritt kostet für Erwachsene 18 Euro, ermäßigt 17
Euro. Für Kinder bis 14 Jahren kostet das Ticket 2
Euro, Schüler und Studenten ab 14 Jahren müssen 7
Euro zahlen.
Bilder:
1. Die
Fürther Landfrauen haben zur Eröffnung der
Consumenta leckere „Küchla“ und Feuerspatzen
zubereitet. Das BBV-Landfrauencafé bildet den
Mittelpunkt der Regionalhalle 4a, in der die
Landwirtschaft zusammen mit zahlreichen
Spezialitätenanbietern einen Marktplatz der Genüsse
errichtet hat.
2. Sie
wollen erreichen, dass die Metropolregion zum
„Welterbe Agrarkultur“ ernannt wird (von links):
BBV-Präsident Günther Felßner, Geschäftsführer
Christa Standecker, der Kulmbacher Landrat Klaus
Peter Söllner, Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus
König und Moderator Lucas Koschyk von den Nürnberger
Nachrichten.
3. Eine
typische Spezialität aus der Fränkischen Schweiz ist
Edel-Schaumwein aus heimischen Äpfeln mit dem Namen
„Charlemagner“, den Ludwig Erlwein von der
Edelbrandbrennerei Preuschens aus Egloffstein auf
der Consumenta präsentiert.
4. Das
Gemüse aus dem Nürnberger Knoblauchsland ist auf der
Consumenta nicht nur ausgestellt, es wird auch zum
Verkauf angeboten.
5. Hier
steht der Chef selbst am Stand. Die Brände von
Johannes Haas von der Brennerei Haas aus Pretzfeld
sind zum Beispiel vom Feinschmeckermagazin bereits
vielfach prämiert worden.
6. Ausgezeichnet
mit dem Consumenta Marketing Star: der Stand der
Bayerischen Forstverwaltung mit dem Netzwerk „Holz
in Franken“.
7. Kostproben
gehen immer: hier verteilen Bettina Hechtel (Mitte)
und Kathrin Ziegler (rechts) von den Landfrauen aus
Fürth Appetithäppchen an Staatssekretär Martin
Schöffel, BBV-Präsident Günther Felßner (von links)
sowie an die mittelfränkische Bezirksbäuerin
Christine Reitelshöfer.
8. Gleich
drei Produktköniginnen waren zur Eröffnung der
Consumenta gekommen (von links): die bayerische
Honigprinzessin Anja Bürzer, die bayerische
Milchprinzessin Verena Wagner und die fränkische
Weinkönigin Antonia Kraiß.
Antizyklisch zum Erfolg / Die Familie Pöhlmann setzt im Hofer Land auf drei Standbeine
Helmbrechts.
„Wir versuchen aus allem das Beste zu machen.“ Da
sind sich Stefanie und Thomas Pöhlmann einig.
Jammern, das kommt für sie nicht in Frage. Sie
investieren lieber, und zwar antizyklisch. Soll
heißen, da wo andere die schlechten Preise beklagen,
sucht das Ehepaar nach Lösungen, um bessere Preise
zu erzielen.
Stefanie und Thomas Pöhlmann betreiben die Geigersmühle im gleichnamigen Helmbrechtser Ortsteil. Dabei handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Betrieb mit drei Standbeinen: Ferkelerzeugung, Biogasanlage und Hofcafé. 2012 hatte das Ehepaar den Betrieb von Stefanies Eltern übernommen. Bis 2007 wurde sogar noch Milchviehhaltung betrieben.
„Wer kennt die Geigersmühle nicht?“, sagen Stefanie und Thomas ganz selbstbewusst. Dass dies tatsächlich so ist, liegt in erster Linie am Bauernhofcafé, und das hat eine ganz kuriose Geschichte. Das frühere Wohnstallhaus ist zugleich das Elternhaus von Stefanie. Bis zum Jahr 2000 wurden dort sogar noch Tiere gehalten. Das Gebäude stand zuletzt leer und wäre 2014 fast zusammengefallen, wie sich Thomas erinnert.
„Es
war schon ein Wagnis“, sagt er. Das Gebäude sei
komplett entkernt, ein wenig verkleinert und mit
viel Eigenleistung zum Gastro-Raum über zwei Etagen
inklusive Küche umgebaut worden. Im September 2016
war die Eröffnung. Was zunächst lange als „ganz
normales Café“ betrieben wurde, ist heute ein
beliebter Treffpunkt für Feierlichkeiten aller Art.
Obwohl die Pöhlmanns 30 Mitarbeiter haben, sei das
damals einfach nicht mehr zu bewältigen gewesen. Von
den 30 Mitarbeitern sind allerdings nur zweieinhalb
festangestellt. Der Rest besteht im Wesentlichen aus
Minijobbern. Während der Corona-Zeit habe man sich
dann entschieden, nur noch für geschlossene
Gesellschaften zu öffnen. Mit Ausnahmen: Hin und
wieder gibt es auch einen „Gourmet-Brunch“ oder
Veranstaltungen in der Reihe „Kaffee, Kuchen und
Kultur“, bei der heimische Musiker auftreten. Der
Zuspruch sei so groß gewesen, dass man sich damals
schon bald entschieden hatte, eine benachbarte
Scheune zur Festscheune umzufunktionieren. Das
Konzept geht auf: „In Sachen Hochzeiten sind wir
2026 komplett ausgebucht“, so Thomas. Erst 2027 gebe
es wieder freie Termine.
Zweites Standbein ist die Ferkelerzeugung. Der derzeitige Stall sei für 100 Sauen genehmigt. „Wir möchten aber aufstocken“, erläutert Stefanie. Aktuell werden die Ferkel an kleinere Mäster in der Umgebung verkauft. Allerdings hat die Familie Großes vor. Sie plant aktuell unter anderem einen neuen Ferkel- und Maststall. Vor einbrechenden Preisen hart Thomas dabei keine Angst: „Es war doch schon immer ein auf und ab“, sagt er. Momentan ist man noch bei Haltungsstufe 1, man möchte aber Haltungsstufe 4 anstreben, also ein gewaltiger Sprung von der niedrigsten zur höchsten Haltungsstufe. Hintergrund ist, dass die Familie eine Vermarktung über die Handelskette Edeka plant.
Ähnlich wie bei den Ferkeln handeln Stefanie und Thomas auch bei ihrer Biogasanlage antizyklisch. Die Anlage, die rund 500 Meter von der Hofstelle entfernt ist und die von den Pöhlmanns zusammen mit einem Partner betrieben wird, gehört zu den größten im ganzen Landkreis Hof. Mit einer Leistung von 1,4 Megawatt Strom versorgt sie rund 4000 Haushalte. Abnehmer ist das Bayernwerk. Die Wärme verwertet die Familie selbst. Außerdem wird eine Lohntrocknungsanlage betrieben. „Gefüttert“ wird die Anlage jeweils zu rund einem Drittel mit Grüngut, Ganzpflanzensilage und Mais von 25 Lieferanten. Natürlich weiß auch die Familie Pöhlmann, dass die EEG-Förderung Ende 2025 ausläuft. Man hat auch schon einen Plan. Die Anlage wird künftig als Baurechtsanlage betrieben. „Wir fahren die Leistung runter.“. Am Weiterbetrieb wird aber festgehalten.
Stefanie
Pöhlmann (45) ist gelernte Landwirtin und
Agrarbetriebswirtin und hat die Höhere Landbauschule
in Bayreuth absolviert. Thomas Pöhlmann (52) hat
Maschinebau studiert und 20 Jahre in der freien
Wirtschaft gearbeitet. Auch der Nachwuchs ist
gesichert: Sohn Leonard (18) hat nach der mittleren
Reife eine Ausbildung zum Landwirt begonnen. Nach
einer Fremdlehre ist er mittlerweile auf dem
elterlichen Betrieb im dritten Lehrjahr tätig.
Schließlich ist auch Tochter Annalena (27) in der
Landwirtschaft tätig. Sie arbeitet auf dem
Biobauernhof der Lebenshilfe Hof in Martinsreuth.
Bilder:
1. Die
zuletzt leerstehende Scheune haben Stefanie und
Thomas Pöhlmann zur ansprechenden Festscheune
umfunktioniert.
2. Fast
wäre es nicht mehr zu Retten gewesen, heute bietet
es Platz für 60 Gäste: Das Bauernhofcafé in der
Geigersmühle bei Helmbrechts.
3. Die
Familie Pöhlmann bewirtschaftet die Geigersmühle in
Helmbrechts (von links): Thomas, Tochter Annalena,
Stefanie, ihre Mutter Karin Günther und Leonard.
nach oben
Nachhaltigkeit im Focus / Amt für Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg: Silke Braunmiller folgt auf Christa Reinert-Heinz – Kooperation mit Kulmbach
Bayreuth.
Haushaltsführung, das ist viel mehr als nur Kochen
und Putzen. Eine professionelle Haushaltsführung
setzt ein breites Bildungsangebot voraus. „Der
Bedarf ist riesig“, sagt die neue Abteilungsleiterin
am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Bayreuth-Münchberg, Silke Braunmiller. Sie hat
Christa Reinert-Heinz abgelöst, die zum 1. Oktober
in den Ruhestand verabschiedet wurde.
„Es gibt einen Mangel nicht nur bei Pflegekräften, sondern auch bei den Kräften der Versorgung“, sagt Christa Reinert-Heinz. Hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte würden gebraucht. Das treffe beispielsweise in Altenheimen, Kitas oder Krankenhäusern zu. Überall würden hauswirtschaftliche Fachkräfte gesucht. Trotzdem fehle es meist an der Bereitschaft. Der aktuelle Studiengang, den Silke Braunmiller vor wenigen Tagen gestartet hatte, sei nur durch eine Kooperation mit Kulmbach zustande gekommen. Die 19 Teilnehmerinnen kommen deshalb nicht nur aus den Landkreisen Bayreuth und Hof, sondern auch aus dem Kulmbacher Land.
Nach 20 Monaten dürfen sie sich „Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung“ nennen. Das sei aber „nur“ der schulische Abschluss. Für den Berufsabschluss als „Hauswirtschafterin“ ist eine separate Prüfung notwendig. Ohne diese Prüfung sei beispielsweise keine tarifliche Eingruppierung möglich.
Die Kooperation mit Kulmbach sei nötig gewesen, da zwar jeder Schulstandort Anmeldungen verzeichnen konnte, aber eben nicht genug. Damit das Semester zustande kommt, muss die Mindestschülerzahl von 16 Teilnehmerinnen erreicht werden. Im Oktober des kommenden Jahres startet dann wieder ein eigenes Semester in Münchberg.
Immer wichtiger werde bei den Teilnehmerinnen dabei auch der Gedanke der Nachhaltigkeit, so konnte es Silke Braunmiller schon nach wenigen Tagen feststellen. Plötzlich sei die Erkenntnis wieder da, dass es wichtig ist, frisches Gemüse im eigenen Garten ernten und einkochen oder mit saisonalen und regionalen Produkten vollwertige und leckere Mahlzeiten zubereiten zu können, ohne auf Fertigprodukte zurückgreifen zu müssen. „Nachhaltigkeit spielt in allen Themenbereichen der Ausbildung eine große Rolle.“
Die scheidende Leiterin Christa Reinert-Heinz war vor 45 Jahren in die Landwirtschaftsverwaltung eingetreten. 1980 startete sie ihre Fachlehrerausbildung, eine Zeitlang war sie in Bamberg, dann in Bayreuth tätig. Weil ihr das Thema Regionalentwicklung stets ganz besonders am Herzen gelegen habe, wirkte sie mehrere Jahre lang an verschiedenen Dorferneuerungsverfahren mit, bis diese Aufgabe 1996 das Amt für Ländliche Entwicklung in Bamberg übernommen hatte. Schwerpunkte der Arbeit von Christa Reinert-Heinz seien in der Folge in Bayreuth unter anderem die Organisation und Leitung der Ausbildung von Kräuterpädagoginnen als wichtige Einkommensalternative im ländlichen Raum sowie die Beratung in Fragen rund um das Thema „Urlaub auf dem Bauernhof“ gewesen. Entscheidend beteiligt war Christa Reinert-Heinz an der Gründung des Zusammenschlusses „Genuss von Wald und Weide im Bayreuther Land“. 2012 wurde sie dann als Sachgebietsleiterin Ernährung und Haushaltsleistungen nach Münchberg versetzt, 2019 übernahm sie die Abteilungsleitung in Bayreuth, ehe die beiden Ämter Bayreuth und Münchberg 2021 zusammengelegt wurden.
Die neue Leiterin Silke Braunmiller stammt aus Baden-Württemberg, hat in Stuttgart – Hohenheim Haushaltswissenschaften studiert und war ab 1991 erst im Referendariat, ab 1993 beim Amt für Landwirtschaft in Sinsheim in der Beratung unter anderem in Sachen Direktvermarktung tätig. 1997 wechselte sie an das Amt in Karlsruhe in das neu geschaffene Ernährungszentrum, ehe sie 2001 durch eine berufliche Veränderung ihres Mannes nach Bayreuth kam. Hier unterrichtete sie zunächst in Bayreuth, Kulmbach und Münchberg, ehe sie 2012 am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth ihren Dienst aufnahm, wo sie zunächst das Sachgebiet und jetzt die Abteilung leitet.
Bild: Silke Braunmiller (links) löst Christa Reinert-Heinz als Leiterin der Abteilung Hauswirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg ab.
Landwirtin mit Leidenschaft / Im Kuhstall und im OP-Saal gleichermaßen zuhause: Stephanie Kießling hat ihre landwirtschaftliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
Marktschorgast.
Leidenschaft. Wer mit Stephanie Müller, die seit
ihrer Heirat vor kurzem den Nachnamen Kießling
trägt, aus Pulst bei Marktschorgast über das Thema
Landwirtschaft spricht, wird dieses Wort öfter
hören. Stephanie stammt aus der Landwirtschaft, ihre
Eltern bewirtschaften einen Milchviehbetrieb mit
rund 50 Kühen mit Nachzucht und rund 40 Hektar
Fläche. Nun hat sie ihre Ausbildung zur Landwirtin
erfolgreich abgeschlossen. Ob sie den Hof eines
Tages übernehmen wir, steht noch in den Sternen.
Landwirtin mit Leidenschaft ist sie auf jeden Fall.
Obwohl, so ganz stimmt das nicht, denn Stephanie ist eigentlich medizinische Fachangestellte und Fachwirtin für medizinisch ambulante Versorgung. Sie arbeitet in einer chirurgischen Fachpraxis in Bayreuth, wo sie von der Anmeldung über Röntgen und Gipsen bis hin zum OP-Saal für so alles mit zuständig ist. Die Landwirtschaft hat sie in all dieser Zeit aber nicht losgelassen. Also griff sie im August 2023 noch einmal an und meldete sich beim Amt für Landwirtschaft in Bamberg für einen BiLa-Kurs an.
BiLa steht für Bildungsprogramm Landwirt. Diese nebenberufliche Ausbildung ist eine Besonderheit, weil sie sich an Teilnehmer richtet, die bereits einen außerlandwirtschaftlichen Beruf erlernt haben, also beispielsweise an Seiteneinsteiger, Familienangehörige oder Mitarbeiter landwirtschaftlicher Unternehmen. Im Fall von Stephanie war es so, dass sie dreimal zwei Wochen in Bamberg präsent sein musste, die restliche Theorie fand online statt. Auch Praxistage auf verschiedenen Betrieben gehörten dazu
„Der Urlaub ist draufgegangen“, sagt Stephanie. Doch das machte nichts, denn sie war überaus motiviert. „Man muss halt eben Leidenschaft mitbringen.“ Genau das war bei Stephanie der Fall. Außerdem hätten sie ihre Eltern Monika und Hermann Müller stets tatkräftig unterstützt. Dafür hilft sie auch auf dem elterlichen Betrieb, wo immer sie kann. „Ich bin halt der Springer“, sagt sie. Ihren Wohnsitz hat sie mittlerweile in Bayreuth, doch mindestens jeden zweiten tag taucht sie in Pulst auf.
Viele Jahre lang war Stephanie Vorsitzende der Landjugend Bad Berneck-Bindlach. Auch in der örtlichen Jungen Union war sie als Vorsitzende aktiv. Weil Landjugendmitglieder nach der Heirat keine regulären Landjugendmitglieder mehr sein dürfen, steht sie mittlerweile dem Altmitgliederverein vor. Und auch beim Kreisjugendring Bayreuth ist sie im Vorstand. Das ehrenamtliche Engagement ist ihr irgendwie auch in die Wiege gelegt worden. Der Vater ist Ortsobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), die Mutter zweite Bürgermeisterin von Marktschorgast.
„Ich fahre nicht unbedingt immer mit dem größten Schlepper durch die Gegend“, sagt Stephanie. Ihr liegt mehr die Arbeit im Stall. Dafür habe sie die absolute Leidenschaft entwickelt. Warum sie dann nicht gleich eine Ausbildung zur Landwirtin gemacht hat? „Zurückkommen kann man immer“, antwortet sie recht pragmatisch.
Zurück nach Pulst kommt sie auch immer wieder gerne von ihren Fernreisen, eines ihrer größten Hobbys. Afrika, Norwegen, Peru: Stephanie war schon auf der ganzen Welt unterwegs. Und wenn doch noch Zeit bleibt, dann stehen sportliche Aktivitäten, Radfahren oder Wandern auf dem Programm. Und Motoradfahren auf der eigenen Maschine, doch dazu hat sie momentan absolut keine Zeit.
Stephanie Müller ist eine von den 32 jungen Frauen und Männern aus den Landkreisen Bamberg, Coburg, Forchheim, Kronach, Kulmbach und Lichtenfels, die kürzlich ihre Ausbildung zum staatlich anerkannten Beruf Landwirt erfolgreich abgeschlossen haben. Sie tat dies im Rahmen des Bildungsprogramms Landwirt (BiLa). Die Seminarangebote umfassen verschiedene Themenbereiche wie beispielsweise Pflanzenbau, Tierproduktion, Betriebswirtschaft, Waldbau oder ökologischer Landbau.
Bild: Stephanie Müller, die seit ihrer Heirat vor kurzem den Nachnamen Kießling trägt, hilft regelmäßig im Stall des elterlichen Betriebes aus.
Imkerin Jessica Müller aus Katschenreuth: Zwei Stände, elf Völker, 100.000 Bienen
Katschenreuth.
„Bienen haben mich schon immer fasziniert“, sagt
Jessica Müller. Es sei immer wieder spannend, zu
beobachten, wie sich die Völker entwickeln. Routine
gibt es da nicht. Die 44-Jährige aus Katschenreuth
ist Imkerin, aus Leidenschaft, wie sie selbst sagt,
denn das ganze ist viel mehr als nur ein Hobby. 2016
hatte sie mit einem Bienenvolk angefangen. Heute
kümmert sie sich um vier Völker bei sich zuhause und
um weitere sieben Völker am Standort Lehenthal.
Dazu muss man wissen, dass ein Volk aus 5.000 bis 10.000 Bienen besteht, im Sommer können es bis zu 25.000 Bienen pro Volk werden. Ein Bekannter, selbst Imker, habe sie damals für die ungewöhnliche Tätigkeit interessiert. „Natur war schon immer meins“, sagt Jessica Müller. Vor allem die vielfältigen Zusammenhänge in der Natur hätten sie fasziniert. Und nicht zuletzt sei die Arbeit mit den Bienen auch absolut beruhigend.
Nun ist es nicht so, dass Jessica Müller nichts anderes zu tun hätte. Hauptberuflich ist sie für ein Umweltlabor in Bindlach bei Bayreuth tätig, nebenberuflich ist sie als Baumpflegerin unterwegs, denn seit dem vergangenen Jahr darf sie sich nach entsprechender Ausbildung zertifizierte Obstbaumpflegerin nennen.
Das mit dem Imkern sei aber schon mehr als ein bloßes Hobby, sagt sie. Obwohl auch hier ein Kurs notwendig war, um sämtliche Grundlagen zu kennen. Ein Spaziergang sei dieser Kurs nicht gewesen. Ein Jahr habe sie dazu, immer an den Wochenenden, die Umweltschule in Mitwitz besucht. Dafür kennt sie heute alle Tricks und Kniffe, die man als Imker so braucht. Als Nebenprodukt springt dabei auch noch leckerer Honig raus, 25 bis 30 Kilogramm pro Volk und Jahr. Für den Eigenverbrauch viel zu viel. Also vermarktet sie den Honig, beispielsweise bei Getränke Rausch in Katschenreuth.
Steigt man tiefer in die Imkerei ein, so merkt man schnell, dass dies eine Wissenschaft für sich ist. Aus Lehenthal komm der dunkle Honig, weil dort viele Wälder sind, in denen die Bienen umherschwirren. Rund um Katschenreuth wird dagegen viel Mais und Raps angebaut. Dort ist die Farbe des Honigs viel heller und wird als Blüten- oder Sommerhonig angeboten.
Ihren Honig füllt die Imkerin getrennt nach Standort ab, das heißt, man kann gezielt auswählen aus welchem Ort Ihr Honig stammt. Normalerweise gebe es zwei Ernten pro Jahr, im Frühjahr und Sommer. Der Charakter der Honige sei jedes Jahr etwas anders, allerdings lasse sich die grobe Richtung so beschreiben: Frühjahrsblütenhonig ist durch Obst- und Rapsblüte geprägt und hell und cremig, der Sommerhonig eher dunkler und flüssiger zum Beispiel mit Lindenblütenanteil.
Mit
dem Honig aus dem Supermarkt kann und will Jessica
Müller nicht mithalten. Dort kommt der Honig aus
aller Herren Länder, beispielsweise aus Mexiko, dem
größten Honigproduzenten weltweit, oder aus China.
Supermarkt-Honig werde so gemischt, dass er immer
den gleichen Geschmack hat. Trotz der langen
Transportwege ist dieser Honig deutlich billiger als
der heimische. „Aber ich weiß, was drin ist“, sagt
die engagierte Imkerin.
So weit wie nur möglich, arbeitet Jessica Müller auch nach biologischen Richtlinien. Zertifiziert ist sie aber trotzdem nicht. Zum einen wegen der Kompostieranlage in Katschenreuth, die nur etwa einen Kilometer von den Bienenvölkern entfernt liegt. Bienen fliegen immerhin bis zu sechs Kilometer weit. Zum anderen wegen der hohen Zertifizierungskosten. Sie gibt trotzdem alles, um in ihrer Imkerei so weit wie möglich Bienengerecht zu arbeiten. „Das heißt für mich, dass meine Bienen zum Teil auch auf ihrem eigenen Honig überwintern dürfen. Die Bienen leben bei mir nur in Holzbeuten die komplett naturbelassen und nicht behandelt sind.“
Jetzt im Winter kann Jessica Müller die Bienenstöcke auch mal eine Zeitlang allein lassen. Im Frühjahr, wenn die Schwarmzeit beginnt, gibt es jeden Tag etwas zu tun. Eine Stunde pro Tag sei da gar nichts.
Kopfzerbrechen bereiten allen Imkern Bienenseuchen wie die Amerikanische Faulbrut, eine bakterielle anzeigepflichtige Brutkrankheit bei Honigbienen. Bei einem Bienenvolk in Hof wurde die Bienenseuche im Frühjahr festgestellt. Als Folge davon hatte die Stadt einen Sperrbezirk von rund einem Kilometer Radius um den Auffindeort eingerichtet, um die Seuche einzudämmen. Im Kulmbacher Land gab es im April 2022 einen solchen Fall mit Einrichtung eines Sperrbezirkes. Verbraucher brauchen sich allerdings keine Sorgen machen, auch nicht beim Verzehr von mit Sporen belastetem Honig: Die ursächlichen Bakterien können beim Menschen keine Krankheiten auslösen.
Gestochen worden ist Jessica Müller übrigens schon öfter. Das bleibt einfach nicht aus, sagt sie, trotz aller Schutzmaßnahmen.
Bilder: Imkerin aus Leidenschaft: Jessica Müller aus Katschenreuth.
Mit Kameras und GPS-Trackern gegen Holzdiebstahl / Fallaufkommen stagniert, Waldbesitzer trotz stagnierendem Fallaufkommen verunsichert
Kulmbach/Bayreuth. Im laufenden Jahr gab es bereits mehrere Fälle, in denen Waldbesitzern Holz gestohlen wurde. Die Diebe sind dabei teilweise recht dreist vorgegangen, fahren mit Holztransportern direkt in den Wald, um am helllichten Tag Holzstämme aufzuladen. Bei den Waldbauern sorgt das für Unsicherheit. In der Region sind die Holzdiebstähle längst ein Thema.
Gerhard Potzel, WBV Bayreuth
Bei der Waldbesitzervereinigung ist es ein Thema, wenn auch nicht im großen Umfang. Geschäftsführer Gerhard Potzel berichtet von einem seltenen stattlichen Eichenstamm im Wert von rund 1000 Euro, der im Landkreis Bayreuth außerhalb einer Ortschaft auf wundersamer Weise verschwunden war. Anwohner hätten den Holz-Lkw noch gesehen, aber niemand habe sich etwas dabei gedacht. Das habe schon seine Richtigkeit, hätten sich alle gedacht. Das Kennzeichen hatte sich keiner gemerkt. Die Eiche sei noch „im Ganzen“ gewesen, zehn Meter lang, 70 Zentimeter stark und richtig schwer, deshalb habe sie der Käufer nicht gleich abtransportiert, sondern eine Weile liegen gelassen. Er habe in der Geschäftsstelle den Anruf vom „echten“ Fahrer bekommen, dass der Stamm nicht zu finden sei, dann sei man der Sache nachgegangen und habe tatsächlich noch den Abdruck des Stammes auf dem Waldboden feststellen können. Auch die hinzugezogene Polizei habe trotz umfangreicher Befragung der Anwohner in der Nähe da nichts mehr machen können.
Das sei aber auch schon der einzige größere Vorfall gewesen. Alles andere habe sich stets aufgeklärt und als Missverständnis erwiesen. So könne es schon mal vorkommen, dass ein Lkw-Fahrer den falschen Stoß auflädt. Holzdiebstahl in kleinerem Fall, in Wäldern, die weniger begangen werden und die von der WBV betreut werden, komme schon mal vor. Oft denken sich die Menschen, da kümmert sich sowieso keiner drum und sie würden dann ein meist dürres Bäumchen für Brennholz absägen. Um das zu verhindern, hat die WBV mittlerweile Warnschilder angebracht mit der Aufschrift: „Holzdiebstahl ist strafbar“.
„Das schreckt zumindest ab“, sagt Gerhard Potzel. Andere Möglichkeiten gebe es kaum. Kameras dürften aus Datenschutzgründen nicht aufgestellt werden. Wildkameras dürfe nur der Jäger aufstellen und das nur in begründeten Fällen. „Kameras wären natürlich die Abschreckung schlechthin“, so der WBV-Geschäftsführer aus Bayreuth.
Kleinstrukturierte Wälder seien ohnehin übersichtlicher. „Da sind immer Nachbarn da, deshalb werde es sich der eine oder andere dann schon überlegen.“ Anders ist es im Frankenwald mit unübersichtlichen, großen und dichten Wäldern. Dort falle es weniger auf, wenn einer mit Holz fährt.
Christian Dormann, 1. Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Hollfeld
Zum Glück hören wir bisher in unserem Vereinsgebiet von sehr wenigen solchen Fällen sagt Christian Dormann, 1. Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Hollfeld. Die Mitglieder dieses Zusammenschlusses kommen aus den drei Landkreisen Bamberg, Bayreuth und Kulmbach. Zum Geschäftsgebiet gehören die Städte Hollfeld und Waischenfeld, die Märkte Kasendorf, Thurnau und Wonsees sowie die zahlreichen Gemeinden in den drei Landkreisen. „Nichtsdestotrotz ist Holzdiebstahl natürlich grundsätzlich auch bei uns ein Thema“, so Christian Dormann. Er selbst habe aber in letzter Zeit von keinen derartigen Vorfällen gehört.
Carmen Hombach, Revierleiterin, 1. Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung Kulmbach-Stadtsteinach
Carmen Hombach, die 1. Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung Kulmbach-Stadtsteinach kennt niemanden, bei dem in letzter Zeit Holz gestohlen wurde. Auch im Revier habe es „zum Glück“ noch keinen Diebstahl gegeben. „Unsere Brennholz-Selbstwerber nehmen ihr fertig aufgearbeitetes Holz immer gleich mit und teilen mir die Menge mit, wenn alles fertig ist“, so Carmen Hombach. Das funktioniere auch ganz gut: „Da bleibt nichts Verlockendes im Wald liegen.“
Christoph Kraus, Pressestelle Polizeipräsidium Oberfranken
Einen signifikanten Trend oder steigende Fallzahlen in Sachen Holzdiebstahl kann auch die Polizei nicht feststellen. Im Gegenteil, so Christoph Kraus von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken. Seinen Worten zufolge stagniere das Fallaufkommen derzeit sogar. Gleichwohl sei Holzdiebstahl ein Thema, und zwar „mit leichten Schwerpunkten“ in den Bereichen Bamberg Land, Kronach und Stadtsteinach. Dabei gebe es sowohl kleinere als auch größere Fälle, also Abtransport per Lkw. An der Tagesordnung sei dies aber nicht. Holzdiebstahl habe es schon immer gegeben, dabei handle es sich keinesfalls um ein neues Phänomen. Möglichkeiten, um den Tätern habhaft zu werden, gebe es schon. Christoph Kraus sprach von GPS-Trackern oder gewissen Markierungen, die man einsetzen könne. Dies sei freilich mit Kosten verbunden, dafür aber wesentlich genauer. Damit könne man feststellen, wo sich das Holz gerade befindet, oder, wo es hin transportiert wird. Nicht ganz so einfach sei der Einsatz von Kameras, wenn man auf der rechtlich sicheren Seite sein will. Hier müsse man abwägen, zwischen Randbereichen mit nur privater oder mit öffentlicher Nutzung.
Erntedank im Hangar / Oberfränkische Landjugend feierte drei Tage lang auf dem Gelände des Airports
Hof.
„Flying Harvest Party“, „Muck“-Turnier,
Gottesdienst, Erntekronen- und Volkstanz-Wettbewerb:
der oberfränkische Landjugendtag hat am Wochenende
viele tausend Besucher auf das Flugplatzgelände
gelockt. „Wir vertreten den ländlichen Raum und
haben überall unsere Finger im Spiel“, begrüßten
augenzwinkernd die beiden Bezirksvorsitzenden Chiara
Hartmann und Ferdinand Bauer sowie der Vorsitzende
des ausrichtenden Kreisverbandes Hof-Wunsiedel Lukas
Schmidt die Gäste.
Im
Mittelpunkt stand dabei auch eine Woche nach dem
kalendarischen Erntedankfest der Dank. Schließlich
war der Landjugendtag zugleich das
Kreiserntedankfest des Hofer Bauernverbandes. „Danke
zu sagen, das ist heute nicht mehr
selbstverständlich, sagte die katholische
Gemeindereferentin Mechthild Fröh am Sonntag beim
ökumenischen Gottesdienst, mit der das fest in einer
der Hallen des Airports eröffnet wurde.
Manchmal geht einem das Wort Danke gar nicht so leicht über die Lippen, so der evangelische Hofer Pfarrer Stefan Fischer. Für Diskussionen sorgte seine Aussage: „Wir sind ein Volk der Lamentierer“. Gottes reicher Segen sei nicht nur in der Ernte zu erfahren, es gebe viele Gründe, dankbar zu sein. Doch, so der Pfarrer in seiner Predigt weiter: „Äußerer Wohlstand kann nichts auslösen gegen innere Leere“.
Ganz
so schlecht sei die Ernte gar nicht gewesen, so der
Hofer Kreisobmann Ralph Browa. Im Gegenteil: Einem
trockenen Frühjahr habe eine Regenperiode gefolgt,
so dass die Bauern mit relativ guten Erträgen rechne
konnten. Während der Juni wieder trockener war, sei
im Juli dann Regen gefallen und rechtzeitig zur
Haupterntezeit im August habe es eine Trockenphase
gegeben, so dass die Ernte gut eingebracht werden
konnte. „Also alles ganz normal“, so der
Kreisobmann.
Besser
könnten freilich die Preise sein, doch auch hier
seien Milchpreis, Schlachtvieh. und Kälberpreise im
Gegensatz zu den schwankenden Schweinepreisen in
Ordnung. Was allerdings völlig fehlt, sei die
Wertschätzung von Seiten der Politik. „Wir Bauern
brauchen endlich verlässliche Rahmenbedingungen“, so
Ralph Browa.
Schirmherr des oberfränkischen Landjugendtages war Landrat Oliver Bär. Er würdigte die Landjugend als eine Organisation, die sich in herausragender Art und Weise für das Gemeinwohl einsetzt. „Auf die Landjugend kann man sich verlassen, vielen Dank, dass es euch gibt“, sagte er. Auch die oberfränkische Bezirksbäuerin Beate Opel rückte noch einmal den Dank in den Mittelpunkt. Jeder Tag sei es wert, danke zu sagen. An die Mitglieder der Landjugend gerichtet sagte sie: „Ihr seid die Zukunft, denn ihr bringt Visionen und Ideenreichtum mit“.
Sechs
Gruppen hatten sich am Erntekronen-Wettbewerb
beteiligt: Die Gruppen aus Zedtwitz, Weidesgrün,
Plösen, Schwarzenbach an der Saale, Reuthlas und
Großlosnitz. Sie alle hatten in jeweils mehrere
hundert Stunden Arbeit mit viel Hingabe die
dekorativen Kronen hergestellt und damit ein altes
Traditionshandwerk aufrechterhalten. Erntekronen
gelten als Symbol dafür, dass die Bauern eng mit der
Natur verbunden sind, erläuterte Bezirksbäuerin
Beate Opel. Sechs Landjugendgruppen waren es auch,
die sich beim Volkstanzwettbewerb dem Publikum
stellten: Die Gruppen aus Schreez, Stockau,
Görschnitz, Fechheim, Cottenbach und Zedtwitz.
Beim
Landjugendtag wurde Helmut Lottes für seine
35-jährige Tätigkeit als Leiter des Hofer
Landfrauenchors ausgezeichnet. Die oberfränkische
Bezirksbäuerin Beate Opel überreichte ihm die
entsprechende Urkunde. Von Kreisbäuerin Elke Browa
und Kreisobmann Ralph Browa gab es einen großen
Präsentkorb.
Bereits am Freitagabend gand ein großes „Muck“-Turnier statt. Dabei handelt es sich um ein Kartenspiel, ähnlich wie Schafkopf, das fest zur fränkischen Wirtshaustradition gehört. Bei der „Flying Harvest Party“ mit der Partyband „Highline“ stellten alle Beteiligten dann am Samstagabend eindrucksvoll unter Beweis, dass Landjugend auch feiern kann,
Bilder:
1. Die
katholische Gemeindereferentin Mechthild Fröh und
der evangelische Pfarrer Stefan Fischer feierten den
ökumenischen Gottesdienst.
2. Kreisbäuerin
Elke Browa und Kreisobmann Ralph Browa (von links)
sowie Beate Opel zeichneten Chorleiter Helmut Lottes
für sein langjähriges Wirken aus.
3. Sinnbild
für Erntedank: Kürbisse in allen Variationen.
4. Viele
hundert Stunden Arbeit braucht es, bis eine solche
Erntekrone präsentiert werden kann.
5. Mit
einem Informationsstand war das Amt für
Landwirtschaft beim Landjugend vertreten. Im Bild
von links: der stellvertretende Behördenleiter Uwe
Lucas und seine Mitarbeiterinnen Andrea Eckl und
Doreen Stopfer.
6. Über
mangelnden Besuch konnten sich die Verantwortlichen
nicht beklagen: zum Volkstanzwettbewerb gab es nur
noch Stehplätze.
7. Die Landjugend Schreez aus dem Landkreis Bayreuth
machte beim Volkstanzwettbewerb den Auftakt.
Anerkennung und Wertschätzung statt Selbstverständlichkeit / Erntedank am Autohof: Wunsiedler Kreisverband feierte Schlepper-Gottesdienst
Thiersheim.
Motorradgottesdienste gibt es inzwischen viele. Ein
Schleppergottesdienst dagegen ist schon etwas
besonderes, noch dazu an Erntedank. Der Wunsiedler
BBV-Kreisverband machte es möglich. Dem konnten
selbst ein Regenschauer und einstellige Temperaturen
nichts anhaben. Besser hätte man Kirche und
Landwirtschaft nicht verbinden können. "Kirche und
Landwirtschaft war schon immer eine Einheit, denn
ohne Gottes Segen ist es schlecht um uns bestellt",
so Kreisobmann Harald Fischer.
Viele Landwirte fühlten sich an die Bauernproteste im Winter 2023/2024 erinnert. Auch damals hatten sich die Bauern am Thiersheimer Autohof getroffen. Diesmal allerdings war am Ende des riesigen Parkplatzes der Sattelauflieger eines Lkw zum perfekt geschmückten Erntedankaltar umfunktioniert worden. Sogar der Wunsiedler Posaunenchor und der Landfrauenchor fanden darauf Platz.
„Das
ist eben der normale Fichtelgebirgsherbst“,
kommentierte der Thiersheimer Bürgermeister Werner
Frohmader vor dem Hintergrund des schlechten Wetters
die widrigen Umstände. Für die Thiersheimer nichts
Besonderes, denn schon zu Corona-Zeiten hatte man
auf dem Parkplatz des Autohofes Gottesdienste
gefeiert.
Jetzt sei es Zeit, danke zu sagen, so Harald Fischer. Die Ernte sei eingefahren, nicht immer die beste, aber auch nicht die schlechteste. Der Haken dabei: gute Preise seien meist Fehlanzeige gewesen. Als Ursache dafür nannte der Kreisobmann die Tatsache, dass die Landwirtschaft zum Spielball der verschiedensten Kräfte geworden sei, „auf die wir Bauern keinen Einfluss haben“.
Die
Bedeutung des Erntedankfestes machte Dekan Peter
Bauer an der Tatsache fest, dass Dank,
Wertschätzung, Anerkennung unserer Gesellschaft
nicht selten abhandengekommen seien. Der Dekan
kannte sich in der Landwirtschaft gut aus: Während
die meisten Menschen heute nach Sicherheit und
Planbarkeit strebten seien genau diese Dinge bei den
Bauern Fehlanzeige. I der Landwirtschaft seiern
unberechenbare Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten,
unsichere Erträge und Umstände und unkalkulierbare
Preise an der Tagesordnung.
Möglicherweise hätten die Bauern in der „guten alten Zeit“ mehr Achtung erfahren, sagte der Geistliche. Heute würden sie oft zum Bittsteller degradiert. Da sei schon etwas verlorengegangen, wenn die wunderschöne Landschaft und hochwertige Nahrungsmittel als selbstverständlich vorausgesetzt würden. Seine Predigt schloss der Dekan mit den Worten: „Ich wünsche Ihnen allen, dass sie stolz sein können, auf das, was sie tun.“
Für
Karin Reichel lag der Wert des Festes auch in seiner
Ursprünglichkeit: „Das Erntedankfest selbst ist noch
nicht dem Kommerz verfallen, wie Ostern oder
Weihnachten. Das Erntedankfest ist einfach noch
ursprünglich." Eine ganz besondere Geste hatten sich
die Verantwortlichen ausgedacht. Da wurde der Segen
nicht nur ausgesprochen, alle Besucher des
Gottesdienstes konnten ihn auf einen kleinen Wimpel
gedruckt mit Nach Hause nehmen. Der Text stammte aus
dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6: „Wer da
sät im Segen, wird auch ernten im Segen.“
Bilder:
1. „Gott
sei Dank“: Mit diesem Plakat hatte ein Landwirt
seinen Schlepper geschmückt.
2. Dekan
Peter Bauer predigte vom Sattelauflieger eines Lkw,
der kurzerhand zu einem reichlich geschmückten
Erntedankaltar umfunktioniert wurde.
3. Dekanatskantor
Reinhold Schelter leitete zum Erntedankgottesdienst
den Posaunenchor.
4. Wo
vor knapp zwei Jahren die Bauernproteste
stattgefunden hatten, versammelte sich jetzt die
gemeinde zum Erntedankgottesdienst.
5. Dekan
Peter Bauer, Kreisobmann Harald Fischer und der
katholische Gemeindereferent Ulrich Frey freuten
sich über den gelungenen Open-Air-Gottesdienst.
Mehr Respekt für den Wald / Waldtag der WVB Bamberg- Zahlreiche Besucher trotz schlechten Wetters
Oberhaid.
Respekt einzufordern, vor und für den Wald, das war
das Motto des Waldtages in Oberhaid, den die
Waldbesitzervereinigung Bamberg veranstaltet hatte.
Monatelang hatten die Verantwortlichen das
Großereignis vorbereitet. Zahlreiche
Aussteller rund um die Themen Forst, Holz und Wald
hatten ihre Stände auf dem Sportgelände des 1. FC
Oberhaid aufgebaut, und dann spielte das Wetter
nicht mit.
Zumindest nicht ganz, denn aus dem strichweisen Regen zu Beginn wurde mehr und mehr ein ungemütlicher Dauerregen. Zahlreiche Besucher ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Sie honorierten die Bemühungen der WBV und ihrer Partner und informierten sich trotzdem, wenn auch in wetterfester Kleidung und mit Regenschirmen in der Hand. Und dann war auch noch ein kleines Zelt aufgebaut, indem sich die Besucher mit den Forstleuten austauschen konnten.
Sogar
die bayerische Waldkönigin Patricia Vogl war eigens
aus Tiefenbach im Landkreis Cham angereist. Holz sei
doch einfach ein wunderbarer Rohstoff, rührte sie
die Werbetrommel für die rund 700.000 Waldbesitzer
in Bayern. Sie alle stünden vor großen
Herausforderungen, so Bernhard Breitsamer, der
Präsident des bayerischen Waldbesitzerverbandes.
Zwei Aussagen hatte er mit nach Oberhaid gebracht. Zum einen sprach er sich klar gegen immer wieder diskutierte Waldstilllegungen aus. Ein stillgelegter Wald könne niemals die Ziele des Klimaschutzes erfüllen und nicht für Artenvielfalt sorgen. Außerdem zeige das Waldmonitoring regelmäßig, dass hierzulande der Wald mehr wird, nicht weniger. „Die Holznutzung ist auch Teil des Waldumbaus“, so der Präsident. Zum anderen legte er einmal mehr ein klares Bekenntnis zum immer wieder von verschiedenen Gruppierungen in Frage gestellten Bekenntnis „Wald vor Wild“ ab. Nur in gesunden Wäldern könne es einen gesunden Wildbestand geben, so Bernhard Breitsamer.
„Wald
ist supercool“, sagte die Vorsitzende der WBV
Bamberg, Angelika Morgenroth. Sie kritisierte, dass
sich allzu viele Außenstehende bemüßigt fühlten, den
Waldbesitzern vorzuschreiben, wie sie mit
Waldeigentum anderer umgehen sollen. Sie forderte
deshalb mehr Respekt für den Wald, denn der sei
nicht nur ein toller Rohstoff, er sichere
Arbeitsplätze, leiste einen Beitrag zum Klimaschutz,
sondern sei auch ein wertvolles Kulturgut.
Interessante Zahlen hatte der stellvertretende Bamberger Landrat Johannes Maciejonczyk mitgebracht. 40 Prozent der Landkreisfläche sind seinen Worten zufolge bewaldet, das seien exakt 457 Quadratkilometer Wald. Allein aus diesen Zahlen könne man die große Bedeutung des Themas erkennen, so Johannes Maciejonczyk.
Bilder:
1. Der
Bürgermeister von Oberhaid Carsten Joneitis,
WBV-Vorsitzende Angelika Morgenroth, die bayerische
Waldkönigin Patricia Vogl und der Präsident des
Bayerischen Waldbesitzerverbandes Bernhard
Breitsamer (von links) haben den Waldtag eröffnet.
2. Zahlreiche
Aussteller rund um die Themen Forst, Holz und Wald
hatten beim Waldtag der WBV Bamberg ihre Stände auf
dem Sportgelände des 1. FC Oberhaid aufgebaut.
3. Trotz
des schlechten Wetters war der Infostand der
Bayerischen Staatsforsten mit einem interessanten
Quiz dicht umlagert.
4. Führende
Fachfirmen informierten beim Waldtag über die
neuesten Entwicklungen auf dem Forstgerätesektor.
Ziegler Insolvenz machte Waldbauern zu schaffen / „Es hätte schlimmer kommen können“: Waldbesitzervereinigung Hollfeld schließt mit sechsstelligem Jahresfehlbetrag
Hochstahl.
Die Insolvenz der Ziegler-Gruppe hat bei der
Waldbesitzervereinigung Hollfeld Spuren
hinterlassen. Obwohl ein Großteil der Ausfälle durch
Versicherungen abgedeckt war, muss der forstliche
Zusammenschluss das Geschäftsjahr 2024 mit einem
Fehlbetrag von rund 200.000 Euro beschließen. „Ohne
Ziegler-Insolvenz hätten wir ein Jahresergebnis von
cirka 100.000 Euro im Plus erzielt“, sagte der
Vorsitzende Christian Dormann bei der
Jahresversammlung in Hochstahl.
Trotz allem konnte Dormann Entwarnung geben: „Keinem Mitglied ist durch die Insolvenz ein Verlust entstanden“, sagte er. Bereits im März konnten die letzten offenen Posten beglichen werden, teilweise sogar mit einem kleinen Ausgleich, weil es länger gedauert habe. „Jeder hat sein Geld bekommen“, so der Vorsitzende.
Dazu muss man wissen, dass die offenen Forderungen von WBV-Mitgliedern bei der Ziegler-Gruppe zum Zeitpunkt der Insolvenz bei rund einer Million Euro lagen. Bei den Waldbauern hatte das für gehörige Aufregung gesorgt. Christian Dormann sprach von einer „Katastrophe“. Abzüglich einer Bürgschaft, der enthaltenen Umsatzsteuer vom Finanzamt und vor allem der Erstattung durch die Versicherungen habe dieser Betrag auf rund 209.000 Euro netto gemindert werden können. „Es hätte schlimmer ausgehen können“, sagte Christian Dormann. Man habe einen Batzen Geld verloren, die WBV sei aber keinesfalls in Schieflage geraten.
Die Ziegler Forstservice GmbH (ZFS), die 48 Einzelfirmen unter ihrem Dach vereinte und ihren Sitz im oberpfälzischen Plößberg) Landkreis Tirschenreuth) hatte, musste am 28. November 2024 überraschend einen Insolvenzantrag stellen. Das größte Sägewerk Europas und Flaggschiff der bayerischen und deutschen Holzindustrie galt in den zurückliegenden Jahren als größter und langjähriger Kunde und Partner der WBV Hollfeld. Mittlerweile hat der Holzkonzern „Rettenmeier Holding AG“ mit Hauptsitz im mittelfränkischen Wilburgstetten das Sägewerk und weitere wesentliche Teile der Holzverarbeitungs-Sparte der insolventen Ziegler-Gruppe übernommen.
Trotz der Ziegler-Insolvenz lief der Geschäftsbetrieb bei der Waldbesitzervereinigung Hollfeld weiter. Nach den Worten von Geschäftsführerin Stefanie Blumers lag die vermarktete Holzmenge mit 96.766 Festmetern knapp unter der 100.000er Marke. Im Jahr zuvor lag die Menge noch knapp darüber. Über 95 Prozent davon ist Fichtenholz, ein kleiner Anteil Kiefernholz. Die Laubholzmenge bezeichnete die Geschäftsführerin als „verschwindend gering“.
Obwohl der Holzpreis derzeit relativ konstant ist, geht Stefanie Blumers davon aus, dass auch im laufenden Jahr ein Rückgang der vermarkteten Holzmenge verzeichnet werden muss. Trotzdem tut sich im Wald etwas. Das zeigt allein die stattliche Anzahl von über 55.000 Pflanzen die in Form von Sammelbestellungen über die WBV geordert wurden. Daneben sei auch wieder der Geräte- und Maschinenverleih, vor allem die Rückewägen, von den Mitgliedern rege in Anspruch genommen worden. Allein 19 Informationsveranstaltungen wurden 2024 durchgeführt, etwa zu Themen wie Wegeinstantsetzung oder Wegepflege und künftig würden auch wieder Motorsägekurse angeboten.
Die Mitglieder der Waldbesitzervereinigung Hollfeld kommen aus den drei Landkreisen Bamberg, Bayreuth und Kulmbach. Zum Geschäftsgebiet gehören die Städte Hollfeld und Waischenfeld, die Märkte Kasendorf, Thurnau und Wonsees sowie die zahlreichen Gemeinden in den drei Landkreisen. Ihre Geschäftsstelle hat die WBV in Hollfeld.
Bild: Trotz Ziegler-Insolvenz: „Bei uns hat jeder sein Geld bis auf den letzten Cent bekommen“: Christian Dormann, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Hollfeld.
Gemischte Bilanz. Von Rekordernte bis zum Totalausfall / Kreiserntedankfest in Oberdornlach: Dank sagen für die Geschenke der Schöpfung
Oberdornlach.
Erntedank, das ist nicht etwa ein beliebiger Termin
im Jahreslauf. Erntedank ist ein ganz besonderes
Fest. Nicht nur für die Bauern, sondern auch für die
Bevölkerung. Beim Kulmbacher Kreiserntedank am
Sonntag in Oberdornlach konnte sich Bauernverband
und Dorfgemeinschaft jedenfalls nicht über
mangelnden Zuspruch beklagen.
Schon beim Erntedankgottesdienst am morgen in der Dreschhalle reichten die Bänke bei weitem nicht aus, so dass viele Besucher den Gottesdienst vor der Scheune verfolgen mussten. Am Nachmittag fanden dann viele hundert Neugierige den Weg zum Festplatz am Ortsende. Dort gab es jede Menge Vorführungen mit landwirtschaftlichem Gerät, da wurden Kartoffeln gegraben, es gab eine Volkstanzaufführung und Informationsstände unter anderem von der Bayernland-Käserei und den Milchwerken Oberfranken-West. Die Landfrauen boten Milchshakes zur Verkostung an, das Amt für Landwirtschaft informierte unter anderem über seine forstlichen Aktivitäten, gleich an zwei Ständen gab es Kunstwerke aus Holz und auch ein Imker war mit seinen Produkten vor Ort.
„Wir
pflügen und wir streuen“: Das war nicht nur der
Titel eines der Lieder, das beim Gottesdienst
gesungen wurde, das war gleichsam das Motto, unter
das der Kulmbacher Dekan Friedrich Hohenberger und
Gemeindediakon Holger Goller den
Erntedankgottesdienst gestellt hatten. In der
Predigt des Dekans ging es unter anderem darum, dass
die Botschaft Jesu alle Menschen durch das Leben
tragen soll. Auch an sorgenvollen Tagen, denn die
werde es immer wieder geben, so Friedrich
Hohenberger. Landwirte wüssten das nur zu gut. Auch
sie erinnerte er daran, dass es der Segen Gottes
sei, der dafür sorge, dass die Dinge wachsen.
Von einer komplett unterschiedlichen Ernte, selbst innerhalb des Landkreises, berichtete Kreisobmann Harald Peetz. „Von der Rekordernte bis zum Totalverlust war bei uns alles dabei“, so der Kreisobmann. Er erinnerte die Bevölkerung daran, dass es hierzulande Lebensmittel in höchster Qualität und unter den größten Umweltauflagen gibt, produziert von den Bauern vor Ort.
Ein
wenig politisch wurde Harald Peetz dann doch, wenn e
feststellte, dass die jetzige Bundesregierung
durchaus wisse, was sie an den Landwirten hat. „Ganz
im Gegensatz zu der von grüner Ideologie geprägten
Vorgängerregierung“, so der Kreisobmann. So zeigte
er sich dankbar, dass die Entwaldungsverordnung
ausgesetzt und die Roten Gebiete nahezu komplett,
die Gelben gebiete sogar komplett aufgehoben worden
seien. Beides hätte den Landwirten noch strengere
Umweltauflagen abverlangt.
Schirmherr des Kreiserntedankfestes war der oberfränkische Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Alles sei ein Geschenk der Schöpfung, sagte er und knüpfte damit nahtlos an die Worte der beiden Geistlichen an. Die Preise könnten besser sein, aber im Großen und Ganzen sei es kein schlechtes Jahr für die Landwirtschaft gewesen.
Eigentlich
sei alles gut, so die mittelfränkische
Bezirksbäuerin und stellvertretende bayerische
Landesbäuerin Christine Reitelshöfer. Die
Produktpalette sei bei Nahrungsmitteln viel größer
geworden, die Regale seien voll, die Auswahl groß
und die Qualität bestens. Trotzdem werde das Thema
Essen immer mehr zur Religion erklärt, frei nach dem
Motto: „Sage mir, was du isst, und ich sage dir, wer
du bist.“ Für Christine Reitelshöfer eine
Fehlentwicklung. Die Landfrauen machten sich deshalb
für eine ausgewogene, gesunde Ernährung und für
Regionalität stark. Weniger Fleisch, dagegen sei
nichts einzuwenden. Aber den Menschen
vorzuschreiben, was sie essen dürfen und was nicht,
das könne nicht angehen. Zum Glück hätten diese
Diskussionen seit Amtsantritt der neuen
Bundesregierung aber auch schon wieder nachgelassen.
An die Landwirte appellierte die stellvertretende
Landesbäuerin vor dem Hintergrund so manch negativer
Entwicklung, nicht in Resignation zu verfallen,
sondern immer auch die Chancen zu erkennen.
Ihre
besten Wünsche für den Bauernstand überbrachten beim
Kreiserntedank auch der Landtagsabgeordnete Rainer
Ludwig und Landrat Klaus Peter Söllner. Die Bauern
seien die Säule der Ernährungswirtschaft, sagte
Rainer Ludwig. Vor dem Hintergrund des
tiefgreifenden Strukturwandels dürfe man es nicht
zulassen, dass eine gesamte Branche kaputtgeredet
und diskriminiert werde. Klaus Peter Söllner
bedankte sich besonders bei der Dornlacher
Dorfgemeinschaft und ihrem Motor Heinz Schmidt, dass
es einmal mehr gelungen sei, eine derartige
Großveranstaltung auf die beine zu stellen.
Bilder:
1. „Der
Segen Gottes macht es, dass die Dinge wachsen“:
Dekan Friedrich Hohenberger hielt die
Erntedankpredigt in Oberdornlach.
2. Der
Kulmbacher Landfrauenchor umrahmte den Gottesdienst
zum Kreiserntedank in der Dreschhalle.
3. Für
eine ausgewogene Ernährung und gegen
Essensvorschriften: Die stellvertretende bayerische
Landesbäuerin Christine Reitelshöfer aus
Mittelfranken.
4. Dekan
Friedrich Hohenberger, die deutsche
Destillatprinzessin Denise Meyer,
Bezirkstagspräsident Henry Schramm, Kreisbäuerin
Beate Opel, die stellvertretende Landesbäuerin
Christine Reitelshöfer, Kreisobmann Harald Peetz,
die stellvertretende Kreisbäuerin Gudrun Passing,
Landrat Klaus Peter Söllner und der
Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig.
5. Altes
Handwerk, neu entdeckt: Daniela Haumann (vorne) und
ihre Kollegin führten vor, wie Wolle versponnen
wird.
6. Am
hinteren Ortsende hatten Bauernverband und
Oberdornlacher Dorfgemeinschaft das Festgelände
aufgebaut.
Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit der Bauern / Publikumsmagnet Landwirtschaft: Mehrere tausend Besucher beim Erntedank auf dem Fischlhof
Heroldsreuth.
Ein besseres Ambiente hätte man kaum finden können:
bereits zum zweiten Mal gab es den Pegnitzer Tag der
Landwirtschaft direkt vor Ort auf dem Fischlhof in
dem zu Pegnitz gehörenden Weiler Heroldsreuth. Dort
feierten die Interessensgemeinschaft und der
Bauernverband das Erntedankfest mit
Bauernmarktmeile, buntem Programm und zahlreichen
Erlebnissen für Groß und Klein.
Den Besuchern hat es gefallen. Geschätzt mehrere tausend waren im Laufe des Tages nach Heroldsreuth auf den Fischlhof, einem biologisch ausgerichteten Nebenerwerbsbetrieb mit Direktvermarktung, gekommen. Weil Heroldsreuth aus genau zwei landwirtschaftlichen Betrieben besteht, machte auch der benachbarte Hof von Renate und Hermann Lehner mit. Anders als vor zwei Jahren blieb der Stall aufgrund er aktuellen Seuchensituation diesmal aber zu.
Tag
der Landwirtschaft, das bedeutete auch zahlreiche
Aktivitäten rund um den Bauernhof. Fast 50
Informations- und Verkaufsstände,
Maschinenvorführungen, aber auch traditionelle
Handwerkskunst und viele Angebote extra für Kinder.
Da gab es einen Tretschlepperparcours und ein
Maislabyrinth, die Bayernland-Käserei Bayreuth und
die Molkerei Bechtel präsentierte ihre Produkte
anhand von Kostproben, die Landfrauen zeigten, was
sie alles so machen. Imker Toni Herzing aus
Büchenbach weckte die Begeisterung für heimischen
Honig und Heurechenmacher Konrad Berner aus
Pottenstein führte alte Handwerkskunst vor.
Dazu
gab es alles, was die Genussregion zu bieten hat:
Pulled Beef Burger vom Biohof Brunner aus Kemnath,
Eier von den Gebhardtshofer Weidehennen aus
Weidenberg und Bauernhof-Eis von der Hofliebe
Eis-Manufaktur aus Münchberg. Das Landwirtschaftsamt
Bayreuth-Münchberg zeigte, wie man heimisches „Superfood“
selbst herstellen kann: Leinsamen statt Chiasamen,
Hafer statt Quinoa, Walnüsse statt Avocado. Ob
Honig, Eier, Nudeln, Mehl, Müsli oder frisches Brot
und vieles mehr – die Vielfalt und Qualität der
regionalen Erzeugnisse war groß und unterstrich die
Bedeutung lokaler Landwirtschaft.
„Ohne
die Bauern wäre nichts auf dem Tisch“, so Tanja
Strobl, die den Fischlhof zusammen mit Ehemann
Markus und der Familie bewirtschaftet. Ziel der
Großveranstaltung sei es Landwirtschaft zu
vermitteln und die Wertschätzung dafür in den
Vordergrund zu stellen, so die Vorsitzende der
Interessensgemeinschaft und frühere Kreisbäuerin
Katrin Lang
Eröffnet wurde der Tag der Landwirtschaft mit einem ökumenischen Erntedankgottesdienst, den der evangelische Pfarrer Daniel Lunk aus Pegnitz und die katholische Pastoralreferentin Katharina Lurz in der Maschinenhalle feierten. Dort begrüßte Kreisobmann Karl Lappe später auch die Gäste. Ernährung sei das höchste Gut, auch wenn die Versorgung mit Lebensmitteln meist als selbstverständlich hingenommen werde, sagte er.
Bilder:
1. Ganz besonders liebevoll geschmückt wurde der
Erntedankaltar zum Tag der Landwirtschaft.
2. Wie kommt der Honig ins Glas? Bio-Imker Toni
Herzing aus Büchenbach sorgte beim Tag der
Landwirtschaft für Aufklärung.
3. Für die musikalische Umrahmung des Tages der
Landwirtschaft in Heroldsreuth sorgte der Bayreuther
Landfrauenchor.
4. Erntedank an authentischem Ort: Der Gottesdienst
fand in der Maschinenhalle des Fischlhofes statt.
5. Auf ihren Schultern lag die wesentliche Arbeit
zum Tag der Landwirtschaft Tanja Strobl (links) und
die frühere Bayreuther Kreisbäuerin Katrin Lang.
6. Großer Andrang herrschte in dem kleinen Weiler
Heroldsreuth bei Pegnitz zum Tag der Landwirtschaft.
7. Untrügliches Zeichen für den Herbst: es gibt
wieder Kürbisse.
Karpfensaison: Gute Ernte trotz vieler Fischräuber / Biber, Otter, Kormoran und Reiher treiben auch im Kulmbacher Land ihr Unwesen
Waldau.
Mit dem September startet nicht nur der Herbst,
sondern für Fischgenießer die schönste Zeit des
Jahres: die Karpfensaison. Ob halbiert und gebacken
oder blau oder filetiert und grätengeschnitten,
Karpfen ist in Bayern weit mehr als ein saisonales
Gericht: Er ist gelebte Kultur.
Von einer guten Karpfenernte geht Edwin Hartmann aus. Der 69-jährige bewirtschaftet vier Teiche im Neudrossenfelder Ortsteil Waldau mit einer Gesamtwasserfläche von einem Hektar, die jeder Autofahrer kennt, der auf der A70 kurz nach der Auffahrt Kulmbach/Neudrossenfeld in Richtung Bayreuth unterwegs ist. Seine Karpfen vermarktet er praktisch ausschließlich über die für ihre Fischspezialitäten weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannte und bereits mehrfach ausgezeichnete Gaststätte Fuchs direkt in der Nachbarschaft. Noch kürzere Transportwege sind kaum denkbar.
Das Abfischen steht bei ihm erst Anfang Oktober an. Obwohl es klimabedingt und vor allem aufgrund von Fischotter, Biber, Kormoran, Silber- und Graureiher erhebliche Verluste gegebene habe, rechne er mit einem guten Ergebnis. Dies sei der Tatsache geschuldet, dass er im zurückliegenden Jahr nicht abgefischt habe. Da habe es wenig Satzfische gegeben. Nun aber gehe er davon aus, acht bis zehn Zentner Fisch aus den Teichen zu holen. Das müssten so um die 250 Schlachtkarpfen sein, rechnet Edwin Hartmann vor, wobei er von einem Durchschnittsgewicht von 1,3 Kilogramm ausgeht.
Hauptproblem für den Teichwirt ist der niedrigere Wasserspiegel, der auch an seinen Teichen mittlerweile deutlich messbar ist. An einem seiner Teiche musste er sogar einen Wasserstand von 40 Zentimetern unter Normal feststellen. Neben klimabedingtem Wassermangel macht er dafür hauptsächlich den Biber und den Bisam verantwortlich, die durch ihre Grabungstätigkeiten den Wasserspiegel zum Senken bringen. „Es gibt einfach zu viel von diesen Schädlingen“, sagt er. Notabfischungen wegen des Wassermangels, wie andernorts teilweise bereits durchgeführt, seien bei ihm zwar noch nicht notwendig gewesen, doch die Situation sei durchaus kritisch. Durch Abschuss und Fallenfang habe man bereits mehrere Biber und Bisams entnehmen können, doch es rückten immer mehr Tiere nach.
Dazu
kommt, dass auch die Grau- und
Silberreiherpopulation immer stärker zunehme. Edwin
Hartmann rechnet mit noch stärkeren Schäden, da der
Silberreiher absolut geschützt sei und nicht
geschossen werden dürfe. Ganz im Gegensatz zum
Kormoran, der zwar bejagt wird, der aber noch immer
in großer Anzahl zu beobachten sei. „An den
Teichanlagen waren teilweise Kormoran-Schwärme von
bis zu 30 Tieren zu beobachten“, so Edwin Hartmann.
Nicht zuletzt sei auch die Situation beim Fischotter nach wie vor unbefriedigend. Der Otter gilt als größter Fischräuber überhaupt. Einmal habe er bereits eine Entschädigung in Höhe von 70 Prozent des Schadens bekommen, doch damit sei es bei weitem nicht getan. Aus dem Teichgebiet rund um das oberpfälzische Tirschenreuth sei bereits von Verlustquoten von bis zu 90 Prozent berichtet worden.
Mit Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde darf der Biber laut Edwin Hartmann von 1. September bis zum 15. März bejagt werden. Graureiher seien vom 16. September bis zum 31. Oktober zum Abschuss freigegeben. Kormorane dürften in der Nähe von Teichanlagen vom 16. August bis zum 14. März erlegt werden. „Von der Jägerschaft würde ich mir wünschen, dass in der kurzen Zeit, in der die Bejagung von Fischräubern und Teichschädlingen erlaubt ist, auch konzentriert dagegen vorgegangen werden darf“, so Edwin Hartmann.
Die Karpfenteichwirtschaft hat in Bayern eine viele Jahrhunderte andauernde Tradition. Viele Familienbetriebe pflegten ihre Teiche seit vielen Generationen hinweg. Nicht umsonst sei die traditionelle Karpfenteichwirtschaft 2021 in das Bayerische Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden, heißt es von Seiten des Bayrischen Landwirtschaftsministeriums. Wer Karpfen kauft, entscheide sich für ein hochwertiges regionales Lebensmittel
Nach
den Zahlen des Ministeriums gibt es im Freistaat
rund 8000 Familienbetriebe, die eine extensive und
naturnahe Teichwirtschaft betreiben und die damit
für regionale Nahrungsmittel sorgen. Mit rund 20000
Hektar Teichfläche sei Bayern Deutschlands größtes
Karpfenerzeugerland. Mit rund 14100 Teichen auf etwa
2700 Hektar Wasserfläche ist Oberfranken die Nummer
drei unter den bayerischen Teichwirtschaftsregionen.
Oberfranken trägt regelmäßig rund 15 Prozent zur
gesamten bayerischen Karpfenproduktion bei, in guten
Jahren bis zu 1000 Tonnen.
Bayernweit biete sich allerdings ein gemischtes Bild in Sachen Ernteerwartungen: Obwohl die konstant milden Temperaturen dieses Jahr ein sehr gutes Wachstumspotenzial geboten hätten, würde die Ernte auch in diesem Jahr vergleichsweise gering bleiben. Die Teichwirte erwarten lediglich eine Menge zwischen 4000 und 4500 Tonnen.
Bilder:
1. Bedingt durch Biber und Bisamschäden liegt der
Wasserspiegel an einem der Teiche von Edwin Hartmann
bei 40 Zentimetern unter Normal.
2. So sieht er aus: der fangfrische Karpfgen aus
oberfränkischen Gewässern.
3. Selbst die Sträucher rund um die Teiche bleiben
nicht von Biberschäden verschont.
Erntedank auf dem Fischlhof / Tag der Landwirtschaft: Großveranstaltung im kleinen Heroldsreuth
Heroldsreuth.
Der Tag der Landwirtschaft in dem zu Pegnitz
gehörenden kleinen Weiler Heroldsreuth ist kein
gewöhnliches Erntedankfest. Zum einen wird er von
einer vor vielen Jahren eigens gegründeten
Interessensgemeinschaft veranstaltet, zum anderen
findet er nur alle zwei Jahre statt. Termin ist
diesmal Sonntag, 21. September, auf den
landwirtschaftlichen Betrieben der Familien Strobl
und Lehner in Heroldsreuth.
Auch das ist eine Besonderheit: Wurde der Tag der Landwirtschaft früher auf dem Pegnitzer Markplatz oder in der Christian-Sammet-Sporthalle gefeiert, so wird er diesmal schon zum zweiten Mal in Folge wieder direkt auf dem Bauernhof abgehalten. „Die Leute finden das gut, beim letzten Mal im Jahr 2023 hatten wir weit über 3000 Besucher, teils von weit her“, sagt Tanja Strobl, die den Fischlhof zusammen mit Ehemann Markus und der Familie bewirtschaftet. Die beiden Höfe, der Fischlhof der Familie Strobl und der benachbarte Betrieb der Familie Lehner, seien wie geschaffen für das Fest. Der Besucherstrom könne sich ideal verteilen, Parkplätze stünden auf den umliegenden Flächen ausreichend zur Verfügung.
Ziel der Großveranstaltung ist es, die Landwirtschaft ins richtige Licht zu rücken und die wertvolle Arbeit der Bauern positiv darzustellen. „Wir wollen Landwirtschaft vermitteln und die Wertschätzung dafür in den Vordergrund rücken“, sagt Katrin Lang, frühere Bayreuther Kreisbäuerin und Vorsitzende der „Interessensgemeinschaft Tag der Landwirtschaft Pegnitz“.
Eröffnet wird die Veranstaltung um 11 Uhr mit der Begrüßung durch die stellvertretende Kreisbäuerin Doris Schmidt, anschließend laden die beiden Pegnitzer Kirchen zu einem ökumenischen Erntedankgottesdienst in der Maschinenhalle ein. Gegen 13 Uhr werden Kreisobmann Karl Lappe, Katrin Lang und Tanja Strobl die Gäste begrüßen.
Bis mindestens 17 Uhr ist dann auf den beiden Höfen einiges geboten. An über 40 Ständen können sich die Besucher informieren, Praktikern über die Schulter blicken oder das reichhaltige Sortiment der Genussregion probieren. Da kommen der Rechenmacher Konrad Berner, Vertreter der Schäferei Burggraf, der Gebhardtshofer Weidehennen. Landtechnikunternehmen zeigen, wie moderne Melktechnik funktioniert. Die Bayernland-Käserei Bayreuth und de Privatmolkerei Bechtel stellen ihr Sortiment vor, für Kinder gibt es einen Tretschlepper-Parcours, wobei die Schlepper später sogar verlost werden.
Die Jägervereinigung zeigt, wie die Kitzrettung per Drohne funktioniert, der Maschinenring Bayreuth-Pegnitz führt einen Klauenpflegestand vor und Imker Anton Herzing zeigt, wo der Honig herkommt und was man alles damit machen kann. Mit Infoständen werden unter anderem der Bauernverband, das Amt für Landwirtschaft und die Forstbetriebsgemeinschaft Pegnitz vertreten sein. Dazu gibt es Burger, Steaks, Bratwürste, Kaffee und Kuchen Bauernhofeis und alles, was die heimische Landwirtschaft zu bieten hat. “Ohne die Bauern wäre nichts auf dem Tisch“, das ist die Botschaft, die Tanja Strobl allen Besuchern beim Tag der Landwirtschaft mit auf dem Weg geben möchte.
Die Planungen für den Tag der Landwirtschaft laufen bereits seit März, sagt Katrin Lang. Sie gibt zu Bedenken, dass es ja nur ein ganz kleiner verein ist, der die Großveranstaltung in Eigenregie stemmt. Die im Zwei-Jahres-Turnus stattfindende Veranstaltung musste während der Corona-Zeit ersatzlos gestrichen werden. Die Pause hatten die Verantwortlichen damals zum Anlass genommen, den Tag der Landwirtschaft komplett neu aufzustellen.
Der Fischlhof der Familie Strobl ist ein biologisch ausgerichteter Nebenerwerbsbetrieb mit Direktvermarktung. Vor allem die Vermarktung von Eiern und den entsprechenden Produkten von Nudeln bis zum Eierlikör ist einer der wichtigste Betriebszweige. Die Familie beliefert Bioläden, Cafés und Bäckereien in der Umgebung.
Info: Der Tag der Landwirtschaft findet am Sonntag, 21. September von 11 bis 17 Uhr in Heroldsreuth 1, 91257 Pegnitz statt. Die Zufahrt ist von Pegnitz kommend nach Horlach über Nemschenreuth in Richtung Weidlwang und dann links ab nach Heroldsreuth.
Bild: Die frühere Kreisbäuerin und Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Katrin Lang, Kreisbäuerin Angelika Seyferth und Tanja Strobl (von links) vom Fischlhof haben in Heroldsreuth die letzten Vorbereitungen zum Tag der Landwirtschaft getroffen.
Aus Autowerkstatt wird Dienstleistungszentrale / Kulmbacher Maschinenring bezieht neue Räume am Goldenen Feld – Einweihung am 7. September mit Tag der offenen Tür
Kulmbach.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach e.V.
zieht um. Ab 7. September ist die bäuerliche
Selbsthilfeorganisation in den neuen Räumen in der
Von-Linde-Straße 13 zu finden. Mit dabei auch das
gewerbliche Tochterunternehmen, die Maschinenring
Oberfranken Mitte GmbH.
„Die Konrad-Adenauer-Straße 4 ist damit Geschichte“, sagt der Vorsitzende Andreas Textores. Oberstes Ziel sei es, das Dienstleistungsangebot des Maschinenrings zu verbessern. Dazu biete die frühere Autowerkstatt Müller in der Von-Linde-Straße optimale Möglichkeiten. Waren Maschinen, Gerätschaften und Material bisher auf Betriebe im gesamten Landkreis verteilt, wird künftig alleszentral in Kulmbach zu finden sein.
Auch bürotechnisch bietet der neue Standort zahlreiche Vorteile. So gibt es beispielsweise Parkplätze in ausreichender Zahl, sanitäre Einrichtungen und Aufenthaltsräume. Auch Landwirte, die mit schwerem Gerät und Anhängern anfahren, können problemlos parken und wenden, was in der Konrad-Adenauer-Straße bislang unmöglich war.
Die neue Liegenschaft des Maschinenrings Kulmbach inmitten des Gewerbegebietes am Goldenen Feld ist rund 2000 Quadratmeter groß. Die Halle hat eine Ausdehnung von zwölf mal zwölf Meter, die Bürofläche beträgt rund 120 Quadratmeter. Eigentümer ist die MR Oberfranken Mitte (OMI). In der GmbH hat der Kulmbacher Ring zusammenmit den Nachbarringen Bayreuth und Fränkische Schweiz seine gewerblichen Aktivitäten gebündelt. Dazu gehören beispielsweise die Klauenpflege mit zwei eigenen Ständen, der Winterdienst, Baumschnitt, Grünflächenpflege, die biologische Maiszünslerbekämpfung mit Schlupfwespen oder die Unkrautbekämpfung mit Heißwasserthermie.
Letzter
Tag in der bisherigen Geschäftsstelle wird der 29.
August sein. „Wir haben die Werkstatt mit viel
Eigenleistung zum Büro umgebaut“, sagt
Geschäftsführer Alexander Hollweg. Ein
entscheidender Vorteil sei es auch, dass die neuen
Büroräume komplett ebenerdig angelegt sind.
Für den Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach ist es mittlerweile der vierte Umzug in seiner 63-jährigen Geschichte. In der Konrad-Adenauer-Straße war der Ring rund 15 Jahre lang zuhause. Der Maschinenring Oberfranken Mitte mit seinen drei Standorten Bayreuth, Fränkische Schweiz (Aufseß) und Kulmbach hat insgesamt rund 30 Beschäftigte.
Trotz der neuen Räumlichkeiten wird vorerst ein altes Problem bestehen bleiben: die angespannte Personalsituation. Es werde immer schwieriger, die Betriebshilfe zu organisieren und sicherzustellen“, so Vorsitzender Andreas Textores. Ein Phänomen sei es, dass die Einsätze zwar nicht weniger werden, aber dafür immer länger dauerten. Zuletzt waren die Einsatzstunden in der sozialen Betriebshilfe sogar angestiegen. Soziale Betriebshilfe wird immer dann notwendig, wenn beispielsweise ein Landwirt erkrankt, einen Unfall hat, zu einer Reha-Maßnahme oder zur Kur muss. Daneben gibt es noch die wirtschaftliche Betriebshilfe zur Abdeckung von Arbeitsspitzen.
Die offizielle Einweihung der neuen Geschäftsstelle findet am Sonntag, 7. September von 11 bis 17 Uhr mit einem tag der offenen Tür statt. Bei Bratwürsten und Steaks sowie Kaffee und Kuchen wollen die Verantwortlichen allen Interessierten die neuen Räumlichkeiten vorstellen.
Bilder:
1. Geschäftsführer
Alexander Hollweg (links) und Vorsitzender Andreas
Textores freuen sich über den gelungenen Umbau der
ehemaligen Autowerkstatt zum künftigen Refugium des
Maschinenrings.
2. Mehr
Platz und mehr Komfort bietet die neue
Geschäftsstelle des Maschinenrings an der
Von-Linde-Straße 13 im Gewerbegebiet Goldenes Feld.
Trockenheit und Temperaturextreme fordern Tribut / Insgesamt unterdurchschnittliche Ernte erwartet - Bauernverband beobachtet große regionale Unterschiede
Kulmbach.
Für die anstehende Ernte erwartet der Bauernverband
eine regional stark schwankende Ernte mit insgesamt
unterdurchschnittlichen Erträgen.
„Ich erwarte für Weizen, Triticale, Roggen keine Spitzenerträge“, sagt Harald Köppel, BBV-Geschäftsführer für Bayreuth, Kulmbach und Kronach. „Höchsterträge und Höchstqualitäten werden wir heuer mit Sicherheit nicht bekommen.“ Ob es zum Brauen für Bier ausreicht oder beim Weizen und Roggen zum Backen, wird man sehen. Insgesamt sei die Situation eher schwierig. Der Regen der zurückliegenden Wochen helfe dem Getreide jedenfalls nicht mehr. Ganz im Gegensatz übrigens zum Grünland, zum Mais oder zu Kartoffeln.
Bislang sei in größerem Stil nur Wintergerste gedroschen worden. Dabei habe man feststellen müssen, dass es den Ähren an Körnern fehlt und die vorhandenen Körner kleiner ausgefallen seien. „Ursache dafür ist ganz klar zu wenig Wasser zum Zeitpunkt der Körnerbildung. “, so Harald Köppel.
Das Wintergetreide habe sich im vergangenen Herbst gut entwickelt, sei auch gut über den Winter gekommen, hatte auch keine Frostschäden, doch dann sei zum falschen Zeitpunkt das Wasser weggeblieben. Man habe gerade jetzt auch viel Ganzpflanzensilage gemacht, weil eben auch auf den Wiesen weniger wächst, und da seien die Körner ebenfalls kleiner gewesen. Bei der Triticale beispielsweise habe man suchen müssen, um das Korn zu finden.
Nun gelte es erst einmal, das Getreide heimzubringen. Denn wenn es reif ist und zu oft nass wird, könnten Pilze reinkommen. Im schlimmsten Fall wachse das Getreide aus, was bedeutet, dass das Korn an der Pflanze keimt. Auch dann könnten Pilze in das offene Korn gelangen und es könnte im schlimmsten Fall nicht einmal mehr verfüttert werden.
Regional sei Oberfranken traditionell in drei Erntezonen geteilt: Jura, Mittelland und Oberland. Der Jura sei immer so als erstes dran, dann folge das mittlere Teilstück und zuletzt das Oberland. „Wenn es in den kommenden Tagen schön wird, dann rollen die Drescher“, sagt Harald Köppel und wünscht sich für die kommenden zehn Tage trockenes und warmes Wetter.
Auf die Ernte blicken die Landwirte eher mit gemischten Erwartungen. „Dort, wo es geregnet hat, wird es eine gute Ernte werden, dort wo es eher weniger Regen gab, wird es schwierig“ sagt Hans Pezold, Vorsitzender des oberfränkischen Braugerstenvereins mit Sitz in Kulmbach. Die Ernte werde nicht überall gut sein. Es gebe schon Gebiete mit ausreichender Wasserversorgung im Frühjahr oder auch während der Vegetation. Die Regenverteilung sei sehr kleinräumig gewesen. Grundsätzlich stehe die Braugerste aktuell nicht schlecht, aber regional doch sehr heterogen. Für die kommenden Wochen wünscht sich Hans Pezold eine nicht zu warme, trockene Abreife: „Keine Hitze, wie vor kurzem, eher so 25 Grad und trocken.“
„Nach einem nassen Jahr 2024 war 2025 erneut ein extremes Trockenjahr für den Ackerbau. Immerhin: Das regenreiche Vorjahr hatte die Bodenvorräte gut aufgefüllt, Winterkulturen konnten dadurch mit soliden Startvoraussetzungen ins Frühjahr gehen“, so Hermann Greif, oberfränkischer BBV-Bezirkspräsident. Doch die wenigen Niederschläge im Frühsommer hätten nicht ausgereicht, um den Wasserbedarf in den entscheidenden Entwicklungsphasen zu decken.
Besonders auf leichten Standorten habe der Weizen gelitten: Die Bestockung sei gering geblieben und auch während der Kornfüllung habe das Wasser gefehlt. Die anhaltende Hitze Ende Juni habe die Abreife deutlich beschleunigt. „Wir gehen daher von einer regional je nach Bodenqualität und Niederschlagssituation sehr heterogenen, aber insgesamt unterdurchschnittlichen Ernte 2025 aus“, so Hermann Greif.
„Das Anbaujahr 2025 ist wieder einmal von extremem Wetter geprägt“, so BBV-Präsident Günther Felßner. Ein kühles Frühjahr, gefolgt von wiederholten Trockenphasen und hohen Temperaturen Anfang Juli, hätten die Bestockung gehemmt und zu einer vorzeitigen Abreife geführt. Die Erträge zeigten sich stark heterogen und würden maßgeblich von lokalen Niederschlägen sowie der Wasserhaltefähigkeit der Böden abhängen.
Bild: Jetzt rollen sie wieder: Die kommenden Wochen stehen für die Landwirte ganz im Zeichen der Ernte.
Sinkender Bierabsatz, steigende Anbaufläche / Oberfränkische Braugerstenverein zog gemischte Bilanz
Kulmbach.
Nach Jahren des Rückgangs ist die Anbaufläche für
Braugerste in Oberfranken heuer erstmals wieder
angestiegen. Das haben die Verantwortlichen bei der
Braugerstenrundfahrt vor wenigen Tagen bekannt
gegeben. Waren es im zurückliegenden Jahr noch gut
17700 Hektar, so wird heuer auf fast 19500 Hektar
Braugerste im Regierungsbezirk angebaut.
Auf die Ernte blicken die Landwirte eher mit gemischten Erwartungen. „Dort, wo es geregnet hat, wird es eine gute Ernte werden, dort wo es eher weniger Regen gab, wird es schwierig“ sagte Hans Pezold, Vorsitzender des oberfränkischen Braugerstenvereins, der seinen Sitz in Kulmbach hat. Die Ernte werde nicht überall gut sein. Es gebe schon Gebiete mit ausreichender Wasserversorgung im Frühjahr oder auch während der Vegetation. Die Regenverteilung sei sehr kleinräumig gewesen. Grundsätzlich stehe die Braugerste aktuell nicht schlecht, aber regional doch sehr heterogen. Für die kommenden Wochen wünscht sich Hans Pezold eine nicht zu warme, trockene Abreife: „Keine Hitze, wie vor kurzem, eher so 25 Grad und trocken.“
Den Anstieg der Anbaufläche begründete der Vorsitzende mit „ganz guten Preisen im Herbst“, die schon gelockt hätten, wieder anzubauen. Momentan trete aber fast schon ein Bumerangeffekt auf, für Ware, die nicht unter Vertrag ist. Letztes Jahr sei die Ernte gut gewesen, nun stehe wahrscheinlich eine relativ gute Ernte draußen, in der Folge würden die Preise für nicht unter Vertrag stehende Ware wegbrechen.
Allgemein werde zu wenig Bier getrunken und letztlich auch zu wenig Malz exportiert, sagte Hans Pezold. Die Brauer stöhnten, dass sie ihr Bier nicht wegbringen, auch der Absatz alkoholfreier Biere könne den Rückgang leider noch nicht ausgleichen. Dazu komme, dass die Malzproduktion immer sehr energieträchtig sei und die Kosten hierzulande sehr hoch sind. Dadurch sei die deutsche Produktion am Weltmarkt nicht mehr so konkurrenzfähig, wie früher. Deshalb sei der Malzexport rückläufig.
Nach den Zahlen des Braugerstenvereins ist Hof der Landkreis mit der mit Abstand größten Braugerstenanbaufläche. Im Landkreis Hof wird auf gast 5900 Hektar (Vorjahr 5400 Hektar) Braugerste angebaut. Auf Platz 2 unter den Landkreisen liegt Kulmbach mit ziemlich genau 3000 Hektar (Vorjahr 2700 Hektar), gefolgt von Wunsiedel mit 2600 Hektar (Vorjahr 2400 Hektar). Am wenigsten Braugerste gibt es in den Landkreisen Kronach (700 Hektar) und Coburg (450 Hektar). Auch bayernweit ist die Anbaufläche gestiegen: Waren es im vergangenen Jahr noch 76500 Hektar, so steht heuer auf knapp 83000 Hektar Braugerste.
Der Braugerstenanbau sei mittlerweile leider ein sehr kurzfristiges und schnelllebiges Geschäft. Große Hoffnungen setzen die Landwirte auf den Anbau von Wintergerste als Alternative, die allen helfen könne, weil man damit gewisse Qualitätskriterien einfach ausgleichen und das Risiko etwas streuen könne.
Die Rundfahrt, die der Oberfränkische Braugerstenverein regelmäßig zusammen mit dem Amt für Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg und dem Erzeugerring für pflanzliche Qualitätsprodukte durchführt, machte heuer in den Landkreisen Kulmbach und Lichtenfels Station. Dabei wurden ein Demonstrationsversuch des Erzeugerrings in Lopp bei Kasendorf ein Praxisschlag in Neudorf, ebenfalls Gemeinde Kasendorf, und ein Landessortenversuch in Wolfsdorf bei Bad Staffelstein besichtigt.
Bild: Bei der oberfränkischen Braugerstenrundfahrt nahmen die Fachleute die Bestände, hier auf einem Feld bei Bad Staffelstein im Landkreis Lichtenfels, genau unter die Lupe.
Vom Feld in die Kaffeetasse / Lupine macht Landwirte zu Kaffeebauern - LfL-Feldtag in Altenkunstadt
Altenkunstadt.
Aus deutschen Landwirten Kaffee-Farmer zu machen, so
weit möchte Rainer Langguth nicht gehen. Von einer
„tollen Kaffeealternative“ spricht er trotzdem, wenn
es um Kaffee aus Lupinen geht. Rainer Langguth ist
Gründer der Fortezza Espressomanufaktur in Fürth.
Seine Rohstoffe bezieht er unter anderem vom
landwirtschaftlichen Betrieb von Norbert Konrad in
Altenkunstadt, Landkreis Lichtenfels. Dort fand auch
der Lupinen-Feldtag der Landesanstalt für
Landwirtschaft (LfL) statt. „Unser Ziel ist es unter
anderem, alternative Nutzungsmöglichkeiten dieser
etwas in Vergessenheit geratenen heimischen
Eiweißpflanze aufzuzeigen“, so Julian Meinecke vom
Regionalmanagement des Leguminosen-Netzwerks LeguNet
Bayern an der LfL.
Rainer Langguth ist seit über 25 Jahren in der Kaffeewelt aktiv. Mit der Begeisterung für italienischen Espresso habe alles angefangen, erinnert er sich. Irgendwann habe er dann mit Lupinen experimentiert, doch das sei zunächst gar nicht angekommen. „Wir wurden belächelt“, so Fortezza-Geschäftsführerin Melanie Schmidtmeier. Eigentlich habe man das Lupinen-Projekt schon wieder einstampfen wollen, doch das Interesse daran sei schließlich stärker gewesen. „Ganz einfach, weil die Lupinen-Alternative dem Kaffeegeschmack ganz nahekommt.“
Statt Kaffeesorten aus fernen Ländern könne man doch auch deutsche Landwirte einbinden, hatten sich beide gedacht. Kurze Lieferwege, kein Abholzen des Regenwaldes und mehr Geld für die Bauern, die Lupinen bislang fast ausschließlich in der Schweinefütterung verwendet hatten. Ganz auf Arabica und Robusta, die beiden dominierenden herkömmlichen Kaffeesorten hierzulande, muss niemand verzichten. Unter der Marke Heide-Original bieten Rainer Langguth und Melanie Schmidtmeier nicht nur 100 Prozent Lupinenkaffee-Genuss an, mit der Marke Heide Mythos gibt es auch eine Mischung aus zwei Dritteln Lupinenkaffee und einem Drittel brasilianischem Bio-Kaffee.
Die
Rohstoffe dazu kommen unter anderem aus Oberfranken.
Die Familie Konrad betreibt am Ortsrand von
Altenkunstadt einen Nebenerwerbsbetrieb mit dem
Schwerpunkt Direktvermarktung. „Wir haben
hauptsächlich Kartoffeln, Feldgemüse, Eier von zwei
Hühnermobilen und Honig von mehreren Völkern im
Angebot“, erläutert Junior Johann Konrad.
Mittlerweile habe man auch den Kaffee der Fortezza
Espressomanufaktur mit den Lupinen aus eigenem Anbau
im Angebot. Über die Landesanstalt für
Landwirtschaft sei man auf die Lupine gekommen,
mittlerweile sei die Eiweißpflanze fester
Bestandteil in der Fruchtfolge.
Wenn die Lupine in den zurückliegenden 30 Jahren keiner Rolle mehr gespielt hat, dann habe dies an der Pilzkrankheit Anthraknose gelegen. Dadurch sei der Anbau praktisch zum Erliegen gekommen, so Julian Meinecke vom LeguNet Bayern. Durch verstärkte Züchtungserfolge und Forschungsinitiativen sei dies mittlerweile wieder Geschichte.
Lange als Tierfutter verwertet, finde die Lupine als heimische Eiweißressource wieder zunehmend Platz in der Humanernährung, nicht zuletzt für das steigende Bewusstsein für alternative Ernährungsformen. Nun ist es allerdings nicht so, dass die wunderschönen Blüten der Lupinen aus Vorgärten oder Straßenrändern zum Essen und Trinken geeignet wären. Beim Feldtag ging es im Wesentlichen Um die weiße Lupinensorten Selina und Frieda, die auch auf den Feldern bei Altenkunstadt wachsen. Sie wurden im März ausgesät (60 Körner pro Quadratmeter), ging bereits im Mai in die Blüte und kann voraussichtlich Anfang August gedroschen werden. Die Lupine reagiere sehr sensibel, benötige leichte Böden und liebe die Wärme, sagt Johann Konrad.
Überhaupt
seien die weißen Lupinen gut an unser Klima
angepasst, so Manuel Deyerler von den
Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf. Sie
mögen die Wärme, seien aber auch gegenüber kühlen
Temperaturen relativ tolerant. Lupinen passten in
die meisten Fruchtfolgen und brächten Stickstoff ins
System. Er empfahl den Landwirten eine Aussaat „so
früh wie möglich aber auch so spät wie nötig“.
Übrigens wird Lupinenkaffee genauso zubereitet, wie „normaler Kaffee“: zum Beispiel mit der Filtermaschine, einer Stempel- oder Mokkakanne, dem Handfilter, einer Siebträgermaschine und sogar per Vollautomat. Alternativ kann man das Mahlgut auch mit kochendem Wasser überbrühen, ziehen lassen und den Satz auf dem Tassenboden absetzen lassen.
Bilder:
1. Johann Konrad
erläutert, worauf es beim Lupinen-Anbau ankommt.
2. Melanie Schmidtmeier und Rainer Langguth haben
nicht lockergelassen, bis sie die Lupine als echte
Kaffeealternative etablieren konnten.
3. Hier
am Ortsrand von Altenkunstadt im Landkreis
Lichtenfels baut die Familie Konrad die Lupinen an,
aus denen später Kaffee gemacht wird.
Wirtschaften auf und unter dem Baum / Ortstermin mit Umweltminister Glauber auf dem Birkenhof – Gelder aus dem Streuobstpakt fließen in das Kulmbacher Land
Birkenhof.
Die größte zusammenhängende Streuobstwiese
Oberfrankens liegt im Landkreis Kulmbach. Sie ist
rund 15 Hektar groß, auf ihr wachsen rund 650
verschiedene Obstbäume. Bewirtschaftet wird die
Fläche um den Birkenhof im Gemeindegebiet von
Wirsberg von Linda und Lukas Kießling. Bisons und
Angusrindern beweiden die Flächen. Weil die
Streuobstwiese ein echtes Vorzeigeprojekt weit über
Oberfranken hinaus ist, hat der bayerische
Umweltminister Thorsten Glauber jetzt dem Birkenhof
einen Besuch abgestattet. Der Minister kam dabei
nicht mit leeren Händen. Aus dem Streuobstpakt
Bayern wird die Anlage mit knapp 100000 Euro für die
Jahre 2023 bis 2025 gefördert.
Beim bayerischen Streuobstpakt handelt es sich um ein verbindliches Abkommen zwischen der Staatsregierung und mehreren Umwelt-, Naturschutz-, Landwirtschafts-, Gartenbau- und Landschaftspflegeverbänden. Ziel ist es, neben dem Erhalt des bereits stark dezimierten Streuobstbestands bis 2035 eine Million zusätzliche Streuobstbäume in Bayern zu pflanzen.
Aufgrund der fränkischen Realteilung und den daraus resultierenden relativ kleinen landwirtschaftlichen Flächen sei die Idee des Wirtschaftens auf dem Baum und unter dem Baum hier mustergültig umsetzbar, sagte Umweltminister Glauber. Die Obstbäume bildeten auch ein Stück weit die fränkische Kulturlandschaft ab, was am Standort Birkenhof nahe der Fränkischen Linie mit den Muschelkalk- und Keuperböden gar nicht so einfach sei. „Wir wollen das Streuobst wieder nach vorne bringen“, sagte der Minister. Seinen Worten zufolge seien dank des Streuobstpaktes bereits rund 100.000 Bäume in Bayern gesetzt worden. Ziel sei es bis 2035 eine Million zusätzlicher Obstbäume zu pflanzen.
Von einem echten Zukunftsprojekt sprach der bayerische Bauernverbandspräsident Günther Felßner. Der Streuobstpakt vereine alles das, was Landwirtschaft ausmacht: Ernährungsproduktion, Flächennutzung, Ressourcenschutz und Klimaschutz. Nicht Stilllegung, sondern Mehrfachnutzung sei das gebot der Stunde. „Der Birkenhof ist die beste Werbung für vorbildliche Tierhaltung“, so der BBV-Präsident. Landrat Klaus Peter Söllner sprach von einem herausragenden Projekt in einer paradiesischen Landschaft. Wirsbergs Bürgermeister Jochen Trier nannte den Birkenhof mit den riesigen Streuobstwiesen ein „Epizentrum des Obstbaus“.
Eigentlich
habe er ursprünglich Hecken pflanzen wollen, erklärt
Lukas Kießling. Streuobst habe aber besser in die
Landschaft gepasst, unter anderem weil die Bäume
später Schatten spenden werden und das Fallobst als
Futter Verwendung finden kann.
Linda und Lukas Kießling bewirtschaften rund 50 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche biologisch und im Nebenerwerb. Von den 50 Hektar sind 45 Hektar Grünland und fünf Hektar Ackerland. Das Paar setzt auf Direktvermarktung, geschlachtet wird in dem eigens errichteten EU-zertifizierten Schlachthaus auf dem Hof. Seit 2023 gibt es dort auch ein Hofcafé, das in den Sommermonaten immer an zwei Sonntagen im Monat geöffnet hat. Lukas ist gelernter Landschaftsgärtner, Linda medizinische Fachangestellte.
Hinter dem Bayerischen Streuobstpakt steckt die Idee, die Genuss- und Artenvielfalt in der Landschaft lebendig zu halten. Rund 5000 oft gefährdete Tier- und Pflanzenarten fänden auf bayerischen Streuobstwiesen ihr Zuhause. Dazu kämen etwa 2000 Obstsorten mit besonders intensivem Aroma, vor allem Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen und Walnüsse, aber auch Quitten und Wildobst. Die UNESCO hatte den Streuobstanbau in Deutschland als Immaterielles Kulturerbe aufgenommen.
Bilder:
1. Der
Bayerische Streuobstpakt macht es möglich: zwischen
Obstbäumen grast im Kulmbacher Land eine Bisonherde.
2. BBV-Präsident
Günther Felßner (links) erläuterte dem bayerischen
Umweltminister Thorsten Glauber (rechts) und Landrat
Klaus Peter Söllner die große Bedeutung der
Flächennutzung für den Klimaschutz.
„Lieber einmal hacken als dreimal gießen“ / Land- und Forstwirtschaft sowie Hobbygärtner klagen über Frühjahrstrockenheit
Kulmbach. Auch wenn in den zurückliegenden tagen ein paar Tropfen vom Himmel gefallen sind: nennenswert geregnet hat es seit Wochen nicht. Im Großen und Ganzen wird es wohl erst einmal so bleiben. Das könnte Landwirte und Hobbygärtner schon bald vor Probleme stellen.
Harald Köppel, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes (BBV)
„Ja, die Trockenheit ist aktuell schon ungewöhnlich“, sagt Harald Köppel, Geschäftsführer beim Bayerischen Bauernverband. „Es ist mit Sicherheit kein normales Jahr.“ Schon der März sei relativ mau gewesen, im April habe es gerade mal zwei Tage geregnet, der Mai sei bislang nicht viel besser gewesen, da bekämen manche Kulturen schon Probleme.
Im Kulmbacher Raum sei der Mais schon aufgegangen und komme mit dem bisschen Wasser noch einigermaßen zurecht. Aber das sei irgendwann auch mal vorbei, wenn es nicht regnet. Auch bei der Sommergerste könne man noch nichts sehen, aber auch das sei nur noch eine Frage der Zeit, bis man erste Schadensanzeichen erkennen kann.
Ein wenig Feuchtigkeit sei je nach Bodenart schon noch vorhanden. In sandigen Böden sei nicht mehr viel Feuchtigkeit da, in lehmigen Böden dagegen, sei das Wasser besser gespeichert. Die Tendenz aber sei schon so, dass es immer schwieriger mit der Wasserversorgung wird.
Was Harald Köppel jetzt wünscht, ist „entspannter Regen auf einige Tage verteilt“. „Starkregen können wir nicht gebrauchen“, sagt er. Dadurch, dass der Boden schon so hart sei, könne das Wasser nur langsam versickern und fließe stattdessen oberflächlich weg.
Natürlich hätten viele Landwirte schon Maßnahmen ergriffen. Bei der Sortenwahl werde nicht mehr nur auf Ertrag geschaut, sondern auch auf Trockenheitsresistenz. Von der Bearbeitung her sei es so, dass man in Richtung flachere Bodenbearbeitung geht und nicht mehr so tief wendet. Außerdem seien Zwischenfrüchte, die lang stehen bleiben, schon seit Jahren im Trend. Die Zwischenfrucht sei dazu da, den Boden zu beschatten, so dass wenig Feuchtigkeit ausdampfen kann.
Noch schlimmer sei die Lage im Bereich der Forstwirtschaft. „Die Katastrophe geht weiter“, sagte der BBV-Geschäftsführer. Der Borkenkäfer fliege schon wieder, die Fallen seien voll. Selbst in Frischholz, das außerhalb des Waldes gelagert wurde, habe sich der Borkenkäfer schon eingebohrt.
Anna Lena Ostermeier, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege
„In den letzten Jahren hatten wir immer mit ungewöhnlich starker Trockenheit bedingt durch den Klimawandel zu kämpfen“, so Anna Lena Ostermeier, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege. Niederschlagsreichere, also eigentlich „normale“ Jahre seien eher die Ausnahme geworden. Laut Klimaprognose des Bayerischen Landesamtes für Umwelt werde für unsere Region künftig eine zusätzliche Woche ohne Regen von April bis Juni erwartet. „Das ist die sogenannte Frühsommertrockenheit“, so Anna Lena Ostermeier.
Aktuell gebe es bei den Pflanzen noch keine Probleme, „da wir in den letzten Wochen doch einige Regentage hatten“. Man merke aber bei der Bodenbearbeitung im Garten ganz deutlich, dass der Boden in den oberen Schichten recht trocken ist. Hier könne eine Mulchschicht aus organischem Material, also aus Hackschnitzeln oder aus anorganischem Material, also Sand oder Kies helfen, um eine Austrocknung vorzubeugen. Auch die Gärtnerweisheit „lieber einmal hacken als dreimal gießen“ könne ganz praktisch umgesetzt werden. Anna Lena Ostermeier: „Am besten nach dem Wässern die Bodenoberfläche lockern, um so zu verhindern, dass das Wasser über die Oberfläche wieder verdunstet.“
Auf jeden Fall sollten Hobbygärtner sparsam mit Wasser umgehen: „Wir sollten immer sparsam mit unserem wertvollstem Gut umgehen“, so die Kreisfachberaterin. Grundsätzlich gelte: Regenwasser sammeln, um für trockene Zeiten vorzusorgen. Das Gießen mit Trinkwasser sollte unbedingt vermieden werden.
Jonas Gleich, Pressesprecher der Stadt Kulmbach
Keine Probleme mit der Trockenheit gibt es momentan in der Stadt Kulmbach: „Wir haben derzeit keine Probleme bei der Förderung beziehungsweise bei de Gewinnung von Trinkwasser für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger, sagt Pressesprecher Jonas Gleich. Die Trinkwasserversorgung steht seinen Worten zufolge auf zwei Beinen, dem Quellgebiet Perlenbachtal in Marktschorgast und den Tiefbrunnen im Weismaintal östlich von Kulmbach. Im Bereich der Trinkwassergewinnung im Quellgebiet bei Marktschorgast bewirtschafteten die Stadtwerke große Waldflächen. Dort seien seit Jahren die Auswirkungen des Klimawandels, also Trockenheit, höhere Temperaturen, Schädlingsbefall, festzustellen. Man habe sich deshalb auch bereits damit befasst, den Wald klimaresilient umzubauen. Ziel sei es, die positiven Auswirkungen des Waldbestands auf die Qualität des Trinkwassers zu sichern.
Neben den genannten Maßnahmen im Bereich Trinkwasserschutz sei die Stadt ständig bemüht, die Wasserversorgungsinfrastruktur zu erhalten, zu erneuern und an geeigneten Stellen auch zu verstärken. Ein weiteres Angebot sind nach den Worten des Pressesprechers öffentliche Trinkwasserbrunnen, wie am Marktplatz und am Holzmarkt, die an trockenen und heißen Tagen den Passanten eine kostenlose Erfrischung ermöglichen. Ein dritter, öffentlicher Trinkwasserbrunnen im Ruster Garten sei derzeit im Bau.
Während der letzten Jahre haben sich die Trockenperioden während der Sommermonate verlängert. Da auch häufig schon im Frühjahr das Regenwasser fehlt, sei es gerade für die Stadtbäume schwierig sich daran anzupassen. Deshalb müsse auch bei Neuanpflanzungen darauf geachtet werden die Baumarten nach Möglichkeit so auszuwählen, dass sie möglichst trockenheitsresistent sind oder zumindest an den jeweiligen Standort angepasst sind.
Jonas Gleich empfiehlt, zum Gießen privater Gärten nach Möglichkeit auf Regenwasser zurückzugreifen, das schone den Wasserhaushalt. Im Übrigen könne man auch beim Gießen Wasser sparen. Es sollte entweder morgens oder abends gegossen werden. Dann verdunste deutlich weniger Wasser als tagsüber.
Gabriele Merz, Leiterin Wasserwirtschaftsamt Hof
„Die Wintermonate waren im langjährigen Mittel zu trocken“, sagt Gabriele Merz, Leiterin des auch für Kulmbach zuständigen Wasserwirtschaftsamtes Hof. Der Niederschlags-, beziehungsweise Dürre-Index zeige für die vergangenen 90 Tage für nahezu das gesamte Amtsgebiet extreme Dürre an. Die Wasserführung sei in Bächen und Flüssen deutlich reduziert, die Pegel zeigten dort niedrige Abflussverhältnisse. Auch für die Quellen im kristallinen Grundgebirge ist ein Rückgang gegenüber der normalerweise um diese Jahreszeit vorherrschenden Schüttung erkennbar. Dies stelle eine ungünstige Ausgangssituation für den weiteren Jahresverlauf dar. In welche Richtung sich diese Ausgangsbasis weiterentwickelt, lasse sich jetzt noch nicht voraussehen und hänge von den Niederschlägen der nächsten Wochen ab.
Der obere Bodenhorizont ist nach den Worten von Gabriele Merz bis zu einer Tiefe von 25 Zentimetern durch die niederschlagsarme Witterung und den Wind sehr ausgetrocknet und dürr. Fast die Hälfte aller Grundwassermessstellen im Amtsbezirk Hof hätten niedrige Grundwasserstände. Die Lage sei dadurch schon bedenklich, jedoch sollte es zu keinen Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung kommen. „Allerdings ist im weiteren Jahresverlauf auch nicht vollständig auszuschließen, dass es zu Engpässen kommen könnte“, so die Behördenleiterin. Aufgrund leidvoller Erfahrung der vergangenen Trockenjahre hätten einzelne Wasserversorger bereits Vorsorge getroffen.
„Neben einem sparsamen Umgang mit unserem wertvollen Wasser sollten Maßnahmen schon im Voraus getroffen werden“, sagt Gabriele Merz. Dazu zähle beispielsweise möglichst wenig Flächen versiegeln, um damit die Versickerungsmöglichkeiten zu verbessern. Auch der Reduzierung von Leitungsverlusten, das Speichern von Niederschlagswasser im Verbund mit anderen Wasserversorgern für ein zweites Standbein seien wichtige Maßnahmen.
Generell sollte man auch bei der Bewässerung seines Gartens sparsam und bedacht mit Wasser umgehen, rät Gabriele Merz. Für die nachhaltige Nutzung von Regenwasser könnten Gartenbesitzer einfache Maßnahmen ergreifen: Regentonnen aufstellen oder Zisternen nutzen, nicht bei prallem Sonnenschein, sondern eher in den frühen Morgenstunden oder abends, wenn es schon kühler ist, gießen.
Schauversuche auf acht Hektar / Am 13. Juni findet der Pflanzenbautag in Lopp statt
Lopp.
Für die Landwirte im Kulmbacher Raum ist er ein
fester Termin: der Pflanzenbautag nahe der kleinen
Ortschaft Lopp bei Kasendorf. Er findet in diesem
Jahr am 13. Juni statt, die beiden Führungen
beginnen um 13 und um 19 Uhr. Veranstalter sind der
Erzeugerring für landwirtschaftlich pflanzliche
Qualitätsprodukte Oberfranken sowie die beiden Ämter
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Bayreuth-Münchberg und Coburg-Kulmbach.
„Der Grundgedanke ist es, die Landwirte im Kulmbacher Raum in Sachen Sortenwahl zu beraten“, sagt Dominik Schmitt, Pflanzenbauberater beim Erzeugerring, der in Danndorf den Naturlandhof Schmitt bewirtschaftet. Beim Pflanzenbautag in Lopp werden dazu zahlreiche Schauversuche erörtert, bei denen bis zu 60 verschiedene verschiedene Sorten, teilweise alte und bewährte, aber auch ganz neue, auf Parzellen nebeneinander angebaut wurden. Das Ganze finde unter praxisüblichen Bedingungen statt was Düngung, Pflanzenschutz oder Aussaatstärke angeht, so Dominik Schmitt.
Ziel sei es, herauszufinden, welche Sorte für welchen Standort, unter den dortigen klimatischen Bedingungen die Geeignetste ist. „Wir wollen den Bauern zeigen, was eine gute Sorte ausmacht“, so Fritz Asen vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach. Was die Saaten anbelangt, sei einiges geboten, so Dominik Schmitt. Pro Kultur gebe es zwischen fünf und zehn Sorten zu begutachten, so dass jeder Landwirt für sich einen individuellen Nutzen aus der Veranstaltung ziehen könne.
Welche Krankheiten treten bei welcher Sorte auf? Wie reagiert die Pflanze auf Fungizide? Was ist für die hiesigen Böden optimal? Wie reagieren die jeweiligen Sorten auf eine verminderte Düngung? Um diese und viele andere Fragen wird es beim Pflanzenbautag gehen.
Großes Problem in diesem Jahr ist nach den Worten von Fritz Asen der Ackerfuchsschwanz, eine Pflanzenart, die zu den Süßgräsern gehört. Der Acker-Fuchsschwanz gilt als sich rasch ausbreitendes Unkraut, das nur schwer bekämpft werden kann. Im Ackerbau entstünden durch den Ackerfuchsschwanz in der Regel erhebliche Ertragseinbußen, weil die Grasart gegenüber den meisten Herbiziden Multiresistenzen entwickelt hat. In Oberfranken sei derzeit eine Zunahme zu beobachten, so der Pflanzenbauexperte. Über die Ursachen sei man sich noch nicht ganz im Klaren. Insgesamt geht man davon aus, dass die Zunahme von Unkräutern mit den milden Wintern zusammenhängt. Für Fritz Asen steht jedenfalls fest: „Der Ackerfuchsschwanz macht alles nieder“.
Die acht Hektar große Fläche, auf der Hafer Raps, Weizen, Triticale, Sommer- und Wintergerste eigens für den Schauversuch angebaut wurde, gehört dem Landwirt Gerhard Friedlein aus Lopp. Er betreibt für die Veranstaltung schon seit vielen Jahren einen gewaltigen Aufwand. Das Saatgut wird in der Regel von der Industrie zur Verfügung gestellt.
Die Veranstalter rechnen mit Besuchern aus ganz Oberfranken. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Bild: Pflanzenbauberater Dominik Schmitt (rechts) und Fritz Asen vom Amt vom Landwirtschaftsamt erwarten zum Pflanzenbautag in Lopp am 13. Juni Landwirte aus ganz Oberfranken in der kleinen Ortschaft Lopp bei Kasendorf.
Mit Rauch gegen die Kälte / Pankratz, Servaz, Bonifaz: Gärtner und Landwirte fürchten sie noch immer
Kulmbach.
Ihre Namen jagen einem schon einen leichten Schauer
über den Rücken: Mamertus, Pankratius, Servatius,
Bonifatius und dann auch noch die „Kalte Sophie“.
Zusammen sind sie die Eisheiligen und sie treiben in
der Regel Mitte Mai ihr Unwesen. Viele Landwirte und
die meisten Hobbygärtner begegnen den Eisheiligen
mit großer Ehrfurcht. Doch haben sie wirklich noch
eine Bedeutung. Oder ist die Kälte der
zurückliegenden Tage schon auf die Eisheiligen
zurückzuführen?
Die Bauernregel besagt, dass man die Eisheiligen abwarten muss, bevor man den Garten oder Balkon frisch begrünt. Vor allem empfindliche Pflanzen und Kulturen können die Eisheiligen mit voller Wucht treffen. Vom 11. bis 15. Mai warnt die Bauernregel vor Spätfrost, danach sei alles sicher.
Wissenschaftlern zufolge sind die Eisheiligen kein magischer Zeitraum. Vielmehr sind Kälteeinbrüche zu dieser Jahreszeit nichts Ungewöhnliches. Kommt die Luftströmung aus dem Norden, kann es empfindlich kalt werden, die Luftströmung aus dem Süden bringt dagegen bereits warme Luft. Tatsächlich fühlt es sich derzeit recht kühl an, besonders tagsüber. Ein Blick auf das Thermometer zeigt, dass manche Nachttemperaturen in den zurückliegenden Tagen zumindest in ungünstigen Lagen durchaus denen der Eisheiligen entsprechen. Wer kälteempfindliche Pflanzen hat, sollte sie also vorsichtshalber noch einmal ins Warme holen oder gut abdecken.
„Offiziell sind es noch nicht die Eisheiligen, ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass es das schon war“, sagt Anna Lena Ostermeier, Kreisfachberaterin für Gartenbau und Landespflege am Landratsamt in Kulmbach und Geschäftsführerin des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege. Es könne schon sein, dass es in den kommenden Wochen noch einmal kälter wird. Das gefährliche seien die Nachtfröste und da komme es halt immer auch auf die Lage an.
Bei ihr zuhause seien die Balkonkästen tatsächlich noch leer. Besser sei es auf jeden Fall bis Mitte Mai zu warten, auch wenn in den Baumärkten die Regale schon gut gefüllt sind. „Ich würde auch jedem empfehlen, sich daran zu halten. Anna Lena Ostermeier: „Einfach noch Geduld haben, die Eisheiligen abwarten und nicht nervös werden, auch wenn alle anderen schon anfangen.“ Insgesamt sei das Phänomen Eisheilige schon noch relevant, da dürfe man sich nicht verunsichern lassen, auch wenn es sich an manchen Tagen schon so richtig warm anfühlt
Besonders anfällig sei alles, was aus dem Süden kommt, was man so an Gemüsepflanzen hat, zum Beispiel Tomaten, Auberginen, Paprika oder Gurken. Wenn man dagegen unbedingt den Balkon schon bepflanzen will, dann sollte man halt den Wetterbericht verfolgen und die Balkonkübel in Richtung Hauswand stellen oder mit Vlies abdecken, um die Kälte abzupuffern.
„Ich bin kein Wetterprophet“, sagt Friedrich Herold, der in Lindenberg bei Kasendorf rund fünf Hektar Obstanlagen mit Äpfeln, Birnen, Zwetschgen und Kirschen bewirtschaftet. Er rechnet aber schon noch mit Bodenfrösten in diesen Tagen. Null Grad gehe ja noch, da könne beim Obstbau relativ wenig passieren. Aber bei drei bis fünf Grad unter Null werde es dann schon kritisch. „Wenn wir fünf Grad minus bekommen, dann ist alles futsch“, so der Obstbauer.
Die
Eisheiligen seien auf jeden Fall noch immer ein
Thema, so Friedrich Herold. Frostschäden habe es
aber bei ihm dieses Jahr auch schon wegen der kalten
Ostluft Mitte April gegeben. Auch die Trockenheit
sei heuer ein Thema. Dabei sei die Frucht manchmal
noch empfindlicher als die Blüte.
Um die Kälte ein wenig abzuwehren, setzt Friedrich Herold auf das Räuchern. Dazu werde bei kalter Ostluft ein Feuer angezündet, der produzierte Rauch soll die Kälte von den Bäumen fernhalten, was bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut funktioniert. Für Friedrich Herold bedeutet das allerdings immer auch eine schlaflose Nacht, denn er muss ständig vor Ort sein. „Wir fangen meistens so zwischen 23 und 1 Uhr an und räuchern bis der Mond weg ist und es wieder hell wird.“ Kurz vor Eintritt der Helligkeit sei dabei der kritischste Punkt. Erfahrungsgemäß sackt das Thermometer dann noch einmal ab. Immer funktioniere das aber auch nicht: „Es ist nicht eine Nacht wie die andere.“ Aber zwei bis drei Grad könne man mit dem Rauch in der Regel schon ausgleichen. Manchmal bleibe der Rauch, manchmal sei er auch schnell weg. „Eigentlich sind alle Obstsorten anfällig“, sagt Friedrich Herold. Manche mehr, manche weniger.
Für die Eisheiligen sei es im Moment fast noch zu früh, so Harald Köppel Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes. Vor allem im Fichtelgebirge gebe es immer wieder mal Probleme mit Spätfrösten, im Kulmbacher Land seien die Spätfröste dagegen nicht so ausgeprägt. Je nach Lage seien allerdings Bodenfröste nicht auszuschließen. Gerade bei Hobbygärtnern genüge oft schon ein ganz leichter Frost, um den Pflanzen Schaden zuzufügen. Bei frisch aufgegangenem Getreide sei die Situation ungleich schlimmer. Es könne dann dauern, bis es sich wieder entwickelt, die Abreifung werde in jedem Fall verzögert.
Besonders anfällig ist nach den Worten von Harald Köppel der Mais, der in der Regel früher gesät wird, im Kulmbacher Raum oft schon Anfang April. Im schlimmsten Fall könne es zum Komplettausfall kommen. Bis weit in die 1980er Jahre hinein sei hierzulande noch ganz wenig Mais angebaut worden, weil er mit der Kälte nicht klargekommen ist. Erst mit dem Aufkommen neuer Sorten habe sich das geändert. Auch Sommergerste sei besonders betroffen. Sommergerste bleibe dann erst ein mal ein paar Wochen stehen und entwickle sich dann nicht mehr weiter.
Gegen die Eisheiligen sei es ohnehin schwierig, etwas zu unternehmen. Auch der BBV-Geschäftsführer kennt Obstplantagen, in denen Feuer geschürt wird oder Nebelmaschinen zum Einsatz kämen. Sogar von Hubschrauberflügen über Obstanlagen habe er schon gehört, um durch Luftverwirbelungen die Kälte ferzuhalten. Für normale landwirtschaftliche Kulturen sei dies schon aus Kostengründen nicht möglich.
Trotz aller Klimaveränderungen: Die Eisheiligen seien schon noch relevant, so Harald Köppel. „Man hat das schon irgendwie im Blick und schaut mit Sorge auf diese Zeit.“ Es sei nicht so, dass man sagen könnte, mit dem Klimawandel habe sich das alles erledigt. Was die Zukunft noch bringt, könne man freilich nicht wissen.
Und das sind die Eisheiligen, alle fünf sollen zwischen dem dritten und dem fünften Jahrhundert nach Christus gelebt haben: Mamertus (11. Mai) war Erzbischof von Vienne, Pankratius (12. Mai) gilt als Märtyrer, Servatius (13. Mai) war Bischof von Tongeren, Bonifatius (14. Mai) war ebenfalls Märtyrer und schließlich die „Kalte Sophie“ (15. Mai), auch sie gilt als Märtyrerin.
Wenig Regen, weniger Fläche, niedrigere Preise / Vorboten des Sommers“: Oberfränkische Landwirte erwarten durchschnittliche Rapsernte
Bayreuth.
Vier Kilo Aussaat ergeben vier Tonnen Ernte jeweils
pro Hektar: Damit ist Raps ein prima Geschäft für
den Landwirt, könnte man meinen. Ganz so ist es
freilich nicht, wie der Vorsitzende der
Erzeugergemeinschaft Qualitätsraps Oberfranken Klaus
Siegelin aus dem Landkreis Kronach und
Geschäftsführer Torsten Gunselmann vom Bauernverband
in Bamberg am Dienstag bei einem Pressetermin
zwischen Rapsfeldern in Oberobsang bei Bayreuth
erläuterten.
Aufgrund des trockenen Frühjahrs rechnen die Verantwortlichen heuer mit eher unterdurchschnittlichen Erträgen. Nach dem massiven Preisanstieg zu Beginn des Ukrainekrieges im Frühjahr 2022 und einem nach wenigen Wochen wieder erdrutschartigen Preisverfall von Druschfrüchten allgemein liege der Preis für Raps aktuell wieder auf Vor-Corona-Niveau, so Torsten Gunselmann. Wurde Raps im Mai 2022 mit über 90 Euro pro Doppelzentner gehandelt liege der aktuelle Preis nur bei rund 45 Euro pro Doppelzentner.
Als Grund für den massiven Preisverfall nannten die Verantwortlichen unter anderem die Ausdehnung des Anbaus in den Hauptexportländern Ukraine und Rumänien sowie eine deutlich gesteigerte Einfuhrmenge in den zurückliegenden Monaten. Die dadurch hervorgerufenen niedrigeren Rapspreise in Verbindung mit hohen Ausgaben bei den Vorleistungen, vor allem bei Düngemitteln und Kraftstoffen, würden die Wirtschaftlichkeit des Rapsanbaus weiter schwinden lassen. „Ob in Zukunft der Anbauumfang beim Raps gehalten werden kann, bleibt abzuwarten. Auf einem guten Stern steht der Anbau für die Zukunft zumindest aktuell nicht.“
Dazu
tragen speziell in der Region auch die
Witterungsbedingungen bei. Das kalte Wetter im
Februar und März habe die Pflanzenentwicklung
verzögert, seit Beginn des Jahres habe es zu wenig
Regen gegeben, so Torsten Gunselmann. Besonders auf
trockenen und sandigen Lagen seien deshalb schon
jetzt Ertragseinbußen zu erwarten.
Aktuell stehen nach den Worten von Klaus Siegelin rund 15.000 Hektar Raps in Oberfranken in Vollblüte. Im regionalen Ackerbau nehme der Raps damit aber noch immer eine zentrale Rolle en. „Die gelben Felder sind mehr als ein schönes Frühlingsbild, sie sind sichtbarer Ausdruck einer vielseitigen und zukunftsorientierten Landwirtschaft“, sagte der Vorsitzende der Erzeugergemeinschaft.
Die Anbaufläche habe dabei in Oberfranken während der zurückliegenden Jahre immer wieder stark geschwankt. Seien im Regierungsbezirk 2010 noch rund 21.000 Hektar Raps angebaut worden, hatte der Wert 2019 mit unter 10.000 Hektar seinen Tiefpunkt erreicht. Als Grund dafür nannte der Geschäftsführer den hohen Schädlingsbefall, die niedrigen Preise und die Trockenheit. Viele Landwirte hätten damals auf Mais umgestellt.
Dabei
dürfe man allerdings nicht vergessen, dass auch die
gesamte Ackerfläche in Oberfranken von knapp 208.000
Hektar im Jahr 2015 auf 192.500 Hektar deutlich
zurückgegangen ist. Der Flächenverbrauch, vor allem
zu Gunsten von Siedlungs- und Verkehrsflächen, sowie
Ausgleichs- und Ersatzflächen für den Naturschutz
halte unvermindert an. „So können wir auf Dauer
nicht weitermachen“, sagte Torsten Gunselmann.
„Andernfalls verlieren wir mit dem Ackerland auch
unsere Lebensgrundlagen.“
„Raps ist ein Alleskönner“, so die Verantwortlichen der Erzeugergemeinschaft. Mit einem Ölgehalt von über 40 Prozent gilt er als eine der wichtigsten Ölpflanzen nach Palm und Soja. Ein Großteil des Rapses wird zu Biodiesel verarbeitet. Neben der Verwendung als technisches Öl wird Rapsöl auch in der Lebensmittelherstellung genutzt und in der wohl bekanntesten Form als Speiseöl angeboten und zum Braten, Kochen, für Salate oder bei der Margarineherstellung verwendet. Der Pressrückstand gilt als eiweißreiches Futter für Rinder und Schweine und obendrein bieten Rapsfelder für Bienenvölker einen enormen Honigertrag.
Landwirt Markus Ziegler aus Oberobsang, das zur Stadt Bayreuth gehört, bewirtschaftet insgesamt rund 500 Hektar landwirtschaftlicher Fläche, davon 50 Hektar Raps. Die leuchtend gelben Felder sind aktuell entlang der Bundesstraße B85 zwischen Heinersreuth und Bayreuth gut zu sehen.
Bilder:
1. Landwirt Markus Ziegler zeigt Geschäftsführer
Torsten Gunselmann und Vorstand Klaus Siegelin (von
links) von der oberfränkischen Erzeugergemeinschaft
für Qualitätsraps seine Bestände.
2. + 3. Die Rapsfelder
von Markus Ziegler entlang der B85 zwischen Bayreuth
und Heinersreuth.
Hofmetzgerei und Hofladen: Das Gut Dörnhof setzt auf Direktvermarktung / Jana und Julian Zink haben in Eigenleistung komplette Hofmetzgerei verwirklicht
Dörnhof.
Erst sollte es nur eine kleine Wurstküche werden.
Aber dann dachten sich Jana und Julian Zink vom Gut
Dörnhof bei Kulmbach: „Wenn schon dann richtig und
nicht nur irgendwie provisorisch“. Nun haben sie in
eine ehemalige Scheune eine komplette Hofmetzgerei
mit Schlachträumen, Kühl- und Gefrierhäusern,
Verpackungsräumen und allem, was so dazu gehört
errichtet. Die Metzgerei ist betriebsfähig, von der
Lebensmittelkontrolle abgenommen und geht in diesen
Tagen an den Start.
Jana und ihre Familie hatten vor rund acht Jahren die zuletzt leerstehende Hofstelle, ein ehemaliger Milchviehbetrieb, gekauft. Ursprünglich war ein Pferdehof vorgesehen, doch das hatte sich schnell zerschlagen, spätestens als Julian ins Spiel kam. Zusammen haben sie den landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut, der aktuell im Nebenerwerb geführt wird. Neben Rindern, Schweinen, Ziegen und Schafen gibt es dort auch Enten, Gänse und Hühner. Für das Geflügel ist das eigene Schlachthaus gedacht, wobei Julian auch darauf vorbereitet ist, Lohnschlachtungen vorzunehmen. Der 28-Jährige hat nicht nur eine abgeschlossene Schreinerlehre, sondern ist auch Metzgermeister mit Sachkundenachweis zum Schlachten. Derzeit ist er hauptamtlich im Kulmbacher Schlachthof beschäftigt.
Die
rund 150 Quadratmeter große Hofmetzgerei hat er
zusammen mit der gesamten Familie nahezu komplett in
Eigenleistung errichtet. Beispielsweise musste eine
Heißwasserversorgung her, schließlich wird beim
Schlachten eine Temperatur von mindestens 70 Grad
Celsius gefordert. Die Wärmeversorgung funktioniert
nun mit einem Festholzbrenner, der mit Scheitholz
befeuert wird. Auch eine komplett neue
Stromzuleitung musste geschaffen werden. Obwohl das
Gut Dörnhof formal zur Stadt Kulmbach gehört, liegt
der Hof ziemlich einschichtig an der engen
Verbindungsstraße von Kauernburg nach Eggenreuth.
Drei Jahre haben Planung und Bau in Anspruch genommen, bis Brüh- und Rupfmaschinen sowie die Geräte zur Fleischverarbeitung eingebaut werden konnten, erinnert sich Jana Zink.
Kunden
des Gutes Dörnhof sind in erster Linie Privatleute.
Aber auch einige Gastronomen sind darunter. Jana und
Julian Zink werben mit ihrer Internetseite, mit
Flyern und in den sozialen Medien für ihre
Direktvermarktung. Die funktioniert in erster Linie
über den kleinen Hofladen, der als
Selbstbedienungsladen konzipiert ist. Die
Wurstgläser stehen im Kühlschrank, Fleisch liegt
abgepackt in den Tiefkühltruhen bereit. Außerdem
gibt es Nudeln, Marmelade, Getränke und vieles mehr.
„Wir haben einen festen Kundenstamm“, sagt Jana. Den
Kunden vertraut man komplett. „Je mehr man den
Leuten vertraut, desto mehr Vertrauen bekommt man
zurück“, so Julian. Den Vorteil sieht er darin, dass
der kleine Laden an sieben Tagen in der Woche
jeweils 24 Stunden geöffnet hat. Schnell noch abends
was für den Grill holen, ist da kein Problem.
Geplant ist künftig allerdings ein fester Tag, an
dem auch jemand im Laden steht.
Angefangen hatte die Familie mit 20 Gänsen für den Eigenbedarf und für Freunde. Dann seien es immer mehr geworden, sagt Julian, der mittlerweile von einer Riesennachfrage spricht. Im vergangenen Jahr seien es schon 150 gewesen, heuer wird mit 250 Gänsen geplant.
Der
landwirtschaftliche Betrieb von Jana und Julian Zink
ist breit aufgestellt. Im Stall stehen 15
Fleischrinder, das Paar hat Strohschweine, Ziegen
zur Landschaftspflege im Auftrag der Stadt, drei
Wohnmobilstellplätze „mit Blick auf die Plassenburg“
und eine Ferienwohnung soll noch dazu kommen. Der
Betrieb der Familie Zink ist ein typischer
Mehrgenerationenhof „so wie er früher einmal war“.
Vier Generationen leben hier. Jana Zink kommt
ursprünglich aus Norddeutschland, ihre Eltern und
Großeltern sind längst nachgezogen. Das Paar hat
zwei kleine Kinder.
Überhaupt hat die Familie Zink noch viele Pläne. Der Schweinestall soll zu einem Offenstall umgebaut werden. Außerdem soll ein Rinderstall ebenfalls als Offenstall errichtet werden. Derzeit sind die Rinder ganzjährig in Weidehaltung draußen. Auch eine Ferienwohnung soll noch entstehen
Bilder:
1. Der Hofladen von Jana und Julian Zink hat an
sieben tagen in der Woche jeweils 24 Stunden
geöffnet und läuft auf Vertrauensbasis.
2. In diesen Tagen geht das Schlachthaus von Jana
und Julian Zink in Betrieb.
3. Das Gut Dörnhof liegt an der kleinen
Verbindungsstraße von Kauernburg nach Eggenreuth.
4. Julian Zink kümmert sich um die Strohschweine.
Sie werden allerdings in Kulmbach geschlachtet, aber
vor Ort verarbeitet.
Eigenverbrauch am effizientesten / Aktionstag Photovoltaik in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten
Bayreuth.
„E-Mobilität ist effizient, zukunftsweisend und
macht Spaß.“ Gans so einfach, wie es Rita Haas vom
Technologie- und Förderzentrum Nachwachsende
Rohstoffe in Straubing beim Aktionstag Photovoltaik
an den Landwirtschaftlichen Lehranstalten in
Bayreuth formuliert hat, ist es im
landwirtschaftlichen Bereich dann allerdings doch
nicht. Thomas Ludwig vom Landmaschinenhersteller
Fendt aus Marktoberndorf sprach von Einschränkungen.
„In den Volllastbereich können wir nicht rein“, sagte er. Dennoch sei der E-Traktorlängst keine Zukunftsmusik mehr. Mit dem Fendt e100 Vario sei bereits ein Schlepper serienreif auf dem Markt. Die Akkuleistung sei stark abhängig von der jeweiligen Arbeit. Allerdings mache der e-Fendt eher Sinn mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage oder mit einem eigenen Windpark. Ein regelmäßiges Laden an der nächsten Station sei eher umständlich und aufwändig. Thomas Ludwig sprach deshalb auch die Empfehlung aus, den E-Traktor aus dem Hause Fendt für den kommunalen Bereich, oder als Schmalspurversion für Weinbau, Obstbau oder im Indoor-Bereich, also in Gewächshäusern einzusetzen.
Eine weitere Möglichkeit für die Zukunft könne nach den Worten des Fendt-Managers die Brennstofftechnologie sein. Hier gebe es bislang allerdings erst drei Schlepper, die derzeit im Testbetrieb laufen. Wenn sie zur Serienreife gelangten, dann allerdings auch nur für den mittleren Leistungsbereich, schränkte er ein. Thomas Ludwig gab dabei auch zu bedenken, dass die Antriebstechnik im landwirtschaftlichen Bereich gerade einmal 8,5 Prozent des gesamten CO-2-Ausstoßes ausmacht.
Während sich der Fendt-Sprecher mit der Nutzung der regenerativen Energie beschäftigte, widmete sich Daniel F. Eisel vom Technologie- und Förderzentrum Straubing mehr der Erzeugung. „Alle Dächer voll machen“, so lautete seine Devise, wenn es um die Installation von Photovoltaik-Anlagen geht. Damit könne der Landwirt Abhängigkeiten verringern, Einkommen erzeugen, seine Energiekosten reduzieren, beziehungsweise auf niedrigem Niveau fixieren. „Mit Hilfe der Photovoltaik kann der Landwirt die Energieversorgung dekarbonisieren“, sagte Daniel F. Eisel.
Doch was tun, wenn, wie derzeit bei vielen Photovoltaik-Anlagen, die Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ausläuft? Raphael Haug, Produktmanager von der Maschinenring Landenergie empfahl betroffenen Bauern, die Umstellung auf Eigenverbrauch zu prüfen, denn der sei noch immer die sinnvollste Möglichkeit. Über die Landenergie der Maschinenring gebe es außerdem die Möglichkeit zur Direktvermarktung, was vor allem dann sinnvoll sei, wenn es keine Chance zum Eigenverbrauch gebe. Dafür kämen allerdings nur kleinere Anlagen mit einer Leistung zwischen 25 und 99 KW in Frage. Immerhin biete die Landenergie eine Preisgarantie bis Ende des Jahres und die monatliche Gutschrift biete auch entsprechende Planungssicherheit.
Direktlieferungen an den Nachbarn seien zwar rechtlich zulässig, jedoch praktisch nur schwer umsetzbar. Als Grund dafür nannte Raphael Haug die hohen Hürden bei den energierechtlichen Vorgaben. Auch bei der Direktvermarktung auf eigene Faust seien verschiedene gesetzliche Voraussetzungen zu beachten.
Bild: Hochkarätige Gäste konnte Bezirkstagspräsident Henry Schramm (5. von rechts) beim Aktionstag Photovoltaik auf dem Gelände der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth willkommen heißen. Der Bezirk ist Träger der Eirichtung.
Klauenpflege, Kälberaufzucht und regionale Kreisläufe / 18 „Staatlich Geprüfte Wirtschafter für Landbau“ an der Bayreuther Landwirtschaftsschule verabschiedet
Bayreuth.
Sie dürfen sich ab sofort als „Staatlich Geprüfter
Wirtschafter für Landbau“ bezeichnen: 18 junge
Leute, aus den sechs oberfränkischen Landkreisen
Bamberg, Bayreuth, Coburg, Kronach, Kulmbach und
Lichtenfels, die während der zurückliegenden drei
Semester die Landwirtschaftsschule in Bayreuth
absolviert haben. Aus den Händen von Schulleiter Uwe
Lucas erhielten die sechs Damen und 12 Herren im
Rahmen einer Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse.
Die Themenpalette der zurückliegenden eineinhalb Jahre war breit gefächert. Sie reichte von erneuerbaren Energien und Klauenpflege über muttergebundene Kälberaufzucht bis zu Ökolandbau sowie den verschiedensten Umwelt- und Naturschutzthemen. Das dreisemestrige Studium setzte einen Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Landwirtschaft und zusätzlich ein Jahr einschlägige Berufspraxis voraus. Der jüngste der Absolventen war 18, der älteste 28 Jahre jung.
„Sie haben einen großen Meilenstein in ihrer beruflichen Fortbildung erreicht“, sagte Schulleiter Uwe Lucas bei der Übergabe der Zeugnisse. Er zählte noch einmal alle Fächer auf, in denen die Absolventen mehr als 1000 Unterrichtsstunden absolviert hatten. Dazu kam eine Vielzahl von Exkursionen, Betriebsbesichtigungen und Seminaren. Semesterleiterin Theresa Bauer erinnerte an einige besondere Aktionen des Jahrgangs. So hätten die Absolventen beispielsweise an den Bauerndemos in Berlin teilgenommen, den Agrarausschuss im Bayerischen Landtag besucht und Schülern des Richard-Wagner-Gymnasiums in Bayreuth Landwirtschaft nähergebracht.
Der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann bezeichnete die Absolventen als Zukunft der Landwirtschaft in unserer Region. Die Landwirtschaft benötige einen bestens ausgebildeten Nachwuchs, denn die Anforderungen An die Bauern würden immer größer. Die Landwirte vor Ort seien diejenigen, die regionale Wirtschaftskreisläufe aufrechterhalten und dafür sorgten, dass Deutschland nicht auf Importe angewiesen sei.
Aus dem Bayerischen Landtag waren Stefan Frühbeißer (Freie Wähler) und Tim Pargent (Grüne) als Gratulanten gekommen. „Wir können stolz sein, dass derart hochqualifizierte Landwirtschaft vor Ort stattfindet“, sagte Frühbeißer. Pargent würdigte den Gemeinschaftssinn der Absolventen und appellierte an sie, Neugier und Wissbegierde beizubehalten.
Als die drei Jahrgangsbesten wurden Louisa Riedl aus Lanzendorf, Marina Grebner aus Wilhelmsthal undTobias Spiller aus Himmelkron ausgezeichnet.
Die
19 künftigen „Staatlich Geprüften Wirtschafter für
Landbau“ sind:
aus dem Landkreis Bamberg: Johannes Hänchen (Neudorf), Vanessa Sauer (Oberleinleiter), Bernhard Schäfer (Neudorf) und Eva Willert (Dietendorf);
aus Stadt und Landkreis Bayreuth: Anna Büttner (Neuhof), Paul Jander (Bayreuth), Fabian Lang (Oberschwarzach), Philipp Neithardt (Plösen), Leonie Rauh (Wiesentfeld) und Andreas Ziegler (Eichenstruth);
aus dem Landkreis Coburg: Edwin Herbst (Ebersdorf) und Elias Thamm (Neustadt);
aus dem Landkreis Kronach: Marina Grebner (Wilhelmsthal);
aus dem Landkreis Kulmbach: Louisa Redl (Lanzendorf), Tobias Spiller (Himmelkron) und Julia Stenglein (Oberpöllitz);
aus dem Landkreis Lichtenfels: Maximilian Reindl (Altenkunstadt) und Maximilian Rieger (Mainroth).
Bilder:
1. Schulleiter Uwe Lucas und Semesterleiterin
Theresa Bauer (von rechts) sowie Landrat Florian
Wiedemann (2. von links) gratulierten den
Jahrgangsbesten Marina Grebner (links), Louisa Riedl
und Tobias Spiller.
2. 18 künftigen „Staatlich Geprüften Wirtschafter
für Landbau“ konnte Schulleiter Uwe Lucas (rechts)
nach drei Semestern an der Landwirtschaftsschule in
Bayreuth verabschieden.
Stallbau als Visitenkarte der Landwirtschaft / Semesterarbeit an der Coburger Hochschule beschäftigte sich mit „Stallbau in fränkischer Kulturlandschaft“ – Ausstellung in Münchberg
Münchberg.
Normalerweise haben Architekturstudenten mit
Landwirtschaft wenig zu tun. Nicht so an der
Hochschule für angewandte Wissenschaften in Coburg.
Dort hat sich das zweite Semester des Studiengangs
Architektur im Fach Baukonstruktion unter dem Titel
„Stallbauten in fränkischer Kulturlandschaft“ mit
zukunftsfähigen Lösungen beschäftigt. Ausgewählte
Ergebnisse in Form von Modellen, Plänen., Skizzen
und Beschreibungen haben die Studenten unter der
Federführung von Rainer Hirth, Professor für
Entwerfen und Konstruieren im Studiengang
Architektur zu einer kleinen Ausstellung
zusammengefasst, die aktuell im Grünen Zentrum in
Münchberg, Helmbrechtser Straße 22, zu sehen ist.
Die Schau soll später als Wanderausstellung auch an
anderen Orten zu sehen sein.
Ein Stall sei bisher nur selten als architektonische Aufgabe gesehen worden, sagte Professor Rainer Hirth. Für den Landwirt sei der Stall teil seines Betriebes und dabei stünden funktionale Aspekte im Vordergrund. Doch die Landwirtschaft sei im Wandel. Qualität, Nachhaltigkeit und Aspekte des Tierwohls würden immer stärker an Bedeutung gewinnen. Dabei bezeichnete es der Professor als wünschenswert, dass auch die Architektur der Höfe und Ställe weit größere Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfährt.
Konkret war es die Aufgabe für die Studenten, einen Tiefstreu-Stall für 25 bis 35 Rinder und drei bis vier Kälber zu entwerfen, der bei Bedarf modular erweiterbar ist, dazu ein Stroh- und Futterlager und einige Nebenräume. Holz war als heimisches Material besonders zu verwenden, Verschattung und Lüftung zu beachten. Nicht zuletzt sollte dem Tierwohl eine besondere Stellung eingeräumt werden. Das Besondere an der Aufgabenstellung war, dass für zwei konkrete, also real existierende Grundstücke geplant werden sollte. Dabei handelte es sich um zwei Flächen in Mitwitz (Landkreis Kronach) auf dem Betrieb der Familie Konrad.
Herausgekommen sind 22 Entwürfe von 43 Studenten, die sich meist in Zweierteams zusammengefunden hatten. Sie sind nicht nur in der Ausstellung zu sehen, sondern auch in einem 224-Seiten-starken Buch mit vielen Abbildungen zusammengefasst, das im Umfeld der Veranstaltung erworben werden kann (ISBN: 978-3-948964-12-2).
Bei
der Ausstellungseröffnung sprach der Leiter des
Amtes für Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg Michael
Schmidt von einer äußerst anspruchsvollen
architektonischen Aufgabe, schließlich gelte es
Wirtschaftlichkeit, Funktionalität, Tierwohl,
Umweltschutz und Integration in die Kulturlandschaft
zusammenzubringen. Dabei gehe es der Hochschule vor
allem um den immer wieder geforderten Transfer von
der Wissenschaft in die Praxis, so Referatsleiter
Markus Neufeld von der Hochschule.
Stallbau dürfe nicht unterschätzt werden, denn er sei nicht selten die Visitenkarte der Landwirtschaft, sagte Wilhelm Pflanz, Professor an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Vor 40 Jahren habe man noch Ställe ohne Fenster gebaut. Mittlerweile habe sich die Tierhaltung weiterentwickelt, die gesellschaftlichen Anforderungen seien gestiegen und so nehme Tierwohl mittlerweile eine wichtige Rolle ein. Dazu gehören nach den Worten des Professors Funktionsbereiche, die Ausstattung, genügend Platz pro Tier, eine ausgeklügelte Lüftung für ein gutes Stallklima, Auslaufmöglichkeiten und nicht zuletzt verschiedene Möglichkeiten der Fütterung und der Wasserversorgung.
Professor Rainer Hirth stellte bei der Ausstellungseröffnung auch klar, dass ein Landwirtschaftlicher Betrieb immer auch ein Bauernhof und keine Fabrik ist. Er kritisierte, dass viel zu oft rein funktionale Gebäude wie Fabriken in der Landschaft stehen. In früheren Zeiten sei der Bauernhof im Dorf ein fester Bestandteil des Ortes gewesen. Er wünschte sich deshalb auch, dass Aussiedlerhöfe wieder als kleinteilige, dorfartige Cluster gebaut würden und dass auch in der modernen Architektur Referenzen an die Traditionen enthalten sein sollen. Nicht zuletzt sollte landwirtschaftliches Bauen auch wieder teil der Architekten-Ausbildung werden.
Bei der Ausstellungseröffnung wurden aber auch kritische Stimmen an den hehren Zielen der Studenten laut. Preis und Wirtschaftlichkeit spielten beim Bauen eine wesentliche Rolle, so Franz Stemmer von der BBV-Landsiedlung. Funktionalität habe Priorität, für architektonische Spielereien sei wenig Platz, brachte es Thomas Erlmann, Kulmbacher Kreisvorsitzender des Rinderzuchtverbandes auf den Punkt. Neue Ställe würden gebraucht, weil sich die Anforderungen verändert haben, leider würden aufgrund der hohen Kosten derzeit aber kaum welche gebaut.
Bild: „Stallbauten in fränkischer Kulturlandschaft“: im Grünen Zentrum in Münchberg sind die Entwürfe von Studenten der Coburger Hochschule ausgestellt.
Jungzüchter-Nightshow: Premiere in Bayreuth für Kühe auf dem „Laufsteg“ - Tierschützer demonstrierten vor der Halle
Bayreuth.
„Uns ist es wichtig zu zeigen, dass Fleckvieh-Rinder
für uns Landwirte und Zuchtbegeisterte weit mehr
sind als Nutztiere oder Nummern im Stall“, das sagt
Anna-Lena Opel von den Jungzüchtern. „Wir haben eine
besondere Verbindung zu den Tieren und setzen uns
mit großer Hingabe für ihr Wohl ein“. Um das alles
einem breiten Publikum nahezubringen, haben die
jungen Landwirte in der Tierzuchthalle in Bayreuth
erstmals eine „Oberfränkische Jungzüchter-Night-Show“
veranstaltet.
Schon zum Auftakt war die Halle komplett verdunkelt und in farbiges Licht getaucht. Zahlreiche Infostände von de verschiedensten Anbietern und Organisationen waren um und in der Tierzuchthalle aufgebaut. Im Laufe der Veranstaltung, die am Mittag begann und erst zu später Stunde endete, dürften viele hundert Interessierte die Show besucht haben.
„Unser Ziel ist es, sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene mit Interesse an der Landwirtschaft für die Zucht von Fleckvieh-Kühen zu begeistern und unsere Leidenschaft an die nächste Generation weiterzugeben“, sagt Anna-Lena Opel. Gleichzeitig sollten auch Menschen ohne direkten Bezug zur Landwirtschaft die Möglichkeit haben, Einblicke in die Rinderzucht zu erhalten und Verständnis für die Leidenschaft zu entwickeln.
Die
Schau sollte auch eine Gelegenheit sein, den
Austausch zwischen Landwirten und einer breiten
Bevölkerung zu ermöglichen, so Christian Lappe,
erster Vorsitzender des Jungzüchterclubs. Der
Kontakt großer Teile der Bevölkerung zur
Landwirtschaft sei leider verloren gegangen. „Unsere
Veranstaltung wollen wir dazu nutzen, einen Beitrag
dazu zu leisten, diesen Bezug wieder herzustellen.“
Inspiriert durch verschiedene Zuchtschauen der vergangenen Jahre und den intensiven Austausch mit anderen Jungzüchterclubs in Bayern sei der Wunsch entstanden, eine eigene Zuchtshow in Oberfranken ins Leben zu rufen. Vor knapp einem Jahr se dann die Idee gekommen, eine solche Veranstaltung gemeinsam mit anderen Clubs in Bayreuth zu organisieren. „Stellvertretend für alle oberfränkischen Jungzüchterclubs haben wir, der Jungzüchterclub Bayreuth-Kulmbach, die Planung, Organisation und Durchführung übernommen“ so Anna-Lena Opel.
Zu später Stunde stieß auch noch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zur Jungzüchtershow. Er hatte die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen. Es sei beeindruckend zu sehen, mit welcher Begeisterung sich die junge Generation für die Zucht einsetzt, sagte er. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sowohl die Zahl der Betriebe als auch die Zahl der Milchkühe in Oberfranken rückläufig ist, bezeichnete es der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann als immens wichtig, Werbung für den Berufsstand zu machen. „Wir brauchen euch“, sagte er und beteuerte, dass bei ihm kein Tag ohne Müsli und Milch beginne.
Im
Bambini-Cup zum Auftakt stellen Kinder im Alter von
4 bis 11 Jahren ihr Können unter Beweis, indem Sie
mit ihrem Kalb zusammen einen Parcours bewältigten.
Über die Teilnehmerzahl von fast 80 in drei
verschiedenen Altersklassen waren selbst die
Veranstalter erstaunt. Beim Rindervorführ- und
Typwettbewerb: traten Jugendliche zwischen 12 und 17
Jahren mit ihren Rindern gegeneinander an. Höhepunkt
war der Vorführ- und Typwettbewerb der „großen“
Jungzüchter, bei dem Fleckvieh-Kühe präsentiert
wurden. Die beiden Vorführ- und Typwettbewerbe
wurden von Lukas Gartner und Andreas Egger gerichtet
die extra aus Südtirol angereist waren. Daneben
wurden in einer „Elite-Auktion“ hochwertiger
Embryonenpakete und Zuchtrinder versteigert.Den
Abschluss bildete die große Jungzüchter-Party, bei
der die Junglandwirte eindrucksvoll unter
Beweisstellten, dass sie auch feiern können.
Nicht alle hatten ihre Freude an der Jungzüchter-Show. Vor der Halle protestierten etwa 20 Mitglieder verschiedener Tierschutzorganisation dagegen. „Fleisch ist Mord“ oder „Zukunft ist vegan“, war auf den Transparenten zu lesen. Die Polizei fuhr dazu auf und ab, ein privater Sicherheitsdienst wachte streng darüber, dass keiner der Demonstranten die Halle oder das Gelände des Rinderzuchtverbandes betrat. „Wir produzieren unter höchsten Standards, da brauchen wir und nicht zu verstecken und von solchen Leuten einschüchtern lassen“, kommentierte der Bayreuther BBV-Kreisobmann die Aktion der sogenannten Tierschützer.
Bilder:
1. Mächtig
ins Zeug legten sich die Bambinis bei der ersten
oberfränkischen Jungzüchter-Show.
2. Fast
während der gesamten Jungzüchter-Show waren die
Ränge der Tierzuchthalle in Bayreuth voll besetzt.
3. In
gespannter Erwartung waren die jüngsten, die
durchaus schon wussten, wie man mit den Tieren
umgeht.
Neue Dachmarke: Genuss als Aushängeschild /Kulinarik und Tourismus sollen künftig enger verzahnt werden – Genusskonferenz in Bamberg
Bilder (im Uhrzeigersinn): Angela Inselkammer (Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes), Christine Röger (Leiterin des Kompetenzzentrums für Ernährung in Kulmbach), Daniel Anthes (Wirtschaftsgeograf, Betriebswirt, Food Experte und Zukunftsforscher) sowie Wolfgang Wagner Bereichsleiter von der Bayern Tourismus GmbH).
Bamberg. Bier, Braten Bratwurst und Brezen: dafür und für vieles andere steht die Genussregion Oberfranken. Im Regierungsbezirk ist man längst darauf gekommen, dass Kulinarik und Tourismus zusammengehören. Das Erfolgsmodell soll nun bayernweit Furore machen. Dazu wurde Anfang des Jahres vom Landwirtschaftsministerium die neue Dachmarke „Genuss Bayern“ gegründet. Sie soll dazu beitragen, die vielfältigen Genüssen, die der Freistaat zu bieten hat, touristisch nutzbar zu machen. Den Auftakt bildete am Donnerstag eine „Genusskonferenz“ am „Genussort“ Bamberg, bei der sich zahlreiche Akteure aus den Bereich Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft, Hotellerie und Gastronomie sowie Tourismus zum Austausch trafen.
Holzofenbrot und Hofer Rindfleischwurst, Käse aus dem Allgäu und Kulmbacher Bratwürste, ein Glas Frankenweit mit Blick auf die Weinberge oder ein Kulmbacher Bier mit Blick auf die Plassenburg: der Freistaat Bayern verbindet wie kein anderes Bundesland kulinarische Genüsse mit touristischen Zielen. Doch Bayern steht auch im Wettbewerb, etwa mit Österreich oder mit Südtirol. „Deshalb wolle wir das Thema Genuss als Aushängeschild stärken“, sagt Helmut Frank vom bayerischen Landwirtschaftsministerium.
Das Ganze geschehe nicht uneigennützig, denn die Ernährungswirtschaft stelle genauso wie die Tourismusbranche einen starken Wirtschaftszweig dar, den es nicht nur zu erhalten, sondern auch zu stärken gilt. So einfach sei das gar nicht, zum einen befinde man sich aktuell in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld, zu anderen sei die Zahl der Insolvenzen im Gastrobereich stark angestiegen. Mit der neuen Dachmarke soll gegengesteuert werden, schließlich sei 2024 in Sachen Tourismus ein absolutes Rekordjahr mit 14,6 Millionen Gästen und 103 Millionen Übernachtungen in Bayern gewesen. „Reisen ist für viele Menschen ein Grundbedürfnis“, so Helmut Frank. Und weiter: „Wer kann, der spart nicht am Urlaub“.
Reisen und Essen seien seit Jeher untrennbar miteinander verbunden und ermöglichten vielleicht so unmittelbar wie kein anderer Lebensbereich das Eintauchen in andere Kulturen, sagte Daniel Anthes, Wirtschaftsgeograf, Betriebswirt, Food Experte und Zukunftsforscher. Seinen Worten zufolge spiele der kulinarische Faktor bei fast der Hälfte aller Deutschen eine Rolle bei der Urlaubsentscheidung. Im Zuge gesellschaftlicher Umbrüche verändere sich aber auch vieles im Zusammenspiel von Kulinarik und Touristik, hin zu aktuellen Megatrends wie Gesundheit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Ob allerdings irgendwann tatsächlich ein Roboter in der Küche steht und aufgrund eklatanten Personalmangel das Essen zubereitet oder die Nahrungsmittel aus dem 3-D-Drucker kommen? Daniel Anthes wollte das alles nicht so ganz ausschließen.
Ein wenig widersprach Wolfgang Wagner von der Bayern Tourismus GmbH dem Zukunftsforscher. Kulinarik sei zwar ein zentraler Imagefaktor und stehe wie kaum ein anderer für das bayerische Lebensgefühl, doch ein echter Reiseanlass, das sei die Kulinarik nicht. Was noch nicht ist, kann noch werden, denn, so der Sprecher: „Bayern tickt schon immer ein bisschen anders als die anderen Bundesländer.“ Deshalb gebe es auch die Dachmarke und die aktuelle Kampagne: „Reine Geschmackssache“. Ziel sei es, die Landschaft, ihre Produkte und deren Genuss zusammenzubringen. Beispiel dafür ist die Karpfenteichwirtschaft im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth. Vom Abfischen bis zur Karpfenkerwa, vom Karpfenkochkurs bis zum Karpfenwanderweg sei das so ziemlich alles geboten.
Drohne und VR-Brille, Roboter in der Küche oder 3-D-Drucker seien im Brauereigasthof Aying von Angela Inselkammer im Münchner Land erst einmal nicht zu erwarten. Angela Inselkammer ist die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes und sie stellte klar, was ihre Gäste von ihr erwarten: echte bayerische Erlebnisse, nicht mehr und nicht weniger. Roboter gehörten da definitiv nicht dazu. Für sie ist es wichtig, dass die Menschen wieder einen Bezug zu den Lebensmitteln finden. „Wer selbst mal einen Salat angebaut hat, der schmeißt ihn später auch nicht so einfach weg“, sagte sie. Ganz ausschließen wollte aber auch die Präsidentin des Hotel- und Gaststättenverbandes den Einsatz von Robotern nicht. In der Systemgastronomie oder in der Gemeinschaftsverpflegung würden die Roboter vielleicht schon Einzug halten.
Für letzteres ist Christine Röger, die Leiterin des Kompetenzzentrums für Ernährung in Kulmbach zuständig. Sie plädierte dafür gesunde Nahrung nicht zu ideologisieren. Gesunde Ernährung sei die Grundlage jeder Ernährungsbildung und dafür arbeiteten sie und ihre Mitstreiter nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit modernen pädagogischen Konzepten.
Zukunft gestalten, Talente entfalten / Bewusstsein für den Bauernstand: Berufswettbewerb der Landjugend auf oberfränkischer Bezirksebene
Bayreuth.
Die Bewältigung eines Hindernisparcours mit dem
Schlepper, die Bestimmung von Saatgut oder die
Überprüfung eines Traktors im Hinblick auf Betriebs-
und Verkehrssicherheit: Von angehenden Landwirten
wird so einiges verlangt. Dabei sind das nur drei
von einer Vielzahl an Aufgaben, die diesmal im
Berufswettbewerb der Deutschen Landjugend zu
bewältigen waren. Beim oberfränkischen
Bezirksentscheid in Bayreuth stellten sich die
Erstplatzierten aus den Landkreisen dem Vergleich
mit ihren Berufskollegen. Es ging nicht mehr und
nicht weniger als um den Einzug in den bayerischen
Landesentscheid am 9. und 10. April in Landsberg am
Lech.
Daran
teilnehmen werden die Sieger des Bezirksentscheids:
Johannes Renner aus Küps (Landkreis Kronach) und
Julian Mehringer aus Konradsreuth (Landkreis Hof).
Sie erzielten die meisten Punkte im der Gruppe L1,
in der die 18 Teilnehmer aus den Berufsschulen
versammelt waren. Die Teilnehmer aus den
landwirtschaftlichen Fachschulen traten wie schon in
den Vorjahren in der Gruppe L2 in Zweierteams an.
Dabei konnten sich Louisa Riedel und Tobias Spiller
beide aus Himmelkron (Landkreis Kulmbach) den Platz
auf dem Siegertreppchen und damit den Einzug in den
Landesentscheid sichern. Eine Besonderheit gab es in
Bayreuth: Hier traten die Fachschulen auch aus der
Oberpfalz an. Dabei schafften es Antonia Ziehrer aus
Bernhardswald (Landkreis Regensburg) und Celina
Herrnberger aus Cham auf den vordersten Platz. Auch
die beiden werden am Landesentscheid teilnehmen.
Den
hohen Stellenwert des Berufswettbewerbs machten auch
zahlreiche Gäste aus dem landwirtschaftlichen Umfeld
deutlich, die nicht nur zur Siegerehrung, sondern
teilweise bereits während des Wettbewerbs in die
Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks
Oberfranken gekommen waren, um den jungen Leuten
über die Schulter zu blicken. Sie alle bezeichneten
den Berufswettbewerb als wichtiges Ereignis für den
Bauernstand. Bezirksbäuerin Beate Opel bescheinigte
allen Teilnehmern, dass sie eindrucksvoll unter
Beweis gestellt hätten, wie kreativ und interessant
der Beruf des Landwirts ist. Keine Branche sei so
technisiert und digitalisiert, wie die
Landwirtschaft, auch das möchte man mit dem
Wettbewerb aufzeigen, so BBV-Direktor Wilhelm
Böhmer.
Der
Berufswettbewerb findet traditionell alle zwei Jahre
statt. Diesmal stand der unter dem Motto „Grüne
Berufe sind voller Leben: Zukunft gestalten, Talente
entfalten“.
Bilder:
1. Diese
Teilnehmer mussten die verschiedensten Sämereien
bestimmen.
2. Einen
Hindernisparcours mit dem Schlepper inklusive
Anhänger und Ladung zu durchfahren war eine der
Aufgaben im Praxisteil des Berufswettbewerbs.
3. Einen
Traktor im Hinblick auf seine Betriebs- und
Verkehrssicherheit überprüfen mussten die Teilnehmer
des Berufswettbewerbs der Landjugend.
4. 20
Mängel waren in diesen Schlepper eingebaut. Für die
meisten Teilnehmer war es kein Problem, die Fehler
innerhalb der vorgegebenen Zeit zu erkennen.
„Wohlfühl-Stil und Wow-Effekt“: Landfrauen auf dem Catwalk / Modenschau beim Hofer Landfrauentag
Köditz.
Farb-, Typ- und Stilberatung statt endlos langer
Reden und langweiligen Vorträgen: Mit ihrem
Landfrauenabend beschreitet die Kreisvorstandschaft
der Hofer Landfrauen schon seit Jahren neue Wege.
Diesmal stellten sie eine Modenschau auf die Beine,
bei der die regionalen Hersteller hochwertiger
Damenmode, die Modelabels Frank Walder und Tuzzi,
ihre aktuellen Kollektionen vorstellten. Auf
hochbezahlte Models hatte man dabei verzichtet. Mit
Stil, viel Charme und auch mit Witz nahmen die
Landfrauen die Sache selbst in die Hand. Sogar
Kreisbäuerin Elke Browa war auf dem Laufsteg zu
erleben.
Zuvor hatten allerdings doch einige Redner das Mikrofon ergriffen und in launigen und kurzweiligen Grußworten die Arbeit der Landfrauen gewürdigt. Allen voran Landrat Oliver Bär: „Es ist schön, dass es euch gibt, ihr seid sehr wertvoll für die Region“, sagte er und bedankte sich für das große Engagement der Landfrauen im Landkreis. Auch die Kulmbacher kreis- und oberfränkische Bezirksbäuerin Beate Opel bezeichnete die Hofer Landfrauen als „starkes Team mit vielen Ideen und Visionen. „Wir Landfrauen sind authentisch und schaffen es, andere zum Mitmachen zu bewegen.
Beate Opel erinnerte auch an die Bauernproteste vor gut einem Jahr. Wenn auch nicht alle Forderungen umgesetzt wurden, so sei es doch einmal höchste zeit gewesen, auf die Straße zu gehen. „Die Leute standen hinter uns, und zwar noch viel mehr, als wir eigentlich gedacht hatten. Zumindest die Agrardieselrückvergütung werde in voller Höhe kommen, versprach der neu gewählte Hofer Bundestagsabgeordnete Heiko Hain. Landfrauen ließen sich stets etwas besonderes einfallen und so sei jeder er 15 Landfrauentage und -abende, die er als Bürgermeister von Ködnitz begleiten durfte, etwas Besonderes gewesen, so Matthias Beyer.
Bevor
Kreisbäuerin Elke Browa den Laufsteg betrat,
richtete sie noch einen dringenden Apell an ihre
Berufskolleginnen: „Lasst euch für die
Kommunalwahlen aufstellen und in die entsprechenden
Gremien wählen“, sagte sie mit Blick auf den März
2026. An diesem Tag werden die neuen Stadt- und
Gemeinderäte sowie Kreistage gewählt. „Demokratie
lebt vom Mitmachen“, sagte sie und augenzwinkernd
fügte sie an: „Mit Mädels wird es sowieso viel
harmonischer funktionieren.“
Werbung für den einsemestrigen Studiengang Hauswirtschaft machte Silke Braunmiller vom Landwirtschaftsamt Bayreuth-Münchberg. Am Standort Münchberg laufe der Studiengang aktuell, am Standort Bayreuth soll Anfang Oktober ein neues Semester starten. „Hauswirtschaftliche Fachkräfte werden derzeit nicht nur dringend gebraucht, sie werden auch gut bezahlt“, sagte Silke Braunmiller.
Um passende Farben, individuelle Farbtypen, die richtigen Farbkombinationen, den Wohlfühl-Stil und den „Wow“-Effekt ging es bei der Vorstellung von Susanne Tschampel aus Marxgrün. Was wären Landfrauentage und -abende ohne Landfrauenchor. Unter der bewährten Leitung von Helmut Lottes sang der preisgekrönte Chor unter anderem Song von Abba und von den Byrds.
Bilder:
1. Kein
Landfrauenabend ohne Landfrauenchor: Unter der
Leitung von Helmut Lottes sangen die Damen aus dem
Hofer Land moderne Songs unter anderem von Abba und
von den Byrds.
2. Landfrauen
auf dem Laufsteg: zusammen mit ihren
Berufskolleginnen zeigte die Hofer Kreisbäuerin Elke
Browa aktuelle Modetrends.
Glaube, Sprache und Traditionen statt Egoismus, / Adrian Roßner beim Wunsiedler Landfrauentag in Weißenstadt
Weißenstadt.
Weg mit dem Egoismus, hin zu Besinnung auf
gemeinsame Werte. Das ist es, was unsere
Gesellschaft zusammenhalten kann. Im ländlichen Raum
ist das nichts Besonderes, denn da seien gemeinsame
Werte schon immer hochgehalten worden, sagte Adrian
Roßner beim Landfrauentag im vollbesetzten
Kurzentrum von Weißenstadt. „Hier lebt man im
Miteinander, hier setzt man sich füreinander ein und
hier kümmert sich der eine noch um den anderen“, so
der promovierte Historiker aus dem Fichtelgebirge.
Nicht immer ganz so ernst ging es beim Vortrag von Adrian Roßner zu. Der Wissenschaftler ist unter anderem am Institut für Fränkische Landesgeschichte, eine gemeinsame Einrichtung der Universitäten Bamberg und Bayreuth mit Sitz in Thurnau, tätig. Einem breiten Publikum ist er auch durch seine regelmäßige Rubrik „Adrians G`schichtla“ im Bayerischen Fernsehen bekannt. Er berichtete launig und in fröhlich fränkischer Mundart vom Leben auf dem Dorf. Er riss Witze, hatte aber auch tiefgründige Informationen parat. Denn auch ihn beschäftigten die einen oder anderen negativen gesellschaftlichen Entwicklungen.
Viele
Menschen hätten angefangen, sich mehr du mehr zu
entfernen. Damit sei Platz geworden für Egoismus
„Doch Egoismus ist Gift“, so Adrian Roßner. Unser
gesamtes Zusammenleben könne nur mit Werten
funktionieren, die aber vielfach verloren gegangen
seien. Dazu gehörten auch Dinge wie der Glaube, eine
gemeinsame Sprache, Traditionen wie Kerwas,
Maibaumaufstellen, Wiegenfeste und als Anker das
Wirtshaus und die Kirche.
„Es gibt noch wahnsinnig viel zu tun, um unsere Höfe gut in die Zukunft zu bringen“, sagte Kreisbäuerin Karin Reichel zuvor. Über die zurückliegenden Bundestagswahlen zog sie ein gemischtes Fazit. Zum einen könne man froh sein, dass die Landwirtschaft nicht wieder für alles herhalten musste, zum anderen seien die Bauern doch wieder ein Thema gewesen und von einigen Parteien auf Plakaten verunglimpft worden. „Da müssen noch dicke Bretter gebohrt werden“, so Karin Reichel.
In
einer Grußwortrunde hatten einige der Ehrengäste die
Gelegenheit, in wenigen Sätzen ihre Gedanken zum
Zusammenhalt der Gesellschaft zum Besten zu geben.
Gleichwertige Lebensverhältnisse, dann könnten sich
die Menschen auch auf Augenhöhe begegnen, lautete
das Rezept des neuen CSU-Bundestagsabgeordneten
Heiko Hain. Man benötige die entsprechenden
Entscheidungen dazu in Berlin, sagte
Finanzstaatssekretär Martin Schöffel. Wer arbeitet
müsse mehr haben als derjenige, der nicht arbeitet,
so Schöffel. Und wer einen landwirtschaftlichen
Betrieb führt, dürfe nicht mit Bürokratie
zugeschüttet werden.
Auf die Vereine, Verbände und Organisationen vor Ort hören, deren Probleme aufnehmen und an die entsprechenden Stellen weitergeben, das will der Weißenstädter Bürgermeister Matthias Beck. Auch die Landwirtschaftsämter würden, beispielsweise durch die Ausbildung von Hauswirtschafterinnen dazu beitragen, Gesellschaft und Landwirtschaft zusammenzubringen, sagte Andrea Eckl vom Amt in Münchberg. „Auf dem Dorf, da kennt man sich“, so die Kulmbacher Kreis- und oberfränkische Bezirksbäuerin Beate Opel. Ihren Worten zufolge habe auch das Erwachsenenbildungsprogramm der Landfrauen großen Anteil daran, Menschen zusammenzubringen. Alles Wesentliche im Leben könne nicht herbeireguliert werden, sondern sei uns immer nur geschenkt, so der Wunsiedler Dekan Peter Bauer.
Der Landfrauentag wurde erstmals umrahmt von einem großen „Projektchor“, in dem sich die „Sechsämtermoila“, so heißt der Landfrauenchor in Wunsiedel, mit dem Gesangverein Spielberg zusammengetan hatte. Nach der Pause stand eine ungewöhnliche Modenschau zum Thema Dessous unter der Regie von Elfriede Kraus und Silvia Spieler auf dem Programm. Dabei ging es nicht unbedingt immer ernst gemeint darum, wie sich die (Unter-)Wäsche im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat, von zweckmäßig bis reizvoll.
Bilder:
1. Der
Wunsiedler Landfrauentag wurde von einem großen
„Projektchor“, in dem sich die „Sechsämtermoila“ mit
dem Gesangverein Spielberg zusammengetan hatten,
umrahmt.
2. Heimatforscher
und Historiker: Adrian Roßner berichtete in
humorvoller Art und Weise vom Zusammenleben auf dem
Land.
3. Kreisbäuerin
Karin Reichel (rechts) und ihre Stellvertreterin
Nicole Orschulok bedankten sich beim Referenten, dem
TV-bekannten Heimatforscher Adrian Roßner aus dem
Fichtelgebirge.
Nicht unterkriegen lassen und selbstbewusst auftreten / Regierung von Oberfranken verabschiedete 14 frischgebackene Meister der Landwirtschaft
Bayreuth.
14 junge Leute aus allen Teilen Oberfrankens haben
ihre Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister
erfolgreich bestanden. Aus den Händen von
Regierungspräsident Florian Luderschmid erhielten
die 10 Männer und vier Frauen ihre Zeugnisse. „Sie
sind auf der höchsten Stufe der Fortbildung im
praktischen Bereich angekommen“, sagte Luderschmid.
Der Regierungspräsident appellierte an die
frischgebackenen Meister, neben all den großen
Herausforderungen wie Sicherung der
Ernährungssouveränität, Versorgung mit regenerativer
Energie, Ressourcen und Artenschutz immer auch den
Dialog mit dem Verbraucher im Blick zu haben.
„Bildlich gesprochen fahren sie heute ihre Ernte ein“, sagte Florian Luderschmid zu den frischgebackenen Meistern. Der Regierungspräsident appellierte an die jungen Leute, stets im Dialog mit der Gesellschaft zu bleiben, um Verständnis zu werben und sich politisch einzubringen. Außerdem gab er den Absolventen mit auf den Weg, sich auf eine lebenslange Weiterbildung einzustellen. Der Meisterbrief sei zwar ein gewaltiges Ziel gewesen, doch er werde nicht das Ende in Sachen Bildung sein.
Festredner der Meisterfeier in den Räumen der Regierung von Oberfranken in Bayreuth war Adrian Roßner vom Institut für Fränkische Landesgeschichte, eine gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der Universitäten Bamberg und Bayreuth mit Sitz in Thurnau. Roßner ist einem breiten Publikum auch durch seine regelmäßige Rubrik „Adrians G`schichtla“ im Bayerischen Fernsehen bekannt. Landwirtschaft, das sei viel mehr als Nahrungsmittelerzeugung, sagte er. „Sie pflegen unsere Heimat, unsere Bräuche und unsere Kulturlandschaft.“ An die künftigen Landwirtschaftsmeister appellierte er: „Lassen sie sich nicht unterkriegen und treten sie selbstbewusst auf.
Im Namen der oberfränkischen Landräte gratulierte der stellvertretende Bayreuther Landkreischef Klaus Bauer den jungen Leuten. „Sie sind es, die unsere Wirtschaft am Laufen halten“, zollte er den Absolventen Respekt und Anerkennung. Klaus Bauer stellte aber auch fest, dass seit Corona das Ansehen der Landwirte wieder gestiegen sei. Viele Menschen hätten erkannt, wie wichtig die Selbstversorgung mit qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln für unser Land ist.
Zuletzt
hatte auch Matthias Roder, der Vorsitzende des
Meisterprüfungsausschusses einige Ratschläge parat:
„Bringen sie Beruf und Beziehung in die richtige
Balance“, sagte er. Den Eltern der künftigen Meister
gab Roder mit auf den Weg, den jungen Leuten Raum zu
geben, damit sie sich entwickeln könnten. „Versuchen
sie immer, gemeinsam die beste Lösung zu finden.“
Als Prüfungsbeste wurden Frank Schwarz aus Hiltpoltstein im Landkreis Forchheim, Marie Dippold aus Aufseß im Landkreis Bayreuth und Johanna Rieger aus Helmbrechts im Landkreis Hof ausgezeichnet.
Nach einem Jahr praktischer Tätigkeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb besuchten die Absolventen für drei Semester die Landwirtschaftsschule. Anschließend bereiteten sie sich während eines weiteren Jahres mit berufsbegleitenden Lehrgängen auf die Abschlussprüfung zum Landwirtschaftsmeister vor. Inhalte der Meisterprüfung waren unter anderem der Vergleich und die Bewertung von Produktionsverfahren bei der pflanzlichen oder tierischen Erzeugung anhand eines zwölf Monate dauernden praktischen Arbeitsprojekts, die Analyse und Beurteilung eines fremden Betriebes sowie eine praktische Arbeitsunterweisung.
Die folgenden frischgebackenen Landwirtschaftsmeister haben ihre Urkunden erhalten:
Aus dem Landkreis Bayreuth: Marie Dippold (Aufseß), Luca Ehl (Goldkronach), Florian Hauenstein und Tobias Pfaffenberger (beide aus Mistelgau) und Andreas Schüpferling (Betzenstein.
Aus dem Landkreis Coburg: Hannes Kempf aus Grub am Forst.
Aus dem Landkreis Forchheim: Frank Schwarz aus Hiltpoltstein.
Aus dem Landkreis Hof: Johanna Rieger (Helmbrechts), Lena Eckardt (Konradsreuth), Jonas Ross (Münchberg) und Robert Sachs (Schauenstein).
Aus dem Landkreis Kulmbach: Simon Raab (Mainleus) und Franziska Wiener (Himmelkron).
Aus dem Landkreis Wunsiedel: Hans Katholing (Marktredwitz).
Bilder:
1. Als Jahrgangsbeste wurden Johanna Rieger, Marie
Dippold und Frank Schwarz ausgezeichnet. Links im
Bild Regierungspräsident Florian Luderschmid, recht
der Vorsitzende des Meisterprüfungsausschusses
Matthias Roder
2. 14 Landwirte aus allen Teilen Oberfrankens, zehn
Herren und vier Damen, haben ihren Meisterbrief
erhalten.
Weniger Betriebshilfe, mehr Maschinenvermittlung / MR Wunsiedel: Stabile Zahlen auf hohem Niveau
Höchstädt.
Nach den immensen Steigerungen im zurückliegenden
Jahr haben sich die Zahlen beim Maschinen- und
Betriebshilfsring Wunsiedel in sämtlichen
Tätigkeitsfeldern auf hohem Niveau eingependelt.
Waren die geleisteten Stunden in der Betriebshilfe
geringfügig zurückgegangen, konnten die
Maschinenvermittlung und die Landschaftspflege
leicht zulegen. Der Verrechnungswert war um drei
Prozent auf gut 3,5 Millionen Euro angestiegen.
Auch diesmal stellte Vorsitzender Martin Goldschald das zurückliegende Jahr unter das Motto „Wirtschaften in turbulenten Zeiten.“ Große Hoffnungen setzte er auf eine neue Bundesregierung und deren Ankündigungen auf eine Wiedereinführung er Dieselrückerstattung, auf die Umsetzung einer Unternehmenssteuerreform, von der auch Landwirte profitieren, und auf den immer wieder geforderten Bürokratieabbau. Die angekündigte Anhebung des Mindestlohns und die Ausweitung von Freihandelsabkommen sehe die Landwirtschaft dagegen eher skeptisch.
Wie wichtig die Arbeit des Maschinenrings ist, zeigten die konkreten Zahlen aus dem Geschäftsbericht. Da ist einmal die Betriebshilfe, bei der die Einsatzstunden zwar um gut 1000 auf 21865 zurückgegangen waren. Dazu muss man allerdings auch wissen, dass das zurückliegende Jahr so etwas wie in Rekordjahr war, so Geschäftsführer Andreas Hager. Über 16000 Stunden entfallen dabei auf die soziale Betriebshilfe, die immer dann notwendig wird, wenn zum Beispiel ein Betriebsleiter erkrankt, einen Unfall hat, wegen einer Operation außer Gefecht ist oder zur Kur muss. Knapp 6000 Stunden macht die wirtschaftliche Betriebshilfe, meist zur Abdeckung von Arbeitsspitzen aus.
Um fünf Prozent auf einen Verrechnungswert von rund 2,5 Millionen Euro angestiegen war dagegen die Maschinenvermittlung, das zweite klassische Tätigkeitsfeld der Maschinenringe. Stärkste Bereiche waren dabei die Futter- und Strohernte, die Körnerernte aber auch ganz allgemein der Einsatz von Schleppern und Hängern zum Transport. Der gesamte Verrechnungswert in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro setzt sich aus der Maschinenvermittlung, der Betriebshilfe und auch aus den Leistungen für den Landschaftspflegeverband zusammen. In der Landschaftspflege wurden nach den Worten des Geschäftsführers rund 100 Einzelmaßnahmen von 50 beteiligten Landwirten mit einem Umsatz von knapp 140000 Euro durchgeführt.
Der gewerbliche Bereich ist beim Maschinenring in die MR Hochfranken GmbH ausgegliedert. Die Tochtergesellschaft kümmert sich um den Winterdienst, die Baumpflege, umweltschonende Mäharbeiten und um die Trassenpflege für das Bayernwerk entlang der 20-KV- und der Nebenspannungsleitungen. Die gewerbliche Tochter übernimmt auch die Pflege von Sportplätzen und sie ist an der Holzenergie Hochfranken beteiligt, die in Weißenstadt dien Therme beheizt.
Nach den Worten des 1. Vorsitzenden Andreas Goldschald hat der Maschinenring Wunsiedel aktuell exakt 594 Mitglieder. 20 Neuzugängen standen 17 Austritte gegenüber. Alle Mitglieder zusammen bewirtschaften eine Fläche von unverändert 22418 Hektar. Mit Sandra Dornhöfer, Jürgen Goßler und Toni Pößl wurden bei der Jahresversammlung auch die drei Betriebshelfer geehrt, die im zurückliegenden Jahr die meisten Stunden geleistet hatten.
Bild: Der Maschinen- und Betriebshilfsring Wunsiedel hat seine stundenstärksten Betriebshelfer geehrt Im Bild von links: Matthias Benker vom Maschinenring, die Betriebshelfer Jürgen Goßler, Toni Pößl, Sandra Dörnhöfer, Vorsitzender Martin Goldschald und Geschäftsführer Andreas Hager.
Weniger Mitglieder, mehr Fläche / Prekäre Personalsituation beim Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach
Kulmbach.
Die angespannte Personalsituation beim Maschinen-
und Betriebshilfsring Kulmbach zog sich wie ein
roter Faden durch die Jahreshauptversammlung.
„Unsere Kernaufgabe ist es, die Betriebshilfe
gemeinsam zu organisieren und sicherzustellen“,
sagte der Vorsitzende Andreas Textores. Die
Sicherstellung werde allerdings immer schwieriger.
Man habe sogar schon Einsätze ablehnen müssen, so
Geschäftsführer Alexander Hollweg.
Ein Phänomen sei es, dass die Einsätze zwar nicht weniger werden, aber dafür immer länger dauerten. Alexander Hollweg berichtete von einem landwirtschaftlichen Betrieb im Landkreis, bei dem gleich drei Mann durch Krankheiten und Unfälle ausgefallen sind. In einem solchen Fall stoße auch der Maschinenring an seine Grenzen.
Dem Jahresbericht zufolge waren die Einsatzstunden in der sozialen Betriebshilfe angestiegen, die Stunden in der wirtschaftlichen Betriebshilfe zurückgegangen. Waren es im Jahr zuvor noch 16.508 Stunden soziale Betriebshilfe, so kommen die Verantwortlichen für 2024 nur mehr auf 19.239 Stunden. Soziale Betriebshilfe wird immer dann notwendig, wenn beispielsweise ein Landwirt erkrankt, einen Unfall hat, zu einer Reha-Maßnahme oder zur Kur muss. In der wirtschaftlichen Betriebshilfe, also zur Abdeckung von Arbeitsspitzen, sank die Zahl der erbrachten Stunden von 4.410 auf 2.671.
Ähnlich prekär ist die Personalsituation bei den Klauenpflegern, eine Dienstleistung, die der Maschinenring über seine gewerbliche Tochterfirma, der MR Oberfranken Mitte in Zusammenarbeit mit den Nachbarringen Bayreuth und Fränkische Schweiz anbietet. „Wir können keine Aufträge mehr annehmen, weil uns die Leute fehlen“, so Alexander Hollweg, Ähnlich problematisch gestalte sich die Situation beim Winterdienst oder bei der Grünflächenpflege. „Wir suchen ständig Leute“, so der Geschäftsführer. Bezahlt werde pauschal, wer Lust und Zeit hat sollte sich umgehend beim Maschinenring melden. Insgesamt sind in der MR Oberfranken Mitte 170 Landwirte aus den drei Ringen Bayreuth, Kulmbach und Fränkische Schweiz tätig.
Der Verrechnungswert aller erbrachten Leistungen wird auf 4,2 Millionen Euro beziffert, im Vorjahr waren es 4,4 Millionen Euro. Obwohl die Zahl der Mitglieder zurückgegangen ist, war die bewirtschaftete Fläche größer geworden. Der Maschinenring Kulmbach hat aktuell 807 Mitglieder, 18 weniger als im Jahr zuvor. Sie alle bewirtschaften zusammen eine Fläche von 27.173 Hektar, im Jahr davor waren es noch 26.692 Hektar.
Ebenfalls leicht zurückgegangen war der zweite wesentliche Aufgabenbereich des Rings, die Vermittlung von Maschinen. Hier schlugen im Wesentlichen die Futter- und Strohernte, das weite Feld der Landschaftspflege sowie die Körnerernte und -aufbereitung zu Buche. Darüber hinaus sieht sich der Maschinenring immer mehr auch als Beratungszentrum, wie es Geschäftsführer Alexander Hollweg bezeichnete. Das weite Feld der Tätigkeit reiche von der Düngeberatung über Futteranalysen bis hin zu Sammeleinkäufen für Diesel und Heizöl oder Silofoliensammlung, die heuer auf den 20. und 21. Mai terminiert ist.
Bei der Jahreshauptversammlung stellte der Vorsitzende auch erste Pläne für einen Umzug des Büros vor. Zusammen mit dem MR Oberfranken Mitte plant der Ring von seinen jetzigen Räumen in der Konrad-Adenauer-Straße 4 in die Von-Linde-Straße 13 in die Räume einer ehemaligen Autowerkstatt Dort sollen künftig auch die auf derzeit auf Betriebe im gesamten Landkreis untergestellten Maschinen untergebracht und Lagerräume errichtet werden. Die Planungen dafür stehen allerdings noch am Anfang, so dass es noch keinen Termin für einen Umzug gibt.
Bei der Jahreshauptversammlung wurden drei Betriebshelfer geehrt, die im zurückliegenden Jahr die meisten Einsatzstunden absolviert hatten: Astrid Masel aus Großenhüll mit 1178 Stunden, Peter Hübner aus Krumme Fohre mit 714 Stunden und Thomas Kraß aus Guttenberg mit 711 Stunden.
Bild: Ehrung für die Betriebshelfer mit den meisten Einsatzstunden (von links): der stellvertretende Vorsitzende Hans Herrmann Reinhardt, Geschäftsführer Alexander Hollweg sowie die Betriebshelfer Astrid Masel und Thomas Kraß. Peter Hübner war bei der Versammlung verhindert.
„Bildung bewegt“: Landfrauen als bedeutendster Bildungsträger in Bayern / Stellvertretender BBV-Präsident Ely Eibisch beim Kulmbacher Landfrauentag
Stadtsteinach.
Bildung ist diesmal das Jahresthema der
Landfrauenarbeit im Bauernverband. So zog sich das
Thema auch wie ein roter Faden durch den Kulmbacher
Landfrauentag am Sonntagnachmittag in der
Steinachtalhalle. Für den kurzfristig erkrankten
BBV-Präsidenten Günther Felßner war dessen
Stellvertreter Ely Eibisch aus Kaibitz bei Kemnath
im Landkreis Tirschenreuth eingesprungen.
„Landwirtschaft ist der Beruf, der am meisten Bildung voraussetzt“, sagte Ely Eibisch. Von der Lehre bis zur Höheren Landbauschule, beziehungsweise zum Studium könnten da schon einmal sieben bis acht Jahre vergehen. Aber auch im Erwachsenenalter spiele Bildung eine immens wichtige Rolle. Hier kämen die Landfrauen ins Spiel, denn der Bauernverband ist nach den Worten des stellvertretenden Präsidenten die größte und wohl auch die beste Erwachsenenbildungseinrichtung im Freistaat. Selbs Lehrkräfte an weiterführenden Schulen wüssten oft nichts mit landwirtschaftlichen Themen anzufangen und gingen von völlig falschen Voraussetzungen oder von Klischees aus. „Deshalb ist Erwachsenenbildung so wichtig“, sagte Ely Eibisch.
Die
Landwirtschaft steht nach den Worten von Ely Eibisch
für Bioökonomie, Biodiversität, für Energieerzeugung
und für Nahrungsmittelsicherheit. Besonders die
Bedeutung der Nahrungsmittelsicherheit sollte man
immer wieder vor Augen führen, so der Landwirt, der
einen 85 Hektar großen Betrieb bewirtschaftet, sich
besonders im Bereich der erneuerbaren Energien
engagiert und der auch Mitglied des Kemnather
Stadtrates und des Tirschenreuther Kreistages ist.
Ein Land, das sich nicht selbst mit Nahrungsmitteln
versorgen kann, sei abhängig, erpressbar und werde
schnell instabil, gab er zu bedenken.
„Bildung bewegt vieles“, zitierte die Kulmbacher Kreis- und oberfränkische Bezirksbäuerin Beate Opel das Jahresthema der Landfrauen. Bildung sei aber auch stets präsent. Von Gymnastikkursen bis zu den verschiedensten Lehrfahrten, von Smartphone-Schulungen bis zur Erntedankfeier und von Kochkursen bis zum „Bayerischen Superfood“ reichte die Palette der Weiterbildungsangebote im Kulmbacher Land. Die Landfrauen hätten schnell erkannt, dass Bildungsarbeit weit über die Vermittlung von Wissen hinaus geht und auch, dass alle Menschen Zugang zur Bildung haben sollen, unabhängig vom Alter und vom Wohnort. Um Bildung geht es auch beim Kenia-Projekt der Landfrauen. Beate Opel war erst vor wenigen Wochen aus dem afrikanischen Land wieder zurückgekehrt, mit dem die bayerischen Bäuerinnen eine gegenseitig befruchtende Partnerschaft unterhalten.
Als
Rückgrat der bäuerlichen Betriebe bezeichnete der
Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig (Freie Wähler) die
Landfrauen. „Sie gestalten das Leben in vielfältiger
Art und Weise mit“, sagte er und würdigte die
wertvolle und unverzichtbare Arbeit der Landfrauen
für den Berufsstand und für die Gesellschaft. Rainer
Ludwig sprach aber auch den tiefgreifenden
Strukturwandel an, in dem sich die Landwirtschaft
derzeit befinde. Zahlreiche aktuelle Auflagen wie
etwa die überbordende Bürokratie und unverständliche
regulatorische Maßnahmen brächten den gesamten
Berufsstand an die grenzen der Umsetzbarkeit.
Der Landfrauentag wurde umrahmt von fröhlichen und auch nachdenklichen Schlagern, die der neue Kulmbacher Landfrauenchor unter der Leitung von Irmtraud Tröger-Franz zum Besten gab, und einer ungewöhnlichen Modenschau zum Thema Dessous unter der Regie von Elfriede Kraus und Silvia Spieler. Dabei ging es vor allem darum, wie sich die (Unter-)Wäsche im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entwickelt hat.
Bilder:
1. Sie
trafen sich beim Kulmbacher Landfrauentag in
Stadtsteinach (von links): der Landtagsabgeordnete
Rainer Ludwig, die stellvertretende Kreisbäuerin
Gudrun Passing, Landrat Klaus Peter Söllner, der
stellvertretende bayerische BBV-Präsident Ely
Eibisch, Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel und
der Stadtsteinacher Bürgermeister Roland Wolfrum.
2. Von
„Wochenend und Sonnenschein“ bis „Ein bisschen
Frieden“: Der Kulmbacher Landfrauenchor unter der
Leitung von Irmtraud Tröger-Franz sang fröhliche und
nachdenkliche Schlager.
3. Statt
des ursprünglich angekündigten BBV-Präsidenten
Günther Felßner konnte Kreis- und Bezirksbäuerin
Beate Opel dessen Stellvertreter Ely Eibisch
begrüßen.
Erfolgreiche Holzvermarktung trotz Ziegler-Insolvenz / WBV Bayreuth übernimmt Ausfälle bei Holzlieferanten – 2700 voll beladene Lkw mit Holz aus dem Bayreuther Land
Bayreuth. Die Mitglieder der Waldbesitzervereinigung Bayreuth kommen nach der Insolvenz der Ziegler-Gruppe mit einem blauen Auge davon. Bei der Jahresversammlung haben die Mitglieder ohne Gegenstimme beschlossen, dass der Teil der Ausfälle, der nicht durch Versicherungen abgedeckt ist, von der WBV übernommen wird. Fast 100 Holzlieferanten aus dem Bayreuther Land sind dabei betroffen. Um welche Summen es geht, wurde nicht bekannt.
Die Ziegler Forstservice GmbH (ZFS), die 48 Einzelfirmen unter ihrem Dach vereint und ihren Sitz im oberpfälzischen Plößberg) Landkreis Tirschenreuth) hat, musste am 28. November überraschend einen Insolvenzantrag stellen. Das größte Sägewerk Europas und Flaggschiff der bayerischen und deutschen Holzindustrie war in den zurückliegenden Jahren regelmäßig der stärkste Abnehmer vom Holz der Waldbauern aus dem Raum Bayreuth. Noch im vergangenen Jahr hatte die WBV bis zur Insolvenz 22349 Festmeter Holz an die ZFS geliefert.
„Wir waren mit Ziegler eigentlich immer sehr zufrieden“, sagte Geschäftsführer Gerhard Potzel. Bis zur Insolvenz sei das Unternehmen nie im Zahlungsrückstand gewesen. „Die haben stets pünktlich gezahlt, alles ist immer bestens gelaufen“, so der Geschäftsführer. Um so überraschender dann der Insolvenzantrag am 28. November. Mittlerweile sei auch das Insolvenzverfahren eröffnet worden.
Nun ist es so, dass sämtliche Holzlieferungen gut versichert sind. Die WBV geht davon aus, bis April das Geld von der Versicherung zu bekommen. „Jedoch nicht die komplette Ausfallsumme. Deshalb hatten die Verantwortlichen beschlossen, die Differenz zwischen dem Vertrag, den die Versicherung erstattet und dem geltend gemachten Rechnungsbetrag aus der Kasse zu erstatten.
Das werde die Dachorganisation der Waldbesitzer im Regierungsbezirk, die Forstwirtschaftliche Vereinigung Oberfranken allen WBVen so auch empfehlen, sagte der FVO-Vorsitzende Wolfgang Schultheiß aus dem Coburger Land. Von ihm war zu erfahren, dass Oberfrankenweit rund 500 Rechnungen offen seien und die Versicherungen rund 90 Prozent der Ausfälle übernehmen.
In mehreren Berichten ist die Rede davon, dass die Ziegler-Grup insgesamt mehr als 800 Millionen Euro Schulden haben soll. Das Unternehmen hatte zuletzt über 3000 Mitarbeiter in den 48 formell eigenständigen Gesellschaften.
Abgesehen von der Hiobsbotschaft der Ziegler-Insolvenz sei das zurückliegende Jahr aus Sicht der WBV aber dennoch recht zufriedenstellen verlaufen. Insgesamt hatte de WBV im Auftrag ihrer Mitglieder über 70500 Festmeter Holz vermarktet. Nach den Worten von Gerhard Potzel sind dies über 2700 Lkw voll beladen mit Holz aus dem Bayreuther Land oder anders ausgedrückt, zehn volle Lkw täglich.
Im Vergleich zum Vorjahr mit über 100000 vermarkteten Festmetern bedeutet die Zahl zwar einen Rückgang, doch muss man wissen, dass im Vorjahr fast ausschließlich Schadholz infolge des Borkenkäfers angefallen war. Im zurückliegenden Jahr sei der Käfer nicht so stark aufgetreten, da die Wasserversorgung gut war und insgesamt acht Harvester dafür sorgten, Schadholz so schnell wie möglich aus dem Wald zu bekommen.
Ein gutes Zeichen ist es auch, dass der Waldumbau voranschreitet. 62000 Festmeter von den über 70000 Festmetern waren Fichtenholz, weitere 5000 Festmeter Kiefernholz, also alles Nadelhölzer. Gleichzeitig wurde bei den alljährlich stattfinden Sammelbestellungen über die WBV fast 54000 Pflanzen geordert, 52 Prozent davon Laubhölzer.
Zusammenstehen in Krisensituationen, das spreche für die Gemeinschaft innerhalb der WBV, sagte Finanz- und Heimatstaatssekretär Martin Schöffel. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Forstpolitik nach dem Ergebnis der Bundestagswahlen jetzt wieder in die richtige Richtung geht. „Die Holzfeinde im Bundesumweltamt dürfen nicht länger das Sagen haben“, so Martin Schöffel. Aktive Waldbewirtschaftung, das bedeutet seinen Worten zufolge besserer Arten-, Heimat- und Klimaschutz sowie optimale Rohstoffsicherung.
Die Arbeit der Waldbesitzer sei vor allem auch ein Wirken für künftige Generationen, so Landrat Florian Wiedemann, der selbst fünf Hektar Wald bewirtschaftet und Mitglied der WBV ist. Erfreulich ist dem Landrat zufolge auch das aktuelle forstliche Gutachten ausgefallen. Waren es vor vier Jahren noch acht Hegegemeinschaften im Landkreis mit zu hohem Verbiss, seien es mittlerweile nur noch fünf Hegegemeinschaften. BBV-Kreisobmann Karl Lappe zeigte sich zuversichtlich, dass grüne Ideologie jetzt keine Chance mehr in der Landwirtschafts- und Forstpolitik haben werde.
Die WBV Bayreuth hat 1891 Mitglieder, die zusammen 9961 Hektar Wald bewirtschaften, Das bedeutet 47 Mitglieder und 251 Hektar mehr als vor Jahresfrist. 24 Mitglieder sind Körperschaften und Stiftungen mit zusammen 1087 Hektar Wald.
Mitarbeiter dringend gesucht / Deutliche Steigerung bei den Einsatzstunden: Maschinen- und Betriebshilfsring Bayreuth-Pegnitz zog positive Bilanz
Bayreuth. In der Landwirtschaft zählt der Zusammenhalt unter den Berufskollegen allen Unkenrufen zum Trotz noch etwas. „In unserem Berufsstand gibt es noch Solidarität“ sagte Johannes Scherm, Geschäftsführer des Maschinenrings Bayreuth-Pegnitz bei der Jahresversammlung in der Tierzuchtklause. Als Beweis nannte er den Großbrand eines Stalles im Bayreuther Stadtteil Wolfsbach am 4. Adventssonntag des zurückliegenden Jahres. Die enorme Hilfsbereitschaft das große Engagement von Freunden, Nachbarn und Berufskollegen sei beeindruckend gewesen, so Johannes Scherm. Er wünschte sich, dass dieser großartigen Einstellung auch im normalen Alltag wieder mehr Gewicht zukommt, auch ohne Notfall. Bei dem Großbrand hatte es glücklicherweise weder verletzte Menschen noch verendete Tiere gegeben.
Zusammenhalt und Zusammenarbeit, das sind auch wichtige Leitlinien für die Maschinenringe. Mit seiner vorgelegten Bilanz spiele der Bayreuther Ring bayernweit im oberen Drittel mit, so der Vorsitzende Reinhard Sendelbeck. „Wir sind sehr gut aufgestellt, um die landwirtschaftlichen Betriebe im Management zu unterstützen.“ Allerdings sucht auch der Maschinenring Personal, beispielsweise in der geschäftsstelle, um zusätzliche Aufgaben bewältigen zu können.
Mit insgesamt 31974 Einsatzstunden der haupt- und nebenberuflichen Betriebshelfer konnte der Vorsitzende eine deutliche Steigerung vermelden. Im Jahr zuvor waren es noch 29729 Stunden. Während die Zahl der sozialen Einsatzstunden um rund 20 Prozent auf 23459 deutlich gesteigert werden konnte, waren die wirtschaftlichen Einsätze um rund 1700 Stunde auf 8515 zurückgegangen. Soziale Einsätze werden in der Regel bei Notfällen notwendig, wenn zum Beispiel der Betriebsleiter erkrankt ist, zur Kur oder Reha musste oder aus sonstigen Gründen ausgefallen ist. Wirtschaftliche Einsätze werden notwendig etwa zur Abdeckung von Arbeitsspitzen in der Erntezeit oder für eine Urlaubsvertretung.
Zweites Standbein des Rings ist die Vermittlung von Maschinen. Futterbau, Strohernte sowie organische Düngung waren dabei die Bereiche, die am häufigsten nachgefragt wurden. Alles zusammen, also in der Summe aller erbrachten Leistungen kam der MR Bayreuth-Pegnitz auf einen Verrechnungswert von knapp 8,35 Millionen Euro. Gegenüber dem Wert von 2023 in Höhe von 8,40 Millionen Euro ist das ein eher unbedeutender Rückgang.
Händeringend nach personal sucht die MR Oberfranken Mitte GmbH, in der die drei Nachbarringe Bayreuth, Kulmbach und Fränkische Schweiz ihre gewerblichen Aktivitäten gebündelt haben. Ureigenste Aufgaben der GmbH sind die Grünanlagenpflege, die Gehölzpflege und der Winterdienst. „Wir würden das alles gerne weiter ausbauen, es scheitert aber am Personal“, sagte MR-Oberfranken-Mitte Geschäftsführer Bernd Müller. Die Tätigkeit sei vor allem für Landwirte interessant, die einen Zuerwerb suchen. Der Maschinenring biete dabei eine breite Palette von Tätigkeiten, übernimmt die komplette Abwicklung und auch die Abrechnung mit dem Kunden. Gesucht seien auch Klauenpfleger und Klauenpflegehelfer, ein weiterer Tätigkeitsbereich, bei dem die MR Oberfranken Mitte ein gefragter Partner ist.
Das Thema Zusammenhalt stellte auch die Bundestagsabgeordnete Silke Launert in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. „Das Wissen darum. Dass man sich auf den anderen verlassen kann, zeichne den ländlichen Raum hier in der Region besonders aus. Dafür stehe auch seit Jahrzehnten der Maschinenring. Er sorge dafür, dass landwirtschaftliche Betriebe effizient arbeiten könnten, sei es durch das Ausleihen von Maschinen, durch Fortbildungen oder durch die Betriebshilfe in Notfällen.
Der Maschinenring Bayreuth Pegnitz hat aktuell 1232 Mitglieder, 35 weniger als im Jahr davor. Sie alle zusammen bewirtschaften eine Fläche von 41039 Hektar.
Nach der Wahl: Hoffen auf Wende für die Landwirtschaft / Carl von Butler beim Bayreuther Bauerntag
Bayreuth.
„Egal was kommt, nie aufgeben“ und „jede Chance
konsequent nutzen“: Diese beiden Empfehlungen hat
der Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbandes
Carl von Butler allen Landwirten ans herz gelegt.
Vor dem Hintergrund einer eher düsteren
weltpolitischen Lage, die Auswirkungen auf jeden
einzelnen landwirtschaftlichen Betrieb vor Ort haben
werde, war der Generalsekretär zum Bayreuther
Bauerntag gekommen, um über nationale und
internationale Herausforderungen zu sprechen und mit
Blick auf eine neue Bundesregierung auch ein wenig
Optimismus zu verbreiten.
In der Land- und Ernährungswirtschaft herrsche Unzufriedenheit und Perspektivlosigkeit. „Wie soll man seinen betrieb aufstellen, so dass ihn die nächste Generation noch weiterführen kann“, das würden sich gerade viele Bauern fragen. Verlässlich Rahmenbedingungen und Hilfe, um einfacher zu finanzieren und investieren zu können, das seien zentrale Forderungen an die Politik. Gerade beim Bau von Ställen sei Investitionssicherheit gefragt.
Auch wenn das geplante Tierschutzgesetzt durch das Ampel-Aus gerade noch verhindert werden konnte, so schrieb Carl von Butler allen Tierschützern ins Stammbuch: „Wenn wir glauben, in Deutschland die Welt retten zu können, dann wandert die Produktion eben in das Ausland ab.“ Wie das konkret aussieht, machte der Generalsekretär am Beispiel der Legehennenhaltung deutlich: Die hierzulande verbotenen Käfige seien in der Ukraine wieder aufgebaut worden. Große Flüssigei-Anteile würden heute aus der Ukraine wieder importiert. „Das interessiert keinen Menschen“, kritisierter Carl von Butler, der von einem unhaltbaren Zustand sprach. Mit Blick auf die immer wieder gefordert Ernährungssicherheit sei so etwas extrem unklug.
Gesamtwirtschaftlich betrachtet, sah Carl von Butler das deutsche Wirtschaftsmodell gescheitert. Mit der billigen Energie aus Russland sei es erst einmal vorbei, China als verlängerte Werkbank sei wohl Geschichte und die USA stehe nicht mehr für die Sicherheit in Europa. „2025 wird die deutsche Wirtschaft erst einmal im Rückwärtsgang fahren“, so der Redner. Damit werde der Etat für die Landwirtschaft sicher auch nicht steigen. Auch wenn die Wirtschaft in Bayern noch so einigermaßen läuft, sei die Automobilindustrie als deren Motor bereits in Stottern geraten.
Der BBV-Generalsekretär hatte auch einen interessanten Vorschlag zur Ankurbelung der Wirtschaft mitgebracht. „20 Prozent Mehrarbeit würden die Binnenkonjunktur ankurbeln“, sagte er. Konkret würde dies statt einer 35-Stunden-Woche eine 42-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich bedeuten.
Zuvor hatte der für den verhinderten Kreisobmann Karl Lappe kurzfristig eingesprungene Stellvertreter Harald Galster seine Hoffnung auf eine Wende in der Landwirtschaft ausgedrückt. Wahlversprechen sind das eine, deren Einhaltung das andere, sagte er. Auch für den stellvertretenden Kreisobmann stand Verlässlichkeit bei der Planung für all seine Berufskollegen an erster Stelle.
Über die große Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft sprach Landrat Florian Wiedemann. Für den Landkreis gehörten die Dachmarke Bayreuther Land mit zwei „Hofläden“ in den großen Edeka-Märkten, sowie der heuer wieder stattfindende Thermenmarkt Obernsees mit einer Vielzahl regionaler Anbieter dazu. „Wir müssen es in die Bevölkerung hinaustragen, dass Fleisch, Milch und Eier in bester Qualität vom Bauern aus der Nachbarschaft kommen, so der Landrat. Auch Oberbürgermeister Thomas Ebersberger warb für Produkte von den Bauern aus dem Bayreuther Land, die es unter anderem auch auf dem Bayreuther Wochenmarkt gebe.
Bild: Einen Korb voller heimischer Produkte aus den Händen des stellvertretenden Kreisobmanns Harald Galster konnte auch Carl von Butler mit ins Generalsekretariat des Bayerischen Bauernverbandes nach München nehmen.
Suchen, finden, retten: Kitzrettung hilft Tierleid zu vermeiden / Gute Erfolgsquote: Landwirte zollen ehrenamtlicher Arbeit großen Respekt
Kulmbach.
Der Schulterschluss zwischen Landwirten und
Kitzrettung funktioniert. Im Kulmbacher Land sogar
beispielhaft. Bei einer gemeinsamen
Infoveranstaltung des Bauernverbandes, des
Maschinenrings, des Rings junger Landwirte und des
VLF, wurde zum einen deutlich, dass die Bauern die
Arbeit der ehrenamtlichen Kitzretter schätzen. Zum
anderen konnten auch die Verantwortlichen der
Kitzrettung eine eindrucksvolle Bilanz vorweisen.
Exakt 101 Rehkitze habe man im zurückliegenden Jahr nach dem Motto „suchen, finden, retten“ vor dem Mähtod bewahren können, sagte Hans Joachim Küfner, Jäger, Jagsaufseher und Vorstand der Kulmbacher Kitzrettung. Der 2022 gegründete Verein habe mittlerweile 60 Mitglieder und sei während der Saison regelmäßig mit drei Drohnen im Einsatz. Ein Rehkitz im hohen Gras auszumachen, das sei meist gar nicht so einfach, sagte Hans Joachim Küfner. Den Landwirten legte er ans Herz, so schnell, wie nur irgendwie möglich nach der Suchaktion zu mähen.
Nützliche Tipps für alle Landwirte hatte Harald Köppel, Geschäftsführer des Bauernverbandes Bayreuth, Kronach, Kulmbach parat. Er zählte sämtliche tierschutzrechtliche Vorgaben auf, aus denen ersichtlich wird, dass die Kitzrettung alles andere als eine Spielerei ist. Laut aktueller Rechtsprechung habe der Landwirt alle nur denkbaren Vorsorgemassnahmen zu treffen, damit es nicht zu einem Zwischenfall komme. Unterlässt es der Bauer und es kommt zu einem Mähtod, dann droht ihm im Wiederholungsfall zumindest theoretisch eine Freiheitsstrafe. „Deshalb muss das Thema auch in die Köpfe rein“, so Harald Köppel. Den Landwirten legte er ans Herz, Jäger und Jagdpächter möglichst immer einzubinden und sofort nach der Suche zu mähen. „Eigentlich müsste das Mähwerk sofort danach kommen, sagte Harald Köppel. Oder noch besser: die Drohne sollte vor dem Mähwerk fliegen.
Großen Respekt zollte Thomas Erlmann, Landwirt aus Waldau, allen Ehrenamtlichen der Kitzrettung. Er arbeite schon seit über sechs Jahren erfolgreich mit der Kitzrettung zusammen. „Die Erfolgsquote sei gut, die Schlagkraft passt“, sagte Thomas Erlmann. Freilich gebe es keine hundertprozentige Garantie, ein Restrisiko bleibe immer, doch die Suche mit der Drohne sei „das Beste, was wir machen können“.
Eine Brotzeit, ein Kaffee und eine Spende sollte für die ehrenamtlichen Helfer der Kitzrettung, die oft schon morgens um vier vor Ort seien, sollte selbstverständlich sein, sagte Thomas Erlmann. Auch beim Infoabend ließen sich die Kulmbacher Bauern nicht lumpen und überreichten dem Verein Kitzrettung Kulmbach einen Scheck über 500 Euro.
Kritik an der Arbeit der Kitzrettung ließ der Vorsitzende Hans Joachim Küfner nicht gelten. Oberstes Ziel sei es, Tierleid zu vermeiden. Für ihn sei es kein Widerspruch, wenn das Tier später irgendwann einmal geschossen und als gesundes und sauberes Lebensmittel Verwendung finde. Zuvor hatte ein Landwirt gefragt, wie es mit der Kitzrettung zusammenpasse, dass aufgrund der hohen Verbissbelastung in den Wäldern vor Ort die Empfehlung ausgesprochen werde, die Abschussquoten zu erhöhen.
Ob bio oder konventionell, Lohnunternehmer oder Jagdpächter, jeder sei von der Thematik irgendwie betroffen, hatte zuvor, Heike Schleicher, Vorsitzende des Vereins landwirtschaftliche Fachbildung, festgestellt. Das Thema sei nicht nur immer wieder aktuell, sondern auch hochemotional. „Wir wollen bei den Landwirten Verständnis wecken und sie für das Thema sensibilisieren.“ Schließlich gehe es auch um das Image der Landwirtschaft.
Alexander Hollweg, Geschäftsführer des Maschinenrings, machte dabei auch deutlich, dass der Mähtod von Rehkitzen schon immer ein Thema war und nicht etwa eine Erfindung der Gegenwart ist. „Das Problem war schon immer bekannt“, sagte er. Doch noch immer würden Teile der Bevölkerung denken, dass Landwirte keine Rücksicht nehmen. Ganz im Gegenteil: Sie hätten das größte Interesse daran, und zwar nicht nur, um einen Imageschaden zu vermeiden. Kommen Teile eines Kitzkadavers ins Futter, könne das für die Kühe tödlich enden. Der Verzehr von kontaminiertem Futter könne zu schweren Vergiftungen führen. Deshalb habe jeder Bauer das ureigenste Interesse daran, die Rehkitze zu retten.
Bild: Landwirte fördern die Arbeit der Kitzrettung: VLF-Vorsitzende Heike Schleicher, Kreisobmann Harald Peetz (2. von links) und der 2. Vorsitzende des Maschinenrings Hans Herrmann Reinhardt (rechts) überreichten Hans Joachim Küfner vom Verein Kitzrettung im Namen der Kulmbacher Landwirte einen Scheck über 500 Euro.
Über 17 Millionen Euro: Weniger Tiere, mehr Umsatz / Rinderzuchtverband Oberfranken zog trotz negativer Rahmenbedingungen positive Bilanz
Bayreuth.
Trotz denkbar ungünstiger Rahmenbedingungen für die
Landwirtschaft in Deutschland und trotz zahlreicher
weltweiter Spannungen hat der Rinderzuchtverband
Oberfranken sein Ergebnis steigern können. Das geht
aus dem Geschäftsbericht hervor, den der Vorsitzende
Georg Hollfelder (Litzendorf) und Zuchtleiter Markus
Schricker (Bayreuth) bei der Jahresversammlung
vorgelegt haben.
Demnach war der Gesamtumsatz von 15,2 auf 17,2 Millionen Euro angestiegen. Die Vermarktungszahlen waren dagegen rückläufig. Waren es im vorigen Geschäftsjahr noch knapp 28000 Tiere, kommt die Bilanz aktuell auf rund 27400 Tiere aller Kategorien (Nutzkälber, Zuchtkälber, Jungrinder, Jungkühe und Bullen). Den größten Teil machten männliche und weibliche Nutzkälber mit zusammen knapp 24000 Tieren aus. Ursache für die Entwicklung sind der Preisanstieg und die hervorragende Marktsituation. „Die Kälberpreise befinden sich mittlerweile in schwindelerregenden Höhen“, sagte Georg Hollfelder. Das Geschäftsjahr des Rinderzuchtverbandes ist nicht identisch mit dem Kalenderjahr. Es beginnt immer am 1. Oktober und endet am 30. September.
Allerdings geht die Milchviehhaltung insgesamt betrachtet dramatisch zurück. Oberfrankenweit habe die Zahl der Milchkühe in den zurückliegenden zehn Jahren um 10000 abgenommen, sagte Zuchtleiter Markus Schricker. Im Regierungsbezirk war die Zahl der Betriebe um 33 auf 891 und die Zahl der Tiere um 1573 auf 61612 zurückgegangen. Blicke man zehn Jahre zurück, so hätten seit 2014 im Regierungsbezirk 1188 Milchviehbetriebe mit rund 16000 Kühen aufgegeben.
In vielen Ortschaften gebe es keinen einzigen Bauern mehr, sagte der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann. Deshalb sei es für die Landwirte umso wichtiger, mit ihren Anliegen an die Öffentlichkeit zu gehen. Schließlich dürfe sich Oberfranken nur deshalb Genussregion nennen, weil es die Bauern gibt. Zwei der drängendsten Probleme sprach Hermann Greif, BBV-Bezirkspräsident an. Zum einen habe die Maul- und Klauenseuche einmal mehr gezeigt, wie schnell ein derartiges Thema im Land ist und wie lange es dauert, um es wieder loszuwerden. Zum anderen treibe die rinderhaltenden Biobetriebe derzeit die Pflicht zur Weidehaltung um. Speziell für die Bauern in Franken sei dies aktuell ein Riesenproblem.
Finanz- und Heimatstaatssekretär Martin Schöffel konnte den Landwirten dabei aber wenig Hoffnung machen. Er riet allen Betroffenen, noch einmal die Beratung aufzusuchen. Immerhin habe man bislang erreicht, dass Betroffene, die aus der KULAP-Förderung aussteigen keine Rückzahlungsverpflichtung haben. Zwei Themen stehen bei der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner ganz oben auf der Agenda: Zum einen das Interesse an guten und qualitativ hochwertigen Lebensmitteln, zum anderen die Ernährungssicherheit. „Es darf nicht passieren, dass wir abhängig werden“, sagte sie.
Ein Thema brannte den Rinderhaltern besonders auf den Nägeln. Zum einen sollen wir Weidehaltung betreiben, zum anderen nehmen die Wölfe immer mehr überhand. Wie passt das zusammen?“, so eine Landwirtin aus dem Landkreis Hof. „Das passt gar nicht zusammen“; entgegnete Staatssekretär Martin Schöffel. Er nannte die Dramatik gewaltig, die Wolfspopulation nehme sichtbar zu. Mittlerweile seien sehr hohe Nutztierverluste deutschlandweit bestätigt. „Es muss endlich etwas passieren“, so Schöffel.
Für die höchsten Jahresleistungen wurden die Familie Roth aus Beiersdorf, Christian Popp aus Forthof, die Schamel GbR aus Lenz und Reinhard Stelzner aus Oberthölau ausgezeichnet.
Bild: Auszeichnungen für die besten Jahresleistungen (von links): Harald Roth, Vortsitzender Georg Hollfelder, Elke Stelzner und Martin Schamel.
Rücksicht statt Ellenbogendenken und Egoismus / Historiker mit Entertainer-Qualitäten: Adrian Roßner über Egoismus und Zusammenhalt
Steinberg.
Der ländliche Raum sollte eine Vorbildfunktion für
die Gesellschaft haben. Das hat Adrian Roßner beim
Landfrauentag in Steinberg bei Wilhelmsthal
festgestellt. „Hier lebt man im Miteinander, hier
setzt man sich füreinander ein und hier kümmert sich
der eine noch um den anderen“, so der promovierte
Historiker aus dem Fichtelgebirge.
Nicht immer ganz so ernst ging es beim Vortrag von Adrian Roßner zu. Der Wissenschaftler, der am Institut für Fränkische Landesgeschichte seinen Doktortitel erworben hatte, erzählte launig und in fröhlich fränkischer Mundart vom Leben auf dem Dorf. Er riss passend zur Faschingszeit Witze, hatte aber auch, ganz so, wie man ihm vom Fernsehen kennt, tiefgründige Informationen parat. Denn auch ihn beschäftigten die einen oder anderen negativen gesellschaftlichen Entwicklungen.
Der Egoismus sei mittlerweile das größte Problem unserer Gesellschaft, sagte er. „Doch Egoismus ist Gift.“ Unser gesamtes Zusammenleben funktioniere nur mit Geben und Nehmen, und mit Werten, die vielfach verloren gegangen seien. Er sei überzeugt davon, dass wichtige Impulse, um die Situation wieder zu ändern, aus dem ländlichen Raum kommen könnten. Auch einen Blick zurück riskierte Adrian Roßner. Zurück in die Zeit, als das Wirtshaus und die Kirche noch die Mittelpunkte eines jeden Dorfes bildeten. Zurück auch in die Zeit, als noch Rituale wichtig waren.
Kreisbäuerin
Marina Herr hatte zuvor die Bedeutung der Bildung in
der Landfrauenarbeit hervorgehoben. Hintergrund war
das aktuelle Thema der Landfrauenarbeit „Bildung
bewegt vieles“. Ob „Schule fürs Leben“, „Landfrauen
machen Schule“ oder erstmals der „Girls Day“ auf
landwirtschaftlichen Betrieben: „Wir haben den
Luxus, jederzeit auf Bildungsangeboten zurückgreifen
zu können“, sagte sie.
Ohne die Bauern würde der Landkreis nicht blühen und gedeihen, so der stellvertretende Kronacher Landrat Gerhard Wunder und rief dazu auf, mit einer starken Landwirtschaft optimistisch in die Zukunft zu blicken. Susanne Grebner, Bürgermeisterin von Wilhelmsthal, freute sich über die Frauenpower in der Landwirtschaft und darüber, dass so viele junge Frauen in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und am elterlichen Hof bleiben.
Bilder:
1. Der Landfrauenchor
aus dem benachbarten Landkreis Coburg umrahmte den
Kronacher Landfrauentag mit modernen und
traditionellen Liedern.
2. Kreisbäuerin
Marina Herr bedankte sich bei dem TV-bekannten
Historiker Adrian Roßner, der die Besucher des
Landfrauentages nicht nur mit Information versorgt,
sondern auch zum Lachen gebracht hat.
Musterbeispiel: Strom und Wärme aus regenerativen Energien / Biogasanlage Hollfeld mit bundesweit bedeutsamem Preis ausgezeichnet
Hollfeld.
Die Biogasanlage in Hollfeld ist ein Musterbeispiel
dafür, wie durch die Kooperation von Landwirten und
einem schlüssigen Konzept die Energiewende gelingen
kann. Deshalb wurde die Anlage der Bioenergie
Hollfeld GmbH vom Fachverband Biogas e. V.
nachträglich zur Anlage des Monats Januar 2025
gekürt. Eine bundesweite Auszeichnung, wie
Biogas-Regionalreferent Markus Bäuml bei der
Übergabe der Urkunde betonte.
Die Gemeinschaftsanlage war 2011 ans Netz gegangen. Die Substrate Rindergülle, Mais, Ganzpflanzensilage, Gras und Getreide, stammen den Betreibern zufolge von rund 40 viehhaltenden Betrieben aus der näheren Umgebung, die das Gärprodukt als wertvollen Dünger zurück auf die Felder ausbringen und die Anlage zudem als Futterpuffer nutzen. In zwei Blockheizkraftwerken mit einer installierten Leistung von 800 Kilowattstunden bei 432 Kilowattstunden Bemessungsleistung werde wärme und strommarktgeführt klimafreundliche Energie erzeugt. 3,8 Millionen Kilowattstunden Strom würden je nach Bedarf ins Stromnetz eingespeist, rund zwei Millionen Kilowattstunden Wärme gingen über die Biomasseheizzentrale Hollfeld an 31 Wärmekunden. Pro Jahr vermeidet die Biogasanlage nach den Worten von Markus Bäuml rund 2500 Tonnen Kohlendioxid.
Aktuell versorgt die Biogasanlage unter anderem die Gesamtschule, die Grundschule, zwei Kindergärten, das Rathaus, das Altenheim, Kirche und Stadtapotheke und viele Privatleute mit Wärme. Pro Jahr werden, je nachdem wie streng der Winter ausfällt, 700.000 bis 800.000 Liter Heizöl eingespart. Der erzeugte Strom wird ins Netz eingespeist.
„Die
Hollfelder Anlage ist beispielhaft“, sagt Manuel
Appel vom Maschinenring Fränkische Schweiz, der als
Geschäftsführer an der Spitze der Biogasanlage
steht. Gesellschafter sind die beteiligten Bauern
über die MR Agrarservice GmbH, die Stadt Hollfeld,
der Zweckverband Gesamtschule, die
Waldbauernvereinigung Hollfeld und der
Maschinenring.
Nach den Worten des bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber gibt es im Freistaat rund 2550 Biogasanlagen, bundesweit seien es an die 10000. „Damit sind wir das Herz für Biogas in Deutschland“, so der Minister, der von der Politik im Bund ein klares Bekenntnis zu Gunsten von Biogas forderte. Hollfeld habe von Beginn an auf Strom und Wärme gesetzt und damit die Wirtschaftlichkeit hergestellt. Glauber: „Was hier vor Ort entstanden ist, sichert landwirtschaftliche Betriebe, sichert Einkommen und damit die Wertschöpfung vor Ort.“
Bereits 2003 setzte man in Hollfeld auf regenerative Energien. Als die Gesamtschule eine neue Heizung benötigte, entschied man sich für die Wärme von Hackschnitzeln. Schnell kamen Grundschule, Rathaus und einige Privatleute dazu, so dass die Wärme schon bald nicht mehr ausreichte. An der Leistungsgrenze angekommen musste also eine weitere Energiequelle erschlossen werden. Die Lösung sah man im Bau einer Biogasanlage. 28 Landwirte aus der engsten Umgebung hatten sich am Anfang daran beteiligt, brachten Geld als Darlehen ein und gingen eine Lieferverpflichtung ein. Die Investition lag damals bei 2,3 Millionen Euro.
Pionier
in Sachen Biogasanlage war der Hollfelder Landwirt
Michael Schatz. Er hatte früher als viele andere die
entscheidenden Anstöße zum Bau einer
Hackschnitzelheizung und einer Biogasanlage gegeben.
Michael Schatz sieht im Biogas viele Vorteile
vereint. Vor allem könne man den Ertrag von den
Feldern dort verwenden, wo er am dringendsten
gebraucht wird, auf dem Teller, also für die
Nahrungsmittelproduktion, und für den Tank, also zur
Energieerzeugung mit Strom und Wärme. Als weiteren
Vorteil bezeichnete er es, dass man das für die
Anlage notwendige Material lagern und somit auch mal
ein Dürrejahr überbrücken kann
Bilder:.
1.
Großer Bahnhof zur Übergabe der
Urkunde durch den Fachverband Biogas e. V.: Die
Biogasanlage in Hollfeld wurde zur bundesweiten
Anlage des Monats gekürt.
2. Markus
Bäuml vom Fachverband Biogas e. V. übergab die
Urkunde an Betriebsleiter Roland Betz und
Geschäftsführer Manuel Appel (von links). Rechts im
Bild: der bayerische Umweltminister Thorsten
Glauber.
3.
Geschäftsführer Manuel
Appel vom Maschinenring Fränkische Schweiz.
Kein Schutzstatus für den Wolf / Amtierende Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses Petra Högl beim Pottensteiner Bauerntag
Pottenstein.
Jede Menge Zahlen hatte Petra Högl, amtierende
Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses im
Bayerischen Landtag, mit zum Pottensteiner Bauerntag
gebracht, um die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors
Landwirtschaft zu unterstreichen. 147 Menschen sind
es im Freistaat, die jeder Landwirt ernährt.
Zusammen mit dem vor- und nachgelagerten Bereich
hänge jeder siebte Arbeitsplatz im Freistaat von der
Landwirtschaft ab und schließlich pflegten die
bayerischen Landwirte rund 80 Prozent der
Landesfläche. Damit komme niemand mehr an der
bäuerlichen Landwirtschaft vorbei, sagte Petra Högl,
die mit ihrer Familie einen Ackerbau- und
Forstbetrieb in Abensberg in der Hallertau
bewirtschaftet. Seit 2018 ist sie Abgeordnete des
Bayerischen Landtags, seit 2023 stellvertretende
Vorsitzende des Ausschusses für Ernährung,
Landwirtschaft, Forsten und Tourismus. Da für den
Ausschuss kein erster Vorsitzender gewählt wurde,
gilt Petra Högl als stellvertretende Vorsitzende
faktisch als Chefin.
In ihrer Rede würdigte Petra Högl die Fränkische Schweiz als gesegnete Kulturlandschaft, in der zwei Dinge eine wichtige Rolle spielen: die Landwirtschaft und der Tourismus. Beides gehöre untrennbar zusammen, denn es seien die Bauern, die die Kulturlandschaft pflegen, die das gesellschaftliche Leben in den Dörfern prägen und die für Ernährungssicherheit sorgen. Und das soll auch so bleiben: „Wir müssen uns auf die heimische Landwirtschaft konzentrieren, wenn wir nicht wollen, dass das Schnitzel künftig aus einem Chinesischen Schweinehochhaus kommt.“
Ein
Wortbeitrag in der Diskussion ließ aufhorchen: Ein
Landwirt aus dem Veldensteiner Forst hatte nach
eigener Aussage Aufnahmen einer Wildkamera, auf der
ein komplettes Wolfsrudel mit 14 Tieren zu sehen
sei. „Wir haben in der Gegend fast kein Wild mehr,
die Situation ist untragbar“, sagte er.
Ausschussvorsitzender Petra Högl war das Problem
bekannt. Die Wolfsdichte sei in vielen teilen Bayern
zu groß, sagte sie. Die Risse hätten stark
zugenommen, da gelte es zu handeln. Petra Högl
sprach sich für eine Absenkung des Schutzstatus für
den Wolf aus. „Eine Bejagung muss künftig möglich
sein“, sagte sie. Der Wolf sei längst nicht mehr vom
Aussterben bedroht, auch wenn das bestimmte
Tierschutzorganisationen immer wieder behaupten.
Bilder:
1. Der
Bayreuther BBV-Kreisobmann Karl Lappe bedankte sich
bei der amtierenden Vorsitzenden des
Landwirtschaftsausschusses im Landtag, Petra Högl,
mit einem Korb voller Spezialitäten aus der Region.
2. Politik
und Berufsvertreter beim Pottensteiner Bauerntag
(von links): Kreisbäuerin Angelika Seyferth, der
Pottensteiner Bürgermeister Christian Weber,
BBV-Kreisobmann Karl Lappe, die amtierende
Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses im
Landtag, Petra Högl, und der Bayreuther Landrat
Florian Wiedemann.
Fleiß und Leistungsbereitschaft statt Work-Life-Balance / Staatssekretär Martin Schöffel beim Scheßlitzer Bauerntag
Scheßlitz.
Mit einem großen Rundumschlag über alle
landwirtschaftlichen Themen hinweg, hat Martin
Schöffel (CSU) den Bauern im Bamberger Land den
Rücken gestärkt. Beim Scheßlitzer Bauerntag forderte
der Staatssekretär aus dem Bayerischen Finanz- und
Heimatministerium ein Umdenken in weiten Teilen der
Gesellschaft: „Wir brauchen Fleiß,
Leistungsbereitschaft und die Hinwendung zur
arbeitenden Bevölkerung, statt Vier-Tage-Woche,
immer mehr Teilzeit und Work-Life-Balance, wenn
unser Land wieder nach vorne gebracht werden soll.“
Den Bauern brauchte er dies nicht zu sagen. „Sie erzeugten die besten Nahrungsmittel der Welt, hätte eine hervorragende Ausbildung, aber leider auch die meisten Vorschriften zu beachten“, so Schöffel. Der Staatssekretär ist vom Fach, hatte in Weihenstephan studiert und ist unter anderem auch stellvertretender Vorsitzender des oberfränkischen Braugerstenvereins. „Lasst doch die Bauern einfach wieder ihre Arbeit machen“, rief er. Dauerkritik sei da fehl am Platz.
Mit scharfen Worten protestierte er unter anderem gegen das Bundesumweltamt. Es werde höchste Zeit, dass die Ideologen dort aus ihren Ämtern enthoben werden, sagte er. Waldbewirtschaftung sei praktizierter Klimaschutz. Stilllegungspläne und das geplante Bundeswaldgesetz seien fehl am Platz. Heftige Kritik musste auch Cem Özdemir einstecken: Dieser Landwirtschaftsminister mit all seinem ideologischem Handeln sei völlig daneben. Landwirtschaft stehe für Vielfalt und Biodiversität, da sollte man wirklich einmal die Kirche im Dorf lassen.
Zuvor
hatte der Bamberger Landrat Johann Kalb (CSU) einen
positiven Blick in die Zukunft der Landwirtschaft
gewagt. So langsam erkenne die Gesellschaft an,
welchen Wert die heimische Lebensmittelerzeugung
hat, so der Landkreischef. Auch er würdigte die hohe
Qualität der Nahrungsmittel, die direkt vor Ort
erzeugt und vermarktet werden. Nur eine starke
heimische Landwirtschaft könne das garantieren.
Landwirtschaft sei etwas für Mutige, für Menschen, die die Herausforderung lieben, so der Scheßlitzer Bürgermeister Roland Kauper (CSU). Die Bauern seien die Leistungsträger der Gesellschaft, denn ohne Bauern keine Nahrung und ohne Nahrung keine Zukunft.
Bilder:
1. Kreisobmann
Tobias Kemmer konnte zum Scheßlitzer Bauerntag
Finanz- und Heimatstaatssekretär Martin Schöffel,
den Bamberger Landrat Johann Kalb, Bürgermeister
Roland Kauper und die frühere Landesbäuerin
Anneliese Göller (von links) begrüßen.
2. Staatssekretär
Martin Schöffel übte scharfe Kritik am
Bundesagrarminister und am Bundesumweltamt. Links:
Kreisbäuerin Marion Link und Kreisobmann Tobias
Kemmer.
Schule als Lern- und Lebensraum / BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann beim Bayreuther Landfrauentag
Bayreuth.
Mit Simone Fleischmann war es den Bayreuther
Landfrauen gelungen, eine prominente und kompetente
Rednerin zu ihrem Landfrauentag zu gewinnen. Sie ist
die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und
Lehrerinnenverbandes (BLLV) und hatte so einiges zum
Jahresthema de Landfrauen zu sagen, das da heißt:
„Bildung bewegt vieles?!“ Das Ausrufezeichen stehe
für alles, was wir in der Landfrauenarbeit schon
erreicht haben, sagte Kreisbäuerin Angelika Seyferth.
Das Fragezeichen aber stehe für die Zukunft.
Simone Fleischmann, Lehrerin und Leiterin einer Grund- und Mittelschule im oberbayerischen Poing, zeigte sich auf einer Linie mit den Landfrauen, beispielsweise, wenn es um die immer wieder eingeforderte Vermittlung von Alltagskompetenzen geht. „Da geht es um praktische Fähigkeiten“, sagte die BLLV-Präsidentin. „Diese Fähigkeiten gehen uns gerade abhanden.“ Für Simone Fleischmann bedeutet Schule aber nicht nur Lernraum, sondern auch Lebensraum. Dinge, wie Ernährung, Gesundheit, Haushaltsführung gehörten da selbstverständlich mit dazu.
Die
Referentin sagte aber auch, dass die Schulen mehr
professionelle Lehrer bräuchten. Auch in den Schulen
sei der Fachkräftemangel längst angekommen. Deshalb
seien externe Experten immer wichtiger. „Und das
wären dann sie“, sagte Simone Fleischmann zu den
Landfrauen. Dabei gehre es nicht nur um gesunde
Ernährung, sondern beispielsweise auch darum, einen
Schulgarten anzulegen.
Zuvor hatte Kreisbäuerin Angelika Seyferth an die Geschichte des BBV-Bildungswerkes erinnert, das im zurückliegenden Jahr seinen 50. Geburtstag feiern konnte. Zunächst sei es um Hauswirtschaft, Kälberaufzucht und Melktechnik gegangen. Mehr und mehr seien Koch- und Backkurse und alle möglichen Vorführungen dazu gekommen. Heute seien die Themen vielfältiger geworden. Kochkurse gebe es noch immer, doch mittlerweile gehe es meist darum, viele selbstverständlich gewordene Dinge von Grund auf neu zu lernen.
Zu
Begin des Landfrauentages in der Tierzuchtklause
hatten der katholische Dekan Heinrich Hohl und de
evangelische Dekan Jürgen Hacker in einer
ökumenischen Andacht das für die Landwirtschaft
bedeutender Fest Maria Lichtmess gefeiert, das in
früheren Jahren eine große Zäsur des Bauernjahres
dargestellt hat.
Bilder:
1. Der
Bayreuther Landfrauenchor hat den gemeinsamen
Landfrauentag in der Tierzuchtklause mit
frühlingshaften Klängen bereichert.
2. Die
stellvertretende Kreisbäuerin Doris Schmidt und
Kreisbäuerin Angelika Seyferth bedanken sich bei den
beiden Dekanen Jürgen Hacker und Heinrich Hohl (von
rechts) für die Ausgestaltung des Bayreuther
Landfrauentages.
3. Kreisbäuerin
Angelika Seyferth (links) und ihre Stellvertreterin
Doris Schmidt (rechts) bedankten sich mit einem
Präsent bei der BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann
für die Übernahme des Hauptreferates.
Fischotter bedroht Fortbestand der Fischerei / Teichgenossenschaft Oberfranken klagt über riesige Verluste
Himmelkron. Die oberfränkischen Teichwirte beschäftigt nach wie vor das Dauerthema Fischotter. Bei der Jahresversammlung der Teichgenossenschaft Oberfranken in Himmelkron war die Rede von Verlusten in Höhe von 80 Prozent in vielen Teichen. Speziell in den östlichen Landkreisen des Regierungsbezirks gebe es sogar Komplettverluste, also restlos leer gefressene Teiche.
Nach wie vor bedrohten zahlreiche sogenannte Prädatoren die heimische Fischwirtschaft. Silberreiher und Graureiher gehörten dazu, noch immer der Kormoran und auch der Biber als „Problemtier“. Sie alle haben Riesenappetit auf Fisch: Doch keine Tierart beschäftigt die Teichwirte mittlerweile in einem derartigen Ausmaß, wie der Fischotter.
Diese kleinen possierlichen Tierchen richteten einen Riesenschaden an, sagte der Vorsitzende Dr. Peter Thoma aus Wunsiedel. „Der Fischotter schaut nett aus, ist aber tödlich“, so der Vorsitzende. Tatsächlich gibt es nach den Worten von Dr. Reinhard Reiter, Fischereireferent im Bayerischen Landwirtschaftsministerium, aktuell rund 1500 Fischotter im Freistaat. Etwa die Hälfte Bayerns sei besiedelt. Der Zuwachs betrage pro Jahr zwölf Prozent. „Damit sind wir inzwischen bei Zahlen angelangt, die nicht mehr erträglich sind“, so Reinhard Reiter.
Wenn die Bekämpfung noch immer so schwierig sei, dann vor allem deshalb, weil es völlig unterschiedliche Sichtweisen auf den Otter gibt, von „absolut schützenswert“ bis „so kann es nicht mehr weiter gehen“. Das Nachbarland Tschechien sei bereits komplett besiedelt, von dort aus komme das Tier nach Bayern, so dass Ostbayern mittlerweile einen Schwerpunkt der Otterpopulation im Freistaat bilde.
Dabei sollte der Fischotter nicht nur den Teichwirten, sondern mittlerweile auch Naturschützern Kopfzerbrechen bereiten. Denn dort wo der Otter zuhause ist, gebe es längst auch keine Amphibien und keine Wasservögel mehr, weil er Nester und Gelege komplett ausräumt. „Wir hoffen, mit diesem Argument auch den letzten Naturschützer zu überzeugen, dass man den Otter entnehmen muss“, sagte Reinhard Reiter. Der Fischotter gilt als geschützt und in der Regel darf nur mit einzelnen aufwändigen Ausnahmegenehmigungen entnommen werden.
Prävention im klassischen Sinne könnten die Teichwirte nicht leisten, da wirksame Schutzzäune einfach zu teuer sind. Der Fischereireferent rechnete vor, dass für einen drei Hektar großen Teich ein 400 Meter langer Zaun benötigt würde. Dieser Zaun müsse unter anderem mindestens 1,60 Meter hoch sein, einen 40 Zentimeter tiefen Untergrabungsschutz besitzen und unter Strom gesetzt werden können. Damit würde der 400 Meter lange Zaun in etwa 30000 Euro kosten. „Eine solche Investition kann nicht wirtschaftlich sein“, sagte Reinhard Reiter.
Auch die Entschädigung sei, zumindest für die oberfränkischen Teichwirte nicht wirklich lukrativ, wie Alexander Horn, Fischotterberater aus Helmbrechts, ausführte. Von den 2,4 Millionen Euro gemeldeten Schäden im zurückliegenden Jahr, seien zwar 2,2 Millionen Euro ausbezahlt worden, doch nur etwa ein Prozent davon sei nach Oberfranken geflossen.
„Mit den Schäden steigt die Verzweiflung bei den Teichwirten“, sagte Peter Mayer, Direktor der oberfränkischen Bezirksverwaltung. Der Bezirk ist Träger der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß (Landkreis Bayreuth). Aufgrund der verzweifelten Lage würden immer mehr Teichwirte aufgeben. Peter Mayer kündigte an, dass der Neuerlass einer Fischotterregelung auf den Weg gebracht werden soll, der die Landkreise Hof und Wunsiedel sowie Teile des Landkreises Bayreuth betrifft. Sie sollen als Maßnahmegebiete ausgewiesen werden. „Wir brauchen dringend Lösungen, denn wir wollen den Fortbestand der Fischerei in Oberfranken. Schließlich sei Fisch aus der Region die beste Bereicherung für den heimischen Speiseplan.
Lösungen erhoffen sich alle Verantwortlichen auch beim Deutschen Fischereitag, der nach Hamburg im vergangenen Jahr heuer vom 1. bis zum 3. Juni in Franken stattfindet.
Strukturbruch statt Strukturwandel / BBV-Politikergespräch: Landwirte beklagen Auflagenwahn, Bürokratie und Gängelung
Himmelkron.
Planungssicherheit: Dieser Begriff ist am häufigsten
gefallen, beim Politikergespräch zwischen Vertretern
des Bauernverbandes und den Kandidaten zur
Bundestagswahl in Himmelkron. Planungssicherheit,
das ist auch die dringendste Forderung der Landwirte
an die Politik. „Was wir aber erleben ist
Bürokratie, Auflagenwahn, eine Verbotskultur und
ständige Gängelei“, sagte Kreisobmann Harald Peetz.
Das alles habe mit Planungssicherheit nichts zu tun.
Ein Jahr nach den vielbeachteten Bauerndemos zog der Kreisobmann ein ernüchterndes Fazit. Den Strukturwandel habe es schon immer gegeben, doch mittlerweile müsse man von einem regelrechten Strukturbruch sprechen. Selbst größere Betriebe sperrten ihre Hoftore für immer zu. Mehr und mehr würden bäuerliche Familienbetriebe verschwinden. Die Folgen für die Gesellschaft seien kaum absehbar. Die Kulturlandschaft könne nicht mehr gepflegt werden, das Dorfleben bleibe auf der Strecke, die Ernährungssicherheit stehe mehr und mehr in Frage.
Sämtliche Kandidaten für die Bundestagswahl am 23. Februar stellten sich bei dem Gespräch als Anwälte der Landwirtschaft dar, wenn auch mit unterschiedlichen Positionen. Einzig die Grünen fehlten, deren Kandidat ließ sich entschuldigen.
Die Landwirtschaft sei für sie ein Schwerpunktthema, Verlässlichkeit und Planungssicherheit stünden bei ihr ganz oben auf der Agenda, so die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner, Sie warb für den BBV-Präsidenten Günther Felßner, der als Bundeslandwirtschaftsminister im Gespräch ist und machte sich vor allem für den Fortbestand des Kulmbacher Schlachthofes stark.
Der Schlachthof war auch für Oswald Greim von den Linken von großer Bedeutung. Allerdings dürfe es weder Sonderkonditionen für Großschlächter noch irgendwelche Verluste durch den Schlachthofbetrieb geben „Der Schlachthof muss sich aus eigener Kraft aus dem Sumpf ziehen“, sagte er. Anstatt die Agrardieselbeihilfe zu kürzen, schlug Oswald Greim vor, das Dienstwagenprivileg zu streichen.
Sebastian Görtler von der AfD will den landwirtschaftlichen Betrieben mehr Eigenverantwortung und mehr Freiheiten zugestehen und im Gegensatz dazu Bürokratie und Vorschriften abbauen. Er und seine Partei haben dabei vor allem das „Bürokratiemonster Brüssel“ im Visier. Sebastian Görtler versprach, nicht an Agrardieselsubventionen zu rütteln, sondern im Gegenteil die CO2-Besteuerung wieder zurückzunehmen. Seine Partei leugne die Klimaveränderung keineswegs, stelle aber den menschengemachten Klimawandel in Frage.
Christian Penninger von der Partei Volt sprach sich für eine Gemeinwohlprämie anstatt für Subventionen aus. Er appellierte für mehr Nachhaltigkeit und für ein Anheben von Tierwohlstandards. Für Volt sei die Europäische Union ein wichtiges Konstrukt, das es weiterzuentwickeln gelte. Weitere Forderungen von Christian Penninger waren die nach einem Digitalministerium und nach einem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs in ländlichen Regionen.
Als einziger Vertreter der Ampel-Regierung hatte Ali-Cemil Sat, Kandidat der SPD, an dem Politiker Gespräch teilgenommen. Der Student sprach sich für finanzielle Entlastungen der Landwirte aus und sicherte zu, den Bürokratieabbau „einfach mal anzugehen“. Die Landwirtschaft spiele eine zentrale Rolle für den Erhalt der Lebensgrundlagen und der Artenvielfalt und gegen den Klimawandel, so der Kandidat.
Bleibt noch Jochen Bergmann von den Freien Wählern. Seine Partei stehe zu hundert Prozent an der Seite der Landwirte, sagte er. Die Landwirtschaft müsse wieder Luft zum Atmen bekommen, dazu gelte es Rahmenbedingungen zu setzen, in denen sich die Bauern frei bewegen könnten. Billigimporte bezeichnete Jochen Bergmann als unfair. ER sprach sich auch dafür aus, dass Forschung und Landwirtschaft mehr zusammenarbeiten, beispielsweise, wenn es um die Züchtung schädlingsresistenter Pflanzen gehe.
Bild: Landwirtschaft trifft Politik (von links): der stellvertretende Kreisobmann Martin Baumgärtner, Emmi Zeulner (CSU), Oswald Greim (Linke), Sebastian Görtler (AfD), Jochen Bergmann (Freie Wähler), Kreisobmann Harald Peetz, Ali Cemil Sat (SPD) und Christian Penninger (Volt).
Weniger Tiere, mehr Umsatz / Kulmbacher Kreiszuchtgenossenschaft zog positive Bilanz
Wonsees.
Die Milchviehhaltung geht dramatisch zurück.
Oberfrankenweit habe die Zahl der Milchkühe in den
zurückliegenden zehn Jahren um 10000 abgenommen,
sagte Markus Schricker, Zuchtleiter des
Rinderzuchtverbandes Oberfranken bei der
Mitgliederversammlung der Kreiszuchtgenossenschaft
Kulmbach. Wenn der Landkreis Kulmbach dabei keine
Ausnahme bildet, so ist er dennoch im
zurückliegenden Jahr ganz gut davongekommen. Nur
drei Milchviehbetriebe mit zusammen 105 Kühen hatten
aufgegeben. Damit gibt es den Zahlen des
Zuchtverbandes zufolge noch 86 Milchviehbetriebe mit
zusammen 5767 Kühen im Landkreis.
Auf ganz Oberfranken bezogen sehen die Zahlen dagegen schon dramatischer aus. Hier war die Zahl der Betriebe um 33 auf 891 und die Zahl der Tiere um 1573 auf 61612 zurückgegangen. Trotz der nach unten gehenden Zahlen hatte es bei der Vermarktung im zurückliegenden Jahr keine Probleme gegeben. Nach den Worten von Georg Hollfelder, dem Vorsitzenden des oberfränkischen Rinderzuchtverbandes seien auf Bezirksebene über 27000 Tiere vermarktet worden. Den Umsatz bezifferte er auf rund 17 Millionen Euro.
Den größten Teil machten dabei männliche und weibliche Nutzkälber mit zusammen knapp 24000 Tieren aus. Wenn die absolute Zahl der vermarkteten Tiere auch leicht rückläufig gewesen sei, so konnte der Umsatz, durch die hervorragende Marktsituation doch leicht gesteigert werden.
Grundsätzlich
sei das zurückliegende Jahr auch aus Kulmbacher
Sicht recht positiv verlaufen, so der
Kreisvorsitzende Thomas Erlmann aus Waldau. Das
liege nicht nur an den guten Erlösen, sondern auch
an der ausgezeichneten Futterversorgung. Auch Thomas
Erlmann berichtete von einem fortgesetzten
Höfesterben., Um so wichtiger sei die Arbeit der
verbleibenden Betriebe.
Wenn die Zahl der Höfe und der Tiere auch kontinuierlich abnimmt, so sei der Landkreis doch auf gutem Niveau, sagte Landrat Klaus Peter Söllner. Er hoffte, dass die Landwirte nach den Wahlen zum Bundestag wieder eine bessere Ausgangsposition haben und zollte allen Bauern im Kulmbacher Land Anerkennung und Respekt. Einen derartig vielfältigen Berufsstand wie die Landwirtschaft finde man selten, sagte Kreisobmann Harald Peetz. Das werde an den breit aufgestellten Betrieben im Kulmbacher Land deutlich. Die Politik rief der Kreisobmann dazu auf, wieder auf Sachverstand, statt auf grüne Ideologie zu setzen.
Für die besten Herdenleistungen wurden bei der Mitgliederversammlung die folgenden Betriebe ausgezeichnet: der Vorsitzende der Kreiszuchtgenossenschaft Thomas Erlmann aus Waldau, Andrea Meister aus Schlockenau, Harald Küfner aus Untergräfenthal, Dietmar Schmidt aus Reuth und die Riedl GdBR aus Lanzendorf.
Vor
der Versammlung hatten die Mitglieder der
Kreiszuchtgenossenschaft den Milchviehbetrieb von
Heike und Wolfgang Schleicher in der Schlotzmühle
bei Wonsees besichtigt. Direkt an der
Landkreisgrenze zu Bayreuth gelegen bewirtschaften
Heike und Wolfgang Schleicher rund 100 Hektar
Ackerfläche und Grünland. Dort wird im Wesentlichen
das Futter für die 80 Milchkühe angebaut. Das
Besondere ist dabei, dass der Stall nicht neu
gebaut, sondern 2015 grundlegend umgebaut wurde. So
befindet sich der Futtertisch nicht wie bei den
meisten Betrieben in der Stallmitte, sondern an der
Außenseite. Trotzdem sei es kein echter Kaltstall,
da er nicht frostsicher ist, erklärte Wolfgang
Schleicher. Die Aufzucht der Tiere sei ausgelagert
worden und werde von zwei Partnerbetrieben im
Landkreis übernommen.
Bilder:
1. Vor
der Mitgliederversammlung hatte die
Kreiszuchtgenossenschaft den Milchviehbetrieb von
Heike und Wolfgang Schleicher in der Schlotzmühle
bei Wonsees besichtigt.
2. Kein
klassischer Kaltstall aber ein außenliegender
Futtertisch. 2015 hatte Wolfgang Schleicher sich für
einen grundlegenden Stallumbau entschieden.
3. Zuchtleiter
Thomas Schricker (links) und der Vorsitzende der
Kreiszuchtgenossenschaft Thomas Erlmann übergaben
Prüfplaketten des Verbandes an Martin Wagner, Bernd
Pfändner, Markus Unger und Bernd Schütz. Thomas
Erlmann wurde zudem für die beste Herdenleistung auf
Landkreisebene ausgezeichnet
Tierschauen stehen auf der Kippe / Maul- und Klauenseuche: Breitet sie sich weiter aus, wird es eine mittlere Katastrophe
Kulmbach. Wird es heuer Tage des offenen Hofes auf landwirtschaftlichen Betrieben geben? Können Tierschauen stattfinden und wie steht es um die 1. Oberfränkische Jungzüchterschau, eine Großveranstaltung, die von langer Hand geplant wurde, und die am 22. März in der Tierzuchthalle in Bayreuth stattfinden soll! „Wir hoffen, dass uns die Maul- und Klauenseuche keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt Markus Schricker, Zuchtleiter beim Rinderzuchtverband Oberfranken.
Am 10. Januar ist die anzeigepflichtige Maul- und Klauenseuche (MKS) im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland bei einem Wasserbüffelbestand ausgebrochen. Das Friedrich-Loeffler-Institut hatte die hochansteckende aber für den Menschen ungefährliche Viruserkrankung schnell offiziell bestätigt. Der Erreger konnte bei drei verendeten Wasserbüffeln in einem kleinen Weidebetrieb nachgewiesen werden. Um den betroffenen Betrieb wurden zwei Sperrkreise mit einem Radius von drei und zehn Kilometern eingerichtet, die auch die Landkreise Barnim, Oder-Spree sowie die Stadt Berlin betreffen. Innerhalb dieser Sperrzonen werden alle vorgesehenen Maßnahmen durch das zuständige Veterinäramt angeordnet, darunter die ordnungsgemäße Keulung der restlichen Wasserbüffel des Bestandes, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.
„Hoffen wir, dass es bei Wasserbüffeln in Brandenburg bleibt“, sagt Thomas Erlmann aus Waldau bei Neudrossenfeld, Vorsitzender der Kreiszuchtgenossenschaft Kulmbach. „Dann kommen wir mit einem blauen Auge davon. Sollte sich die Maul- und Klauenseuche allerdings ausbreiten, dann sei dies eine mittlere Katastrophe.
Auch für Georg Hollfelder, dem Vorsitzenden des Rinderzuchtverbandes Oberfranken, sei die Maul- und Klauenseuche derzeit das Bewegendste. Glücklicherweise habe es seit dem 10.Januar keinen Fall mehr gegeben, sämtliche Kontaktbetriebe seien negativ gewesen und auch der Ziegenverdachtsfall im brandenburgischen Landkreis Barnim habe sich nicht bestätigt. Der Verdachtsfall war aufgetreten, nachdem Ziegen MKS-verdächtige Symptome gezeigt hatten. Die Tiere des Bestandes wurden umgehend getötet und der Betrieb gesperrt, um zu verhindern, dass sich das hoch ansteckende Virus weiter ausbreitet. Nach derzeitigem Stand sei die Jungzüchterschau am 22. März in Bayreuth nicht gefährdet. „Wir sind guter Dinge, dass die seit langem geplante 1. Oberfränkische Jungzüchterschau stattfinden kann.“
Wenn vermeintliche Tierschützer das Auftreten der Maul- und Klauenseuche als Argument gegen „sogenannte Massentierhaltung“ benutzten, wie es bei Demonstrationen am Rande der Grünen Woche in Berlin geschehen sei, dann gehe dies völlig an der Realität vorbei, so der Kulmbacher Kreisobmann Harald Peetz. Der Ausbruch in Brandenburg sei ja gerade in einem extensiven Büffelbetrieb geschehen.
Die Ursache für den Erregereintrag ist bislang noch nicht bekannt. Trotzdem sind alle Betriebe, die empfängliche Tierarten halten, zu höchster Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen aufgerufen. Alle Erkrankungen, die auf Blauzungenkrankheit oder MKS hindeuten, sollten schnellstmöglich vom Tierarzt/Veterinäramt abgeklärt werden. Für erkrankte Tiere gibt es keine Behandlungsmöglichkeit. Ist in einem Betrieb auch nur ein einziges Tier erkrankt, müssen alle Klauentiere getötet werden.
Hintergrund:
Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine hochansteckende Viruserkrankung bei Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen. Auch Zoo- und Wildtiere können an MKS erkranken. In Deutschland sind die letzten Fälle 1988 aufgetreten. Die MKS tritt allerdings in vielen Ländern Afrikas und Asiens nach wie vor auf. Illegal eingeführte tierische Produkte aus diesen Ländern stellen damit eine Bedrohung für die heimische Landwirtschaft dar. Für den Menschen als Verbraucher von pasteurisierter Milch, daraus hergestellten Milchprodukten oder von Fleisch besteht keine Gefahr.
Ohne Abschuss keine Naturverjüngung / Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften im BBV: Keine Entwarnung bei Wildschäden
Kulmbach.
Vom Wolf gerissene Schafe, vom Fischotter
geplünderte Teiche, vom Biber unter Wasser gesetztes
Grünland und vom Schwarzwild verwüstete Maisfelder:
das Thema Wildschaden ist auch im Kulmbacher Land
ein Dauerbrenner. Zwar seien einige Vorkommen leicht
zurückgegangen, doch konnte Burkhard Hartmann,
Kulmbacher Kreisvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
der Jagdgenossenschaften im Bauernverband bei der
Jahresversammlung bei weitem keine Entwarnung geben.
Der Biber besetze längst jedes Gewässer im Landkreis, sagte er. Auch der Fischotter macht sich mehr und mehr breit. „Fischwirte, die einen Teich zu bewirtschaften haben, sind arm dran“, so der Vorsitzende. Leicht zurückgegangen sei das Schwarzwild, was Burkhard Hartmann auch an Zahlen festmachen konnte. Lag die Strecke im Jagdjahr 2022/2023 noch bei 656 erlegten Tieren, seien es 2023(2024 noch 613 Tiere gewesen. Vermutlich hänge dies mit der Trockenheit zusammen, da der Wildschweinnachwuchs bei trockener Witterung zahlenmäßig offensichtlich geringer ausfällt. Das Jagdjahr ist nicht identisch mit dem Kalenderjahr. Es beginnt immer am 1. April und endet am 31. März.
Einen leichten Rückgang habe es auch beim Rehwild gegeben. Hier sei die Strecke 2023/2024 von 4413 im Vorjahr auf 4392 gesunken. Trotzdem habe das Verbissgutachten zuletzt alle sechs Hegegemeinschaften im Landkreis als rot ausgewiesen, was bedeutet, die Verbissschäden seien eindeutig zu hoch. Als Empfehlung wurde festgehalten, überall die Abschusszahlen weiter zu erhöhen, im Fall der Hegegemeinschaft Kulmbach sogar deutlich.
Sorge bereitet Landwirten, Jägern und Jagdpächtern sowohl die Afrikanische Schweinepest als auch die Maul- und Klauenseuche. Während die Seuche derzeit nur punktuell in Brandenburg vorkomme, sei die Schweinepest bereits 40 Kilometer von Bayern entfernt.
Dieter Heberlein von der Hauptgeschäftsstelle des Bauernverbandes in Bamberg, der seit vielen Jahren die organisierten Jagdgenossenschaften betreut, präsentierte bei der Versammlung die bayerischen Zahlen zum Verbissgutachten, das eigentlich Forstliches Gutachten heißt. Demnach erfüllten 48 Prozent der Hegegemeinschaft in Bayern nicht die Forderungen nach einem angepassten Wildbestand, so dass keine Naturverjüngung eintreten kann und auch Laubbäume keine Chance hätten. Im Landkreis Kulmbach seien die Hegegemeinschaften Frankenwald und Frankenwald/Oberland besonders betroffen.
Trotzdem habe die Rehwildstrecke oberfrankenweit im Vergleich zu den Vorjahren kontinuierlich gesteigert werden können, zuletzt von knapp 35000 auf über 36000 im Jagdjahr 2023/2024. Der Landkreis Kulmbach liege dabei mit 4392 Tieren eher im vorderen Bereich.
In Sachen Wolf konnte Dieter Heberlein für Oberfranken zumindest ein wenig für Beruhigung sorgen. Im Regierungsbezirk gebe es keine Hinweise auf ein ansässiges Rudel. Bisher seien nur Einzeltiere nachgewiesen worden. Trotzdem konnte er auch hier keine Entwarnung geben. Die Schäden würden zunehmen. Für 2022 weist die Statistik 4366 vermisste, verletzte oder gerissene Nutztiere aus. Im Jahr zuvor seien noch rund 1000 weniger gewesen. Unter den gerissenen Tieren hätten sich nicht nur Rinder, Schafe, Ziegen und Gehegewild befunden, sondern auch Pferde und Alpakas.
Bundesweit seien zuletzt insgesamt 184 Wolfsrudel, 47 Wolfspaare und 22 sesshafte Einzelwölfe bestätigt worden. „Wenn es um Nutztierhaltung geht, dann ist der Tierschutz in aller Munde“, kritisierte Dieter Heberlein mit Blick unter anderem auf die Anbindehaltung. „Wenn aber der Wolf Nutztiere verstümmelt und sie anschließend unter extremen Qualen verenden, dann wird das akzeptiert.“
Bild: Vorsitzender Burkhard Hartmann (rechts) von der Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften im Bauernverband bedankte sich bei Dieter Heberlein vom BBV, der die organisierten Genossenschaften betreut.
Europa aus Sicht des Praktikers / Betzensteiner Bauerntag: EU-Öko-Verordnung und Mercosur im Mittelpunkt
Betzenstein.
„Die Herausforderungen sind riesig, doch ich bin
nach wie vor optimistisch und hochmotiviert.“ Dieses
Fazit hat der unterfränkische BBV-Präsident Stefan
Köhler über die zurückliegenden Monate als
Abgeordneter des Europäischen Parlaments gezogen.
Beim Betzensteiner Bauerntag berichtete er in einer
Art Rundumschlag über seine bisherige Tätigkeit auf
europäischer Ebene. Stefan Köhler war im Juni für
die CSU ins Europaparlament gewählt worden. Viel gab
es allerdings noch nicht zu sagen, denn: „Die
Hauptarbeit beginnt erst jetzt“. Hintergrund ist,
dass die EU-Kommission erst seit Dezember steht.
Ein aktueller Aufreger treibt den unterfränkischen BBV-Präsidenten mit der EU-Öko-Verordnung bereits um. Die Verordnung schreibt zwingend den Weideauslauf vor, andernfalls werde die Bio-Zertifizierung nicht mehr erteilt. Ein Freund dieser Verordnung ist Stefan Köhler nicht gerade, doch gab er auch zu bedenken, dass die deutschen Bio-Verbände das selbst so gefordert hatten. Ziel einer künftigen gemeinsamen europäischen Agrarpolitik (GAP) sollte es sein, den Ökolandbau zu stärken. „Aber was im Moment passiert, führt eher zum Rückgang“, sagte der Parlamentarier, der im Gegensatz zu vielen anderen aus der Praxis kommt.
Stefan Köhler bewirtschaftet im Landkreis Aschaffenburg einen Hof mit 60 bis 70 Mutterkühen, 140 Hektar Grünland und weiteren 100 Hektar Ackerland, die er zusammen mit Kollegen bewirtschaftet. Ein Teil davon ökologisch. Er kritisierte, dass in Brüssel „zu vieles aus der Verbraucherbrille“ betrachtet werde. Natürlich würden Tiere auf der weide immer schön anzusehen sein. „Doch es ist halt nicht immer machbar.“
Ein
weiterer Aufreger der zurückliegenden Wochen sei die
Unterzeichnung des Mercosur-Handelsabkommens
gewesen. Insgesamt befürchten die Bauern bei der
Umsetzung des Freihandelsabkommens schwerwiegende
Folgen für die heimische Landwirtschaft. Das
Abkommen führe zu einem weiter verstärkten
ungleichen Wettbewerb, zu mehr Marktdruck und
schlechteren Vorgaben für die heimischen Betriebe,
so heißt es beim BBV. Dabei sei doch die
wirtschaftliche Situation hierzulande ohnehin schon
dramatisch, so der Abgeordnete. Wenn jetzt noch
Wahnsinnszölle kommen sollen, müssten den Bauern im
Gegenzug auch Zugeständnisse gemacht werden,
forderte er.
Zuvor hatte der Bayreuther Kreisobmann Kal Lappe alle Hoffnungen auf eine neue Bundesregierung gesetzt. Vor rund einem Jahr hatte es bei den Landwirten große Unruhen gegeben, die sich in den Bauernprotesten entladen haben. „Wir hätten uns mehr erhofft“, zog der Kreisobmann ein eher negatives Fazit. Nun liege der Ball bei der neuen Bundesregierung: Wir erwarten, dass diese Fehler wieder zurückgenommen werden.“
Auch er hoffe, dass nach der Bundestagswahl wieder gesunder Menschenverstand einkehrt, sagte der Betzensteiner Bürgermeister Claus Meyer (Freie Wähler). Aber auch der Dialog mit der Gesellschaft werde immer wichtiger, so Christa Reinert-Heinz vom Amt für Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg und warb für das Programm „Erlebnis Bauernhof“.
Bilder:
1. Die
Spitze des BBV Bayreuth mit dem stellvertretenden
Kreisobmann Harald Galster und Kreisobmann Karl
Lappe (von links) sowie Ehrenkreisobmann Hans
Escherich, der stellvertretenden Kreisbäuerin Doris
Schmidt und Kreisbäuerin Angelika Seyferth traf sich
mit dem unterfränkischen BBV-Präsidenten und
EU-Abgeordneten Stefan Köhler.
2. Der
Bayreuther Kreisobmann Karl Lappe (links) bedankte
sich beim unterfränkischen BBV-Präsidenten Stefan
Köhler der beim Betzensteiner Bauerntag über seine
bisherige Tätigkeit als Abgeordneter des
Europäischen Parlaments berichtet hatte.
Biobetriebe vor dem Aus / Neue EU-Bio-Verordnung schreibt Bauern Pflicht zur Weidehaltung vor
Melkendorf.
Ab 1. Januar 2026 werden ökologisch wirtschaftende
landwirtschaftliche Betriebe ihre Zertifizierung nur
noch behalten können, wenn alle ihre Tiere ab einem
halben Lebensjahr Zugang zur Weide bekommen. Für
Hermann Grampp aus Melkendorf bedeutet dies aufgrund
fehlender Flächen, dass der bisherige Bio-Betrieb ab
dem kommenden Jahr in die konventionelle
Landwirtschaft rückabgewickelt werden muss.
„Dieser Schritt wird wohl auch für zahlreiche weitere Ökobetriebe in Bayern so kommen und den Bioanteil in der Landwirtschaft deutlich reduzieren“, sagt Hermann Grampp. Gerade im Zusammenhang mit den verzinsten Rückforderungen der Bioprämie aus dem Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) für die zurückliegenden Jahre würden zahlreiche Betriebe in der Region vor existenzielle Herausforderungen gestellt. Aber auch die Milchhöfe und Schlachthöfe würden nachgelagert große Probleme bekommen, da die nachgefragte Menge an heimischer Milch und Fleisch nicht mehr in dem aktuellen Maß am Markt zur Verfügung stehen wird.
Hermann Grampp hatte deshalb zusammen mit Florian Schleicher vom Lindauer Biolandhof einen Informationstag veranstaltet. Dazu besuchten die Teilnehmer zunächst den Betrieb von Harald Küfner in Untergräfenthal bei Neudrossenfeld und von Holger Hofmann in Esbach bei Kulmbach, ehe sie sich auf dem Betrieb von Hermann Grampp in Unterkodach bei Melkendorf zum Austausch trafen.
„Mir bleibt nichts anderes übrig, als die Reißleine zu ziehen und auszusteigen“, sagte Hermann Grampp. Hintergrund ist, dass, sich von den gut 200 Hektar Fläche, die von ihm bewirtschaftet werden, nur ein kleiner Teil in seinem Eigentum befindet. Der weitaus größte Teil verteilt sich auf unterschiedlich große Feldstücke von 34 verschiedenen Pächtern. Diese Konstellation sei so oder ähnlich in ganz Oberfranken zu finden. Sollte die Weidepflicht so umgesetzt werden, würden schon allein deshalb alle großen Bio-Milchviehbetriebe nach und nach aussteigen.
Auch
wenn die EU-Richtlinie in Sachen Weidehaltung
bereits seit über 20 Jahren im Gespräch ist, habe
keiner damit gerechnet, dass sie jetzt so Knall auf
Fall umgesetzt wird, sagte Florian Schleicher.
„Keiner hat uns gewarnt.“ Der Landwirt plädierte
stattdessen für individuelle Lösungen, ansonsten
werde der Ökobereich stagnieren.
Was hinter der Richtlinie zur Weidehaltung steckt, erläuterte Klaus Schiffer-Weigand, ehemaliger Ökoberater an den hiesigen Ämtern für Landwirtschaft. Die Anforderungen der Gesellschaft in Sachen Tierwohl seien gestiegen, darauf gelte es zu reagieren. Er wunderte sich zwar über die schnelle Einführung, sagte aber trotzdem, dass die Weidemöglichkeiten auch in Oberfranken möglich seien. „Da ist Fantasie gefragt“, sagte er. Er warnte auch vor Illusionen: „Die Weide werden wir im Ökobereich nicht mehr wegbekommen“. Dafür sei es definitiv zu spät, doch: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“.
Immerhin seien in der Verordnung noch viele Einzelheiten offen, so Oliver Alletsee, Landesvorsitzender bei Bioland Bayern. Fest stehe der ständige Zugang zum Freigelände, solange es Witterung und Jahreszeit erlauben. Strukturelle Bedingungen führten dagegen zu keinen Einschränkungen der Weidepflicht. „Es war klar, dass wir die Weide nicht wegbekommen“, so Alletsee. Er machte aber auch unmissverständlich klar, dass das ganze EU-Recht sei und nicht etwa eine Bioland-Richtlinie. Kritik übte er am Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Ursprünglich habe sich der Verband in Sachen Umsetzung auf das Jahr 2027 eingestellt. „Da hat uns die Ministerin einen Strich durch die Rechnung gemacht.“ Michaela Kaniber sei zu einer längeren Frist nicht bereit gewesen.
Für Hermann Grampp ist das keine Option. „Das Risiko werde ich mit Sicherheit nicht eingehen“, sagte er. Er blieb dabei: „Ich werde die Reißleine ziehen, weil ich das nicht sauber umsetzen kann.“ Ein wenig Hoffnung kam von Thomas Sonntag von der Marktgesellschaft der Naturland-Bauern. „Wir versuchen noch zu erreichen, dass das Ganze lockerer gehandhabt wird.“ Sein Zusammenschluss habe bereits ein Moratorium vorgeschlagen, um Zeit zu gewinnen und eventuell eine Evaluierung durchführen zu können. „Es wird schwierig, aber wir wollen es versuchen, schließlich steht vieles auf dem Spiel.
Bilder:
1.
„Ich werde die Reißleine ziehen“: Landwirt Hermann
Grampp aus Unterkodach bei Melkendorf.
2. Auf
dem Betrieb von Hermann Grampp in Unterkodach bei
Melkendorf trafen sich zahlreiche Landwirte, um über
die EU-Richtlinie zur Weidehaltung zu diskutieren.
Mahnfeuer gegen Mercosur / Landwirte protestieren gegen Freihandelsabkommen
Kronach.
Die BBV Kreisverbände Bayreuth, Kulmbach und Kronach
haben mit einem Mahnfeuer auf dem Betrieb von
Herbert Hanna in Fröschbrunn bei Kronach gegen die
geplante Unterzeichnung des
Mercosur-Handelsabkommens protestiert. Die Bauern
aus allen drei Landkreisen folgten damit einer
Stellungnahme der BBV-Landesversammlung, bei dem die
Delegierten vor wenigen Tagen ein klares Nein der
bayerischen Landwirtschaft gegen das Abkommen
formuliert hatten.
„Wir Bauern stehen einem offenen Handel grundsätzlich positiv gegenüber, allerdings müssen Importe die gleichen hohen Anforderungen einhalten, wie sie auch für die heimische Erzeugung gelten“, sagte der Kulmbacher BBV-Kreisobmann Harald Peetz aus Himmelkron. „Wir befürchten gravierende Wettbewerbsnachteile für die heimische Lebensmittelerzeugung, wenn das Abkommen so in Kraft treten sollte“, so der BBV-Kreisgeschäftsführer Harald Köppel. Lebensmittelsicherheit, Umwelt-, Tier- und Klimaschutz würden mit dem Abkommen auf der Strecke bleiben, befürchtete der Kronacher BBV-Kreisobmann Klaus Siegelin.
Insgesamt
befürchten die Bauern bei einer Umsetzung des
Freihandelsabkommens schwerwiegende Folgen für die
heimische Landwirtschaft. Das Abkommen führe zu
einem weiter verstärkten ungleichen Wettbewerb, zu
mehr Marktdruck und schlechteren Vorgaben für die
heimischen Betriebe, so der BBV.
Wie berichtet wird das Abkommen aktuell verhandelt. Es sieht unter anderem vor, dass zum Beispiel billiges Rind- und Geflügelfleisch aus Südamerika nach Europa eingeführt werden kann. Der BBV fordert deshalb Maßnahmen, um Unterschiede in den internationalen und europäischen Standards auszugleichen. Ei weiteres Mahnfeuer wurde am Montagabend auf dem Betrieb des Wunsiedler Kreisobmanns Harald Fischer bei Marktleuthen entzündet.
Rekordbeteiligungen bei weihnachtlicher Traktorrundfahrt / 1000 Schaulustige in der Bayreuther Innenstadt
Bayreuth.
Nach der weihnachtlichen Traktorparade vor wenigen
Tagen in Kulmbach hat haben die Bayreuther Landwirte
am ersten Adventswochenende mit Rekordbeteiligungen,
sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den
Zuschauern für Aufsehen gesorgt. Fast 65 aufwändig
geschmückte Schlepper waren es diesmal in Bayreuth.
Die Veranstalter sprachen von einem riesigen
Publikumszuspruch, der ganz offensichtlich Jahr für
Jahr immer mehr zunimmt. So stand auch diesmal
wieder die halbe Stadt Kopf, die Zahl der
Schaulustigen links und rechts der rund sechs
Kilometer langen Strecke wurde von offizieller Seite
auf etwa 5000 geschätzt.
„Eine
Woche schmücken, eine Stunde fahren, und trotzdem
hat es sich gelohnt“, sagte einer der Landwirte.
Sämtliche Traktoren samt Anhängern, Unimogs und
andere landwirtschaftliche Fahrzeuge waren mit
glitzerndem Weihnachtsschmuck und vielen tausend
Lichter ausgestattet. Einige hatten Christbäume,
beleuchtete Sterne oder Schneemänner auf ihren
Fahrzeugen, die Landwirte hatten sich funkelnde
Nikolausmützen aufgesetzt, der Fantasie waren
praktisch keine Grenzen gesetzt. Landwirtin Stefanie
Will aus Röthelbach bei Bindlach, die seit Beginn
der weihnachtlichen Traktorrundfahrten in Bayreuth
die Fäden der Veranstaltung in Händen hält, hatte
einmal mehr in tagelanger Kleinarbeit ihrem John
Deere zum Leuchten gebracht.
Nach
den vielen schlechten Nachrichten über Kriege,
Konflikte und Inflation sei es bitter nötig, mit den
Lichtern Zeichen der Hoffnung zu setzen, so die
Veranstalter. Für die Landwirtschaft war die Aktion
aber auch wieder eine überaus gelungene
Imagewerbung. „Wir wollten ein Stückweit die
Landwirtschaft in die Stadt bringen und dabei eine
weihnachtliche Atmosphäre schaffen“, so einer der
Fahrer. „Wenn es uns dabei gelingt, dass der eine
oder andere etwas intensiver über die heimischen
Bauern nachdenkt, dann haben wir unser Ziel schon
erreicht“, sagte sein Berufskollege.
Die
Landwirte brachten dabei nicht nur Kinderaugen zum
Funkeln. Obwohl kaum Werbung für die Rundfahrt
gemacht wurde, säumten die vielen Schaulustigen
schon über eine Stude vor dem Start die Straßen und
ließen sich von der außergewöhnlichen Aktion
verzaubern. Sogar aus Mittelfranken, der Oberpfalz
und aus Thüringen waren Zuschauer angereist.
Politische Banner gab es nicht. Bei den Fahrten
wurde aber Geld für karitative Zwecke gesammelt. Die
Spenden sollen demnächst an den Kreisverband des
Bayerischen Roten Kreuzes für das Hospizmobil
„Herzenswunsch“ überreicht werden. Das Mobil führte
sogar den Zug an und war ebenfalls festlich
geschmückt.
In
Bayreuth ging es diesmal auf dem Geländer
Universität los, Polizei und Feuerwehr sicherten
dabei jeweils den Konvoi ab und sperrte kurzzeitig
sämtliche Kreuzungen. Nach der Fahrt über den
inneren Stadtkernring und den Stadtteil Hammerstatt
machten die Schlepper auf dem Volksfestplatz halt.
Dort gab es die Gelegenheit, die Fahrzeuge zu
fotografieren, mit den Bauern ins Gespräch zu kommen
und den Nikolaus höchstpersönlich zu treffen.
Außerdem hatten Landjugendgruppen und
Regionalvermarkter für Glühwein, Früchtepunsch, Tee,
Küchla, selbstgebackene Plätzchen und Bratwürste
gesorgt. Für Stimmung sorgte eine Samba-Formation
mit ihren Trommeln.
Bilder: Einen vorweihnachtlichen Glanzpunkt setzten zahlreiche Landwirte mit ihren Traktorrundfahrten am ersten Adventssamstag in Bayreuth. Sämtliche Schlepper waren dabei fantasievoll geschmückt und festlich beleuchtet.
„Gans to go“: Herausforderungen für die Gastronomie / Keine Chance für lokale Produzenten / Weihnachtsgans spielt noch immer wichtige Rolle
Wachenroth / Bamberg. „Die Preise für Gänse und Enten werden heuer tendenziell steigen“, sagt Horst Wichmann aus Wachenroth. Er mästet und schlachtet Enten und Gänse in seinem Familienbetrieb und vertreibt sie bundesweit. Horst Wichmann ist damit weit und breit einer der größten Geflügelproduzenten. Wachenroth im Ebrachtal liegt im Dreiländereck Unter-, Mittel- und Oberfranken und gehört zum Landkreis Erlangen-Höchstadt.
Futtermittel, Strom, alles werde teurer. Nach den Worten von Horst Wichmann darf man vor allem die LKW-Maut nicht unterschätzen. Dafür hätten sich die Kosten praktisch verdoppelt, was sich für seine Sparte als großes Problem erwiesen habe. Die Küken müssten hin- und hergefahren, das Futter transportiert werden.
Die Importe aus Osteuropa seien enorm, sagt der Enten- und Gänseproduzent. Dazu müsse man allerdings auch wissen, dass der Selbstversorgungsgrad in Deutschland bei unter zehn Prozent liege und damit den Takt vorgibt, wie es Horst Wichmann ausdrückt. Natürlich machten die Importe aus Osteuropa das Geschäft kaputt, lokale Anbieter hätten dagegen keine Chance und könnten bei den Preisen in keiner Weise mithalten.
Insgesamt spiele die Enten- und Gänseproduktion in Bayern eine untergeordnete Rolle. Es gebe ganz wenig professionelle Betriebe, ganze drei produzierten im größeren Ausmaß. Alles andere seien Landwirte, die vielleicht mal 50 Enten oder Gänse mitproduzieren oder es seien komplette Hobbyhaltungen mit einzelnen Tieren.
„Die Weihnachtsgans bleibt trotz der Herausforderungen ein zentraler Bestandteil der oberfränkischen Weihnachtsküche, sei es im Restaurant oder als Gans to go für das Festessen zu Hause.“ Das sagt Joachim Kastner, Bamberger Kreisvorsitzender und oberfränkischer Bezirksvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA Bayern). Die Verbraucher müssten sich allerdings in diesem Jahr auf leicht steigende Preise einstellen. Grund dafür seien neben der allgemeinen Inflation auch die gestiegenen Einkaufspreise für Gänse. „Futtermittel, Energie und Transportkosten sind im vergangenen Jahr deutlich teurer geworden, was sich unmittelbar auf die Preise auswirkt“, so Joachim Kastner.
Der Kreis- und Bezirksvorsitzende sagt auch, dass in der Gastronomie Importe aus osteuropäischen Ländern durchaus eine Rolle spielten. Grund dafür sei, dass der regionale Markt die hohe Nachfrage nach Weihnachtsgänsen nicht vollständig decken kann. Die Anzahl an einheimischen Geflügelzüchtern nehme durch die starken Auflagen durch die EU und die Lebensmittelbehörden immer mehr ab.
Nach den Worten von Joachim Kastner hat die Weihnachtsgans in Oberfranken eine lange Tradition und gehört für viele Gäste einfach zur festlichen Jahreszeit dazu. Restaurants und Gaststätten würden das Gericht sowohl als besonderes Menü in festlicher Atmosphäre als auch als Mitnahmeangebot anbieten, so dass Familien die Gans im eigenen Zuhause genießen könnten. „Die Gans bleibt ein wichtiges Symbol für Genuss, Geselligkeit und Tradition – gerade in diesen herausfordernden Zeiten.“
Die Gastronomiebranche in Oberfranken sehe sich in diesem Jahr mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, so der Vorsitzende. Die stark gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Energie und Personal belasteten die Betriebe massiv. Hinzu kommt der seit Januar wieder auf 19 Prozent erhöhte Mehrwertsteuersatz auf Speisen, der die wirtschaftliche Situation vieler Gastronomen zusätzlich erschwert. Während die meisten Betriebe versuchen, die steigenden Kosten nicht 1:1 an die Gäste weiterzugeben, seien Preisanpassungen unumgänglich, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Der Hotel- und Gaststättenverband in Oberfranken setze sich weiterhin dafür ein, dass die politischen Rahmenbedingungen für die Gastronomie verbessert werden. Eine Rückkehr zum reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Speisen wäre ein entscheidender Schritt, um die Branche langfristig zu stabilisieren. Joachim Kastner: „Gleichzeitig danken wir unseren Gästen, die mit ihrer Treue und ihrem Besuch einen wichtigen Beitrag zur regionalen Vielfalt leisten.“
Bild: Eigentlich sind sie Weidetiere, aber die Endmast der Weihnachtsgänse findet im Stall statt.
Oberfranken statt Osteuropa / Weihnachtsgänse aus dem Kulmbacher Land: Das Gut Dörnhof beliefert Privatleute und Gastronomen
Dörnhof.
„Wir müssen ein bisschen teurer sein als im
Supermarkt. Trotzdem soll sich noch jeder seine
Weihnachtsgans leisten können. Das sagt Jana Zink
vom Gut Dörnhof bei Kulmbach. Zusammen mit ihrem
Mann Julian hatte sie vor gut sieben Jahren die
damals leerstehende Hofstelle, ein ehemaliger
Milchviehbetrieb, gekauft und einen
landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut, der momentan
noch im Nebenerwerb geführt wird.
Neben Rindern, Schweinen, Ziegen und Schafen gibt es dort auch Enten und Gänse. 150 Gänse waren es in diesem Jahr und Jana Zink verspricht: „Wir werden die Preise heuer noch nicht anheben“. Noch heißt, dass für das kommende Jahr eine Preiserhöhung nicht auszuschließen ist. „Es wird ja alles so unfassbar teuer“, so die 29-Jährige. Momentan sei man schon nahe an der Schmerzensgrenze.
Kunden des Gutes Dörnhof sind in erster Linie Privatleute. Aber auch einige Gastronomen sind darunter. Jana und Julian Zink werben mit ihrer Internetseite und mit Flyern für ihren Betrieb. Auch einen kleinen Hofladen gibt es, der Zug um Zug ausgebaut werden soll und der im Moment noch auf Vertrauensbasis betrieben wird. Unter anderem ist Fleisch aus der Tiefkühltruhe, Marmelade und sogar Honig von einem befreundeten Imker aus Trebgast im Angebot.
Auch geschlachtet soll schon bald auf dem eigenen Betrieb werden. Julian hat nicht nur eine abgeschlossene Schreinerlehre, sondern ist auch Metzgermeister mit Sachkundenachweis zum Schlachten. Derzeit ist er hauptamtlich im Kulmbacher Schlachthof beschäftigt, so dass der Hof offiziell als Nebenerwerbsbetrieb gilt.
Angefangen hatte die Familie Zink mit 20 Gänsen für den Eigenbedarf und für Freunde. Dann seien es immer mehr geworden, sagt Julian, der mittlerweile von einer Riesennachfrage spricht. Die Konkurrenz aus Osteuropa fürchten die Familie Zinks dabei nicht so sehr. Wer im Supermarkt kauft, der werde auch weiterhin im Supermarkt kaufen. Und wer die Gans aus Oberfranken bevorzugt, werde sich hier auf die Suche machen.
„Gänse sind eigentlich Weidetiere“, erklärt Julian Zink. Den ganzen Sommer über haben sie auf der Wiese verbracht, die Endmast findet jetzt im neu gebauten Stall statt. „Zum Martinstag haben wir mit den ersten Schlachtungen begonnen“, so Julian Zink. Bis Weihnachten wird jedes Wochenende geschlachtet. Viele Abnehmer gebe es hier im Fränkischen auch für „Gansjung“ („Gänseklein“), also für die kleinen Stücke des Geflügels.
Jana Zink würde nicht behaupten, dass die Kunden aufgrund von vegetarischen oder veganen Bestrebungen in der Gesellschaft weniger werden. Im Gegenteil: „Wir verzeichnen einen jährlichen Zuwachs an Kunden“.
Der landwirtschaftliche Betrieb von Jana und Julian Zink ist breit aufgestellt. Im Stall stehen 15 Fleischrinder, das Paar hat Strohschweine, Ziegen zur Landschaftspflege im Auftrag der Stadt, drei Wohnmobilstellplätze „mit Blick auf die Plassenburg“ stehen zur Verfügung und eine Ferienwohnung soll noch dazu kommen. Der Hof ist nur 15 Hektar groß, Ackerbau betreibt das Paar nicht.
Der Betrieb der Familie Zink ist ein typischer Mehrgenerationenhof „so wie er früher einmal war“. Vier Generationen leben hier. Jana Zink kommt ursprünglich aus Norddeutschland, ihre Eltern und Großeltern sind mittlerweile nachgezogen. Sohn Jakob wurde 2001, Tochter Johanna 2023 geboren.
Bild: Jana und Julian Zink können sich über die Nachfrage nach ihren Weihnachtsgänsen aus dem Kulmbacher Land nicht beklagen.
Weniger Tiere, steigende Preise / Trotz Rückgängen bei den Vermarktungszahlen: Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben blickt zuversichtlich nach vorne
Trieb.
Trotz zurückgehender Tierhaltung und trotz eines
sinkenden Pro-Kopf-Fleischverzehrs: bei der
Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben sind die
Verantwortlichen guter Dinge. Grund: Der
Mengenrückgang bei praktisch sämtlichen Tierarten
und Sparten habe zur Stabilität des Preisniveaus
geführt, wie es der neue Geschäftsführer Mario Flemm
ausdrückte. Bei der Mitgliederversammlung des
Zusammenschlusses fiel ein Begriff auffällig oft:
höhere Haltungsformen.
„Darin sehen wir große Chancen“, so Vorstand Stephan Neher. Geschäftsführer Flemm stellte aber auch klar: „Wir sehen die Chancen, aber keine Notwendigkeit oder Pflicht für höhere Haltungsformen.“ Wie dem auch sei, der Lebensmitteleinzelhandel verlange immer mehr danach. „Wir wollen es nicht um jeden Preis“, so der Vorsitzende, auch die Haltungsstufe 1 werde weiterhin verlangt. Die Nachfrage am Markt sei aber da und damit auch eine gewisse Absatzsicherheit.
Weniger Tiere, knappes Angebot, gute Nachfrage, steigende Preise: Auf diesen Nenner brachte Geschäftsführer Flemm die Bilanz des zurückliegenden Wirtschaftsjahres. Er sah auch Licht am Ende des Tunnels, den zum ersten Mal seit rund zehn Jahren gab es beim Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch im zurückliegenden Jahr wieder einen leichten Anstieg. Dazu müsse man wissen, dass es die Jahre zuvor nur bergab ging. Nicht davon betroffen sei der Geflügelbereich, der verzeichne seit Jahren einen Anstieg.
Vorsitzender Stephan Neher glaubt auch fest daran, dass die Stimmung wieder kippt. Die Generation, die glaubt, die Welt durch Fleischverzicht retten zu können, sehe langsam ein, dass dies auch Geld koste. Vor allem setzte er starke Hoffnungen darauf, dass politisch wieder einiges ins rechte Licht gerückt wird. „Die Landwirtschaft wird wieder einen anderen Stellenwert bekommen“, sagte Neher und rief seine Berufskollegen dazu auf, mit Zuversicht nach vorne zu blicken.
Stephan Neher räumte aber auch ein, dass neue Wege eingeschlagen sind. Oft sei beim Catering gar kein Fleisch mehr dabei. Der Raststättenbetreiber „Tank & Rast“ habe gar nichts mehr vom Schwein im Angebot. Diesem Trend werde man sich nicht entziehen können. „Es ist eben alles im Umbruch“, so der Vorstand.
Der Geschäftsführer legte unter anderem die folgenden Zahlen vor: Beim Großvieh wurden 33537, sieben Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres vermarktet. Die Kühe gingen um 9,6 Prozent auf 7591 zurück. Bei den Färsen lag der Rückgang nur bei 1,5 Prozent auch 5177. Beim Nutzvieh wurden 24417 Stück und damit fünf Prozent weniger vermarktet, bei den Fressern 6393, was sieben Prozent weniger bedeutet. Bleiben noch die beiden stärksten Bereiche, die Schweine mit 434639 (minus fünf Prozent) und die Ferkel mit 728622 (minus 4,5 Prozent).
Der Erzeugerring Franken-Schwaben hat 2655 Mitglieder du beschäftigt 106 Mitarbeiter. Sie gilt als bedeutendste Vermarktungsorganisation für Nutz- und Schlachtvieh in Nord- und Westbayern. Hauptsitz ist das schwäbische Wertingen. Weitere Standorte sind Ansbach-Elpersdorf in Mittelfranken und Rödental-Spittelstein in Oberfranken.
Bild: Vorstand Stephan Neher, der bisherige Geschäftsführer Burkhard Hoch und der neue Geschäftsführer Mario Flemm (von links) stellten die Bilanz des Erzeugerrings Franken-Schwaben in Trieb bei Lichtenfels vor.
Leuchtende Traktoren und rollende Lichterketten / Weihnachtlich geschmückte Schlepper setzen „Lichter der Hoffnung“
Kulmbach. Sie waren die ersten in diesem Jahr in Oberfranken: die Kulmbacher Landwirte, die noch vor dem Totensonntag mit festlich geschmückten Traktoren durch die Innenstadt fuhren und besonders bei den vielen Kindern am Straßenrand für ungläubiges Staunen und funkelnde Augen sorgten.
Tannenzweige, Lichterketten, bunt blinkende LEDs in den riesigen Rädern und Nikolausmützen auf den Köpfen der Fahrer: so präsentierten sich die Bauern aus dem Kulmbacher Land der Stadtbevölkerung. „Wir wollen uns vor allem bei den Menschen bedanken“, sagte Lukas Schütz vom Organisationsteam. Bedanken dafür, dass die meisten Menschen hinter den Landwirten stehen, Verständnis für ihre Anliegen haben und deren Arbeit zu schätzen wissen. Politische Botschaften suchte man deshalb auch vergebens. Wir wollen lediglich auf uns aufmerksam machen und mit den Verbrauchern ins Gespräch kommen“, so Kathrin Erhard aus Motschenbach.
Nachdem
die weihnachtlichen Traktorkorsos in den
zurückliegenden Jahren bei Groß und Klein auf
riesigen Anklang gestoßen waren, haben sich auch
diesmal wieder zahlreiche Bauern aus Kulmbach mit
geschätzt 35 Fahrzeugen zusammengetan. Sie haben
ihre Schlepper festlich geschmückt und sich auf eine
Rundfahrt durch die Stadt gemacht.
Krieg, Inflation und viele schlechte Nachrichten: dagegen sollten auch diesmal wieder „Lichter der Hoffnung“ gesetzt werden, waren sich die beiden Hauptorganisatoren Kathrin Erhardt aus Motschenbach und Stefan Seidel aus Wacholder einig. „Wir wollten ein Stückweit die Landwirtschaft in die Stadt bringen und dabei eine weihnachtliche Atmosphäre schaffen“, so einer der Fahrer. „Wenn es uns dabei gelingt, dass der eine oder andere etwas intensiver über die heimischen Bauern nachdenkt, dann haben wir unser Ziel schon erreicht“, sagt sein Berufskollege.
Trotz
Temperaturen um die null Grad und einsetzenden
Schneefalls säumten viele hundert Schaulustige die
Straßen und ließen sich von der außergewöhnlichen
Aktion verzaubern. Ziel war es, einen
vorweihnachtlichen Farbtupfer in die Stadt und die
Landwirtschaft ins Gespräch zu bringen.
Endpunkt war heuer nicht der Schwimmbadparkplatz, wie noch im zurückliegenden Jahr, sondern der Parkplatz am Globus-Baumarkt an der Lichtenfelser Straße. Das war gut so, denn auch dort gab es stellenweise kaum mehr ein Durchkommen, so groß war der Andrang. An den Glühwein- und Bratwurstständen bildeten sich indes lange Schlangen.
Der
Traktorkorso war am Milchviehbetrieb von Hermann
Grampp in Melkendorf gestartet. Polizei und
Feuerwehr sicherten dabei den Konvoi ab. Nach der
Fahrt kreuz und quer durch die Innenstadt, unter
anderem durch Weiher, über den Holzmarkt und den
Zentralparkplatz gab es auf dem Baumarktparkplatz
die Gelegenheit, die Fahrzeuge zu fotografieren und
mit den Bauern ins Gespräch zu kommen. Glühwein,
Früchtepunsch, Tee und selbstgebackene Plätzchen
wurden dabei gegen eine Spende abgegeben. Der Erlös
kommt diesmal dem Hospizverein Kulmbach zugute.
Bilder: Einen vorweihnachtlichen Glanzpunkt setzten zahlreiche Landwirte mit ihren Traktorrundfahrten in Kulmbach. Sämtliche Schlepper waren dabei fantasievoll geschmückt und festlich beleuchtet.
Neues Klima trifft auf alte Baumarten / „Waldkontroversen“ an der Universität Bayreuth: „Die Mischung macht es“
Bayreuth.
„Neue Bäume braucht der Wald?“ Das Fragezeichen
hätten die Veranstalter der „Waldkontroversen“ an
der Universität Bayreuth getrost weglassen können.
Die Redner waren sich einig: „Wenn sich das Klima
bewegt, können die Wälder nicht stillstehen“, so
formulierte es Christian Kölling, Bereichsleiter
Forst beim Landwirtschaftsamt Fürth-Uffenheim (Bild
links).
Für den studierten Forstwirt stand fest: „Unser Wald hier wird nicht zum Klima der Zukunft passen.“ Christian Kölling sprach ganz offen von einer „Waldkrise“. Dort, wo die Kiefer jahrhundertelang gestanden habe, stehe sie jetzt nicht mehr. Im Frankenwald etwa. Dort könne man das ganze Elend schon sehen. Der Referent sprach von einem deprimierenden Zustand und einer bedrückenden Situation. Und er zeichnete ein düsteres Bild für die Zukunft: „Wir dürfen annehmen, dass der Klimawandel munter weitergeht.“ Konkret werde das hiesige Klima im mittleren Finnland herrschen, während in unseren Breiten ein südliches Klima dominieren wird, etwa wie in Kroatien, der nordwestitalienischen Region Piemont oder im südfranzösischen Languedoc.
Für
Muhidin Seho (Bild links) vom Bayerischen Amt für
Waldgenetik in Freising beginnt der Waldumbau bei
hochwertigem und herkunftsgesichertem Saatgut. „Die
Erbanlagen für den Zukunftswald stecken schon im
Saatgut“, sagte er. Schließlich gebe es für jede
Baumart auch Herkunftsunterschiede, die
berücksichtigt werden müssten. Der
Forstwissenschaftler sprach sich für mögliche
alternative Baumarten, aber auch für eine Stärkung
seltener heimischer Baumarten aus. Der Feldahorn
beispielsweise komme gut auf trockenen Standorten
zurecht. Muhidin Seho brachte auch heimische
Baumarten ins Gespräch, die bislang nur eine
Nebenrolle gespielt hätten, wie Spitzahorn,
Hainbuche oder Sommerlinde. Auch Flatterulme,
Speierling oder Eibe gehörten in diese Kategorie.
„Die
richtige Mischung macht es“. So lautete auch das
Credo von Andreas Bolte (Bild links) vom
Thünen-Institut für Waldökosysteme. Er gab zu
bedenken, dass Waldbauliche Entscheidungen in der
Regel für viele Jahrzehnte Bestand hätten. Der
Wissenschaftler hatte interessante Zahlen im Gepäck.
Laut Bundeswaldinventur sei in Deutschland zuletzt
die Douglasie gefolgt von der Japanischen Lärche und
der Roteiche mit fast fünf Prozent die wichtigste
nicht heimische Baumart im Hauptbestand gewesen.
Besonders stark verbreitet hätten sich in den
zurückliegenden zehn Jahren auch die Robinie und die
Spätblühende Traubenkirsche.
Die Wahl der Roteiche zum Baum des Jahres 2025 zeigt nach den Worten von Andreas Bolte aber auch, dass manch eine Baumart zu Konflikten führen könne. Während der Landesbund für Vogelschutz argumentiert, dass die Roteiche die Artenvielfalt gefährde, hatten gleich mehrere Naturschutzverbände darauf hingewiesen, dass sich bei der Wahl einmal mehr Vertreter gewinnorientierter Forstwirtschaft durchgesetzt hätten.
Welche Auswirkungen neue Baumarten auf das Waldökosystem haben, zeigten die beiden Professorinnen Elisabeth Obermaier und Johanna Pausch von der Universität Bayreuth auf. Exotische Baumarten seien potenziell wichtig, aber auch problematisch, so Elisabeth Obermaier. Sie stellte fest, dass die Insektendiversität mit zunehmender verwandtschaftlicher Entfernung der Baumarten von heimischen Referenzbaumarten abnehme. Deswegen sollten neben den Chancen auch die Risiken exotischer Baumarten im Hinblick auf ihre Ökosystemfunktionen untersucht werden. Schließlich stellten Insekten über 60 Prozent aller Arten weltweit und seien eine wichtige Lebensgrundlage für Vögel und viele Säugetiere. Dem pflichtete auch Johanna Pausch bei. Sie hatte die Interaktion zwischen Bäumen und Pilzen untersucht und war unter anderem zu dem Ergebnis gekommen, dass Pilznetzwerke gigantische Mengen an Kohlenstoff speichern. Besonders Mischwälder würden diese Speicherung fördern.
Borkenkäfer 2.0 im Anmarsch? / Augen offenhalten: Japankäfer ist in Bayern angekommen
Kulmbach. Nach der Schweiz und Baden-Württemberg ist der Japankäfer (Popillia japonica) nun auch in Bayern angekommen. Laut Bayerischer Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) wurde der Käfer in einer Falle bei Lindau entdeckt und mittlerweile auch amtlich bestätigt. Der Blatthornkäfer stammt ursprünglich aus Asien, er ernährt sich von mehr als 300 Wirtspflanzen. In Europa gilt er offiziell als „prioritärer Quarantäneschädling“ und ist meldepflichtig.
Zurzeit sei der Japankäfer noch kein Problem, sagt Harald Köppel, Geschäftsführer des Bauernverbandes für Bayreuth, Kulmbach und Kronach. „im Moment haben wir ihn noch nicht.“ Haralds Köppel geht aber davon aus, dass der Käfer die nächste Katastrophe ist, „die auf uns zurollt, dort, wo sich der Käfer ausbreitet.“
Der Japankäfer konzentriere sich ja nicht nur auf Bäume oder gar auf eine einzelne Baumart, wie der Borkenkäfer an der Fichte. Im Gegenteil, der Käfer habe ein breites Nahrungsspektrum, Mais gehöre dazu, Kartoffeln, auch Obstbäume, Himbeeren, Brombeeren und sogar Zierpflanzen. „Der Japankäfer nimmt sich einfach das, was er bekommt. Wenn der mal bei uns kommen sollte, dann wird es richtig gefährlich.“ Harald Köppel geht allerdings davon aus, dass der Käfer in diesem und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr in unseren Breiten noch kein Problem wird. Trotzdem: „In Bayern ist er angekommen.“
Der BBV-Geschäftsführer rät, die Bestände noch ein wenig genauer zu kontrollieren als üblich. Eine richtige Bekämpfungsstrategie gebe es ohnehin noch nicht. „Man muss es halt wirklich im Auge behalten.“ Harald Köppel weist auch darauf hin, dass der Käfer ein markantes Erscheinungsbild habe und in jedem Fall auffällt. Man müsse die Leute schon ein wenig sensibilisieren, damit Auffälligkeiten sofort gemeldet werden können, um eine mögliche Bekämpfungsstrategie einzuleiten. Mit Sicherheit werde an den entsprechenden Stellen schon daran gearbeitet, was man gegen den Käfer unternehmen könnte.
Harald Köppel vergleicht den Japankäfer mit dem Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera). Das Auftauchen beider Schädlinge seien Ergebnisse der Globalisierung, die man nicht verhindern könne. Auch der Maiswurzelbohrer sei eine Käferart, die ursprünglich im mittleren Amerika angesiedelt war und die sich längst auch in Europa eingebürgert habe und hierzulande in zunehmendem Maß Maisanbauflächen schädigt.
„Der Japankäfer ist bei uns gerade noch kein Thema“, sagt auch Christian Dormann, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Hollfeld, zu der auch viele Waldbauern aus dem Landkreis Kulmbach gehören. Dormann sagt aber auch: „Das bedeutet nicht, dass sich das in Zukunft nicht ändern könnte.“ Er erwarte hier aber für unsere Region in den kommenden Jahren noch keine unmittelbare Bedrohungslage wie beim heimischen Fichtenborkenkäfer. „Langfristig werden wir uns aber leider auf diesen neuen Schädling einstellen müssen“, so Christian Dormann.
Auch Theo Kaiser von der Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach sieht noch keinen Grund zur Panik. Für den Japankäfer seien Nadelhölzer nicht so interessant. Die Käfer richteten den Hauptschaden in Sträuchern und Laubholz an. Die Larven lebten im Boden und schädigten vor allem die Wurzeln.
Die Landesanstalt für Landwirtschaft ruft die Bevölkerung auf ihrer Internetseite dazu auf, eventuelle Sichtungen zu melden. Der Japankäfer könne allerdings leicht mit anderen, nicht meldepflichtigen und harmlosen einheimischen Käfern verwechselt werden, so heißt es in der Mitteilung. Daher komme es schon bisher zu etlichen Falschmeldungen. Um diese zu reduzieren, bittet die LfL, die Funde beziehungsweise die gemachten Fotos vor der Meldung mit den Bildern auf der Homepage zu vergleichen. Dort heißt es: „Wenn Sie sicher sind, dass es sich bei Ihrer Sichtung um einen Japankäfer handelt, dann melden Sie diesen bitte unter Popillia@lfl.bayern.de mit Foto und Angabe des Fundorts. Die Käfer fangen Sie nach Möglichkeit bitte lebend ein und lassen Sie, wenn es sich um eine Verwechslung handelt, wieder frei.“
„In meinem Wirkungsbereich ist er zum Glück bisher nicht aufgetreten, auch innerhalb unserer WBV ist mir nichts bekannt“, sagt Stadtförsterin Carmen Hombach. Ihre Empfehlung ist es, sich mit dem Käfer auseinander zu setzen, damit man ihn erkennt, wenn er da ist und immer die Augen offen zu halten, falls Befallsmerkmale an den Bäumen da sind, die auf ihn hindeuten würden. Carmen Hombach: „Ein Befall und das Vorkommen des Käfers ist meldepflichtig, so dass man auf jeden Fall wachsam bleiben muss.“
Woran erkennt man einen Japankäfer:
Der Käfer besitzt ein metallisch-grün schimmernden Halsschild sowie braune Flügeldecken und ist nur etwa ein Zentimeter groß. Er ähnelt dadurch dem in Deutschland häufig vorkommenden heimischen Gartenlaubkäfer und kann bei flüchtigem Hinsehen leicht mit diesem verwechselt werden. Anders als der Gartenlaubkäfer besitzt der Japankäfer aber deutlich erkennbare weiße Haarbüschel seitlich am Körper unterhalb der Flügeldecken und am Hinterleib.
Welche Pflanzen befällt der Japankäfer:
Acker- und
Gemüsebau: Mais, Kartoffel, Spargel, Tomate und
Bohnen
Beerenobst: Himbeere, Brombeere, Erdbeere und
Heidelbeere
Ertragsobstsorten: Apfel, Kirsche und Zwetschge
Wein
Waldbäume: Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Linde, Ulme,
Pappel, Lärche
Fünf Sterne auf dem Bauernhof / Großer Zuspruch beim Oberfränkischer Tag der offenen Ferienwohnung im Hofer Land
Zedtwitz.
Selbstverständlich ist es nicht, dass Betriebe die
Türen für ihre Konkurrenz öffnen. Bei
landwirtschaftlichen Beherbergungsbetrieben ist das
etwas anderes. Da geht es darum Ideen und Anregungen
zu sammeln, mit den Mitbewerbern ins Gespräch zu
kommen und das zu betreiben, was man neudeutsch als
Networking bezeichnet. Beim ersten oberfränkischen
„Tag der offenen Ferienwohnung“ nach Corona haben
erstaunlich viele Anbieter von „Urlaub auf dem
Bauernhof“ dieses Angebot genutzt.
Neben zwei Betrieben in Münchberg hatte auch der Bergrödelhof in Zedtwitz seine Türen geöffnet. So ganz stimmt das mit dem „Urlaub auf dem Bauernhof“ dort allerdings nicht. „Wir wollen keine falschen Erwartungen wecken“, sagt Daniela Rödel. Von zwei Katzen abgesehen gibt es auf dem Bergrödelhof keine Tiere mehr. „Wir haben keinen Streichelzoo“, so Daniela Rödel. Attraktiv ist der Hof trotzdem, Und wie! Sechs Ferienwohnungen sind in einem zuletzt leerstehenden landwirtschaftlichen Gebäude entstanden, darunter zwei exquisite Lofts, alles mit fünf Sternen zertifiziert.
Bis
in die 1990er Jahre hinein gab es auf dem über 200
Jahre alten Bergrödelhof noch Milchvieh. Dann stand
der ehemalige Stall erst einmal leer. Vier
Generationen lebten zweitweise unter einem Dach, 70
Hektar landwirtschaftlicher Fläche wurden und werden
noch heute bewirtschaftet. Längst allerdings im
Nebenerwerb. Jürgen Rödel (55) ist hauptberuflich
als Firmenkundenbetreuer bei der Sparkasse tätig,
Ehefrau Daniela ist Betriebswirtin und arbeitet bei
der Rehau AG.
Nach entsprechenden Beratungen beim Amt für Landwirtschaft entschloss sich die Familie, richtig Geld in die Hand zu nehmen und im großen Stil zu investieren. „Einen Neubau kann ja jeder hinstellen, wir haben uns entschlossen, die alte Substanz beizubehalten“, so Jürgen Rödel. Im September 2020 und damit mitten in der Corona-Zeit traf die Baugenehmigung ein, danach wurde die früheren landwirtschaftlichen Gebäude Zug um Zug zurückgebaut. Am 30. Dezember 2022 waren die ersten Gäste auf dem Bergrödelhof eingetroffen und seitdem kann sich die Familie nicht beklagen. Geworben wird vor allem über die sozialen Medien Facebook, Instagram und über die eigene Website www.bergroedelhof.de.
„Unsere
Zielgruppe sind Aktivurlauber und Genießer“, sagt
Daniela Rödel. Die jüngsten Gäste bisher waren 20
Jahre alt, die ältesten 85 Jahre jung. Viele kommen
zum zweiten und dritten Mal, mittlerweile gebe es
schon richtige Stammgäste aus dem In- und Ausland.
Am weitesten angereist waren bislang Urlauber aus
Aserbaidschan. Sie alle bekommen aber auch einiges
geboten. Fichtelgebirge und Vogtland liegen
praktisch vor der Haustür, im Bergrödelhof selbst
gib es einen Wellnessbereich mit
Physiotherapiekabine und Kneippbecken eine
Aktivscheune mit Tischtennis, Kicker und vielen
anderen Angeboten.
Was eine Ferienwohnung besonders auszeichnet, ist, dass es im Gegensatz zu Hotels keine Anonymität gibt, sagte der Landtagsabgeordnete Kristan von Waldenfels, der genauso wie Landrat Oliver Bär die Gelegenheit nutzte, den Bergrödelhof in Augenschein zu nehmen. Vom großen touristischen Potenzial der Region schwärmte der Landrat. Er appellierte an alle Anbieter, selbstbewusst aufzutreten, schließlich sei der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.
Die
anderen beiden Betriebe, die sich am „Tag der
offenen Ferienwohnung“ beteiligten waren „Höra´s
Appartements“ in Grund bei Münchberg und „Chalet VÜ“
der Familie Wolfrum in Mechlenreuth bei Münchberg.
Die Familie Höra bietet bereits seit über 40 Jahren
Urlaub auf dem Bauernhof an. Durch den Neubau eines
Gästehauses mit zehn Appartements wurde das
bisherige Angebot verdreifacht. Alle zehn
Appartements sind barrierefrei, zwei sogar
rollstuhlgerecht ausgebaut.
Den Neueinstieg in die Vermietung hat die Familie Wolfrum in Mechlenreuth gewagt. Nach dreijähriger Bauzeit konnten drei luxuriöse Terrassenchalets mit exklusiver Wellnessausstattung eröffnet werden. Jedes Haus hat eine eigene Sauna und einen Whirlpool auf der Terrasse.
Bilder:
1. Auf
dem Bergrödelhof in Zedtwitz fand die zentrale
Veranstaltung zum „Tag der offenen Ferienwohnung
statt (von links): Landrat Oliver Bär, Daniela und
Jürgen Rödel, Waltraud Seuß vom Amt für
Landwirtschaft, Amtschef Michael Schmidt und der
Landtagsabgeordnete Kristan von Waldenfels.
2. Freuten
sich über den großen Zuspruch: Daniela und Jürgen
Rödel vom Bergrödelhof in Zedtwitz.
3. Auf
das modernste ausgestattet sind die Küchen in den
Ferienwohnungen und Lofts, die Daniela Rödel den
Besuchern präsentierte.
4. Hier
lässt es sich träumen: So sehen die Schlafzimmer in
den Ferienwohnungen des Bergrödelhofes aus.
Weniger Mitglieder, weniger Einsatzstunden / Maschinenring Bamberg: Fördermitglieder müssen künftig tiefer in die Tasche greifen
Pettstadt.
Preissteigerungen, die Corona-Nachwirkungen und ein
Mitgliederschwund machen dem Maschinen- und
Betriebshilfsring Bamberg zu schaffen. Trotzdem:
„Wir sind nicht auf dem absteigenden Ast“, so der
stellvertretende Vorsitzende Fred Einwich bei der
Mitgliederversammlung in Pettstadt. Im Gegenteil:
„Für die Zeit sind wir auf einem guten Weg“, so der
stellvertretende Vorsitzende weiter.
Tatsächlich waren die Zahlen eher rückläufig. Vorsitzender Andreas Hoffmann berichtete von 11029 geleisteten sozialen Einsatzstunden der Betriebshelfer, rund 600 weniger als im Jahr zuvor, und rund 2500 weniger als noch 2021. Soziale Arbeitsstunden fallen immer dann an, wenn eine Arbeitskraft beispielsweise wegen eines Krankenhausaufenthalts, einer Kur- oder Rehamaßnahme ausfällt. Kaum eine Rolle spielt beim Maschinenring Bamberg die wirtschaftliche Betriebshilfe, etwa zur Abdeckung von Arbeitsspitzen oder zur Urlaubsvertretung. Hier waren im zurückliegenden Jahr gerade einmal knapp 550 Stunden zusammengekommen.
Den weit überwiegenden Teil des Verrechnungswertes, also der Summe aller Leistungen, in Höhe von gut zwei Millionen Euro macht der Maschinen- und Technikverleih und damit das klassische Kerngeschäft der Maschinenringe aus. Schwerpunkte waren dabei die Bereiche Futterbau und Strohernte sowie die Hackfruchternte. Eine Besonderheit in der Gärtnerstadt Bamberg ist der Bereich der Landschaftspflege, der ebenfalls zu einem großen Teil mit in den gesamten Verrechnungswert miteinfließt.
Der Maschinen- und Betriebshilfering Bamberg hatte im zurückliegenden Jahr der Statistik zufolge 701 Mitglieder, die zusammen eine Fläche von 31725 Hektar bewirtschaften. Dazu kommen 430 Fördermitglieder, also Mitglieder, die keinen landwirtschaftlichen Betrieb haben, die aber den Ring trotzdem unterstützen und dafür auch von den zahlreichen Einkaufsvorteilen profitieren können.
Um auch weiterhin so schlagkräftig zu bleiben, wurde der Jahresbeitrag der Fördermitglieder ohne Diskussion und Gegenstimme von bisher 80 auf künftig 95 Euro erhöht. Damit bleibe für die meisten Mitglieder der Beitrag stabil, sagte Vorsitzender Andreas Hoffmann. Er räumte aber auch ein, dass die Zahl der Fördermitglieder ebenfalls stark rückläufig ist.
Bei der Mitgliederversammlung würdigten sämtliche Redner die Arbeit des Maschinenrings und stellten dessen existenzielle Bedeutung für die Landwirtschaft im Bamberger Raum heraus. „Ohne Maschinenringe kein starker ländlicher Raum, sagte der stellvertretende Bamberger Landrat Bruno Kellner. Von einer wichtigen Partnerorganisation sprach Matthias Görl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Matthias Görl war vor vielen Jahren selbst einmal als festangestellter Betriebshelfer für den Maschinenring tätig. „Die Ringe tragen wesentlich dazu bei, dass die Landwirte modern aufgestellt sind und wirtschaftlich arbeiten können“, so der 2. Bürgermeister von Pettstadt Michael Reichert.
Neu im Team des MR Bamberg ist Jonathan Leitner. Der 24-Jährige aus dem unterfränkischen Nachbarlandkreis Hassberge ist als Fachkraft Agrarservice tätig und hat die Technikerschule in Triesdorf abgeschlossen. In der Geschäftsstelle kümmert er sich hauptsächlich um die Düngeberatung und die Mietmaschinen.
Bild: Jonathan Leistner (Mitte) ist der neue beim Maschinen- und Betriebshilfsring Bamberg. Vorsitzender Andreas Hoffman (links) und dessen Stellvertreter Fred Einwich stellten den 24-Jährigen bei der Mitgliederversammlung vor.
Nordmanntannen statt Kunststoffbäume / In diesen Tagen beginnt der Einschlag auf den Christbaumplantagen im Kulmbacher Oberland
Petschen.
Wenn überhaupt, dann wird es höchstens eine „sehr
moderate“ Preiserhöhung sein, verspricht Uwe
Witzgall, Landwirt aus Petschen bei Stadtsteinach.
Seit mittlerweile zwölf Jahren baut der 54-Jährige
auf rund 30 Hektar Fläche im Kulmbacher Oberland
Christbäume, hauptsächlich Nordmanntannen, in
geringerer Stückzahl auch Nobilis-Tannen,
Blaufichten und Schwarzkiefern, an und beliefert
damit Händler in ganz Deutschland. Der Hof und die
Plantagen liegen direkt auf der Fränkischen Linie
auf rund 540 Meter über Normalnull.
„Mir ist es wichtig, dass die Leute überhaupt noch einen Christbaum haben“, sagt er. Nicht nur wegen dem Geschäft. Das sei doch schließlich eine Tradition, die man nicht dem Zeitgeist opfern dürfe. Gerade jetzt, wo so viele schlechte Nachrichten, etwa über die Kriege in der Welt, das Geschehen beherrschten. Uwe Witzgall ist aber auch fest entschlossen, das Feld nicht den Kunststoffbäumen zu überlassen, ein Trend, der immer wieder mal aufkommt und besonders in großstädtischem Umfeld ein Thema sei.
Allerdings merkt auch der Landwirt, dass die Bäume kleiner werden. Wollten die Menschen früher einen 2,30-Meter-Baum, so tut es jetzt ein 1,80-Meter großer Baum auch. Einfacher ist das Geschäft auch für ihn nicht geworden. Steigende Energiekosten, ein höherer Mindestlohn, sinkende Mehrwertsteuer-Pauschalierungssätze für die Landwirtschaft, Standmiete, Werbung, das alles schlage schon gewaltig zu Buche.
Was das Wachstum der Bäume betrifft, so spricht Uwe Witzgall von einem ganz normalen Jahr. Die Frühjahrspflanzung sei problemlos verlaufen, die Niederschläge hätten ausgereicht und die Tage mit extremer Hitze hätten sich in Grenzen gehalten. Nun beginnt der Einschlag. Wobei die ersten Großbäume schon ausgeliefert wurden, etwa für den Wintermarkt des Porzellanherstellers Rosenthal in Selb. Auch Schnittgrün für Garten- und Grabbedeckungen sowie für Kränze sei schon bereitet worden und auch die wenigen Topfbäume, die immer wieder verlangt würden. Sechs festangestellte Mitarbeiter hat Uwe Witzgall, einzelne Hilfskräfte kommen in den nächsten Tagen noch dazu.
Der reguläre Verkauf beginnt dann am Wochenende des 1. Advents. An den beiden darauffolgenden Wochenenden (7. und 8. Dezember sowie 14. und 15. Dezember zwischen 10 und 16 Uhr) kann man sich dann seinen Christbaum vor Ort auf der Plantage zwischen Vorderreuth und Schwandt selbst aussuchen und gegebenenfalls auch selbst schlagen. Ansonsten gibt es die Christbäume aus dem Kulmbacher Oberland beispielsweise in Kronach, Kulmbach (Samen Hühnlein) oder Hof (Rathausbrunnen).
Neu ist bei Uwe Witzgall, dass viele der Verpackungsnetze aus biologisch abbaubarem Material sind. Viel Müll habe man ja sowieso nicht, denn so ein Netz wiege gerade mal 16 Gramm. Auch der Pflanzenschutz sei immer wieder ein Thema, doch viel gespritzt werde auf den Plantagen ohnehin nicht, nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Gegen Unkraut gehe man mechanisch vor. Probleme bereitet dann schon eher das zunehmende Rehwild. „Die Zäune müssen in Ordnung sein, sonst kann es schnell richtig teuer werden“, sagt Uwe Witzgall. Deshalb muss er ständig die Zäune kontrollieren.
Um sich von der Billigkonkurrenz der Baumärkte abzugrenzen, legt Uwe Witzgall allergrößten Wert auf Qualität. Das heißt, dass alle Bäume aus Petschen seit 2018 das Siegel „geprüfte Qualität Bayern” tragen dürfen. Das Gütesiegel besagt, dass festgelegte Produktionskriterien eingehalten und auch regelmäßig kontrolliert werden. Dazu gehört zum Beispiel ein späterer Schnittzeitpunkt. Außerdem wurde der Betrieb nach den Standards von GLOBAL G.A.P. zertifiziert, was die Erfüllung noch höherer Standards bedeutet. Sie beginnen von der Anpflanzung über die Produktion bis hin zur Ernte, praktisch in allen Bereichen.
Einen Tipp hat Uwe Witzgall für alle Christbaumbesitzer: „Der gekaufte Baum sollte vor dem Aufstellen schattig und im Freien liegen, dann hält er am längsten“. In der Wohnung sollte anschließend ein kleines Stück abgesägt und der Ständer mit Wasser gefüllt werden. So hat man am längsten seine Freude an den Weihnachtsbäumen aus dem Frankenwald.
Auch Norbert Grass von Christbaumgrass in Wahl bei Presseck spricht von guter Qualität. „Heuer schaut es sehr gut aus“, sagt er. Das Wetter habe sich sehr positiv auf die Bäume ausgewirkt. Es habe genug Niederschläge und ausreichend Feuchtigkeit gegeben, die Hitzetage hätten die Tannen gut überstanden. Zur Monatsmitte gehe es mit dem Einschlag los, so Norbert Grass. Die Tage und Wochen zuvor laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Da müssten beispielsweise sämtliche Gerätschaften überprüft und hergerichtet werden.
Die Bäume von Christbaumgrass gibt es auf dem Hof in Wahl 5 bei Presseck, immer donnerstags bis sonntags. Die ersten Bäume könnten bereits so um den 25. November herum abgeholt werden. Norbert Grass baut auf etwa sieben Hektar Christbäume an.
Auch Norbert Grass hat einen Tipp für alle Christbaumbesitzer, um die Haltbarkeit zu verbessern: Die Bäume sollten auf jeden Fall schattig und im Freien gelagert werden, auf keinen Fall in der Sonne. Am besten ist ein Platz unter einer Hecke, wo der Baum auch weiterhin Feuchtigkeit bekommt, denn der Baum nimmt ja auch weiterhin Feuchtigkeit über die Nadeln auf. Und ab Heiligabend würde Norbert Grass auf jeden Fall einen Wasserständer bevorzugen.
Auch bei Günther Burger aus Wildenstein bei Presseck geh es Mitte November mit dem Einschlag los. Er baut auf rund acht Hektar hauptsächlich Nordmann-Tannen, Nobilis und vereinzelt auch Kiefern an. „Die Bäume sind gut gewachsen, haben eine gute Farbe und die Nadeln sind voll“, sagt Günther Burger. Auch er geht eventuell von einer moderaten Anhebung der Preise aus, will aber versuchen, die Preise des Vorjahres im Großen und Ganzen zu halten. Die Löhne seien gestiegen, die Materialien seien teurer geworden. Günther Burger verkauft seine Bäume in Kulmbach beim Globus Baumarkt und nebenan auf dem Parkplatz beim Tedox-Markt.
Schon Mitte Oktober beginnt Günther Burger, Tannenzweige zu machen. Durch die Entnahme von Schnittgrün könne man die Kulturen pflegen. „Ist ein Baum nicht so schön geraten, kann man die Äste wegmachen, dann wächst der nebendran um so schöner.“ Das Schnittgrün sei freilich nicht das große Geschäft, aber dadurch könne man nicht zuletzt auch nachweisen, dass man wirklich eigene Kulturen besitze.
Damit man lange seine Freude am Baum hat, rät Günther Burger, den Baum keinesfalls neben den Ofen oder neben die Heizung zu stellen. Bei einer Fußbodenheizung sollte man auf jeden Fall eine Decke unter den Baum legen, damit die aufsteigende Hitze die Nadeln nicht dürr werden lässt und der Baum austrocknet. Ein Fehler sei es auch, den Baum vor dem Aufstellen in die Garage oder in einen Schuppen zu stellen. Der Baum sollte draußen im Freien stehen, am besten im Garten an einen Baum gelehnt, so dass es drauf regnen oder schneien kann, dann hält der Baum am längsten.
Pflegetipps vom
Verband Bayerischer Christbaumbesitzer:
-
Schützen Sie
den Baum beim Transport vor Sprühwasser von der
Straße (Salzwasser).
- Stellen Sie den Baum direkt nach dem Kauf im Netz
an einen kühlen Ort in einen Eimer Wasser.
- Empfehlenswert sind Ständer mit Wasserbehälter.
Bevor Sie den Baum dort hineinstellen, idealerweise
noch mal frisch anschneiden, aufrichten, dann das
Netz entfernen.
- Der Baum lässt sich leichter schmücken, wenn er
einen Tag zuvor aufgestellt wird, damit mit sich die
Zweige senken.
- Vermeiden Sie Heizungsnähe und gießen Sie
regelmäßig, denn ein zimmerhoher Baum braucht bis zu
2 l pro Tag.
Bild: Ruhe vor dem Sturm: Schon in wenigen Tagen wird auf den Christbaumplantagen von Uwe Witzgall in Petschen bei Stadtsteinach Hochbetrieb herrschen.
Nicht nur zu Halloween: Kürbisse aus dem Kulmbacher Land
Oberpöllitz.
Halloween-Zeit ist Kürbiszeit. Seitdem der Brauch
immer beliebter wird, machen sich auch immer mehr
Kürbisse auf deutschen Feldern breit. So recht
scheint das im Kulmbacher Land aber noch nicht
angekommen. Mit Kerstin Stenglein aus dem kleinen
Weiler Oberpöllitz bei Marktschorgast gibt es wohl
nur einen einzigen landwirtschaftlichen Betrieb, der
im großen Stil Kürbisse anbaut. Die Kürbisse, die an
den Bundesstraßen aufgetürmt sind, kommen von einer
niederbayerischen Firma, Zierkürbisse in den
Supermärkten meist aus dem Ausland.
Doch Kerstin Stenglein macht sich tatsächlich noch die Mühe, neben ihrer Landwirtschaft mit Ackerbau und Bullenmast, alljährlich auch Kürbisse im großen Stil anzubauen. Bis zu 10000 Kürbisse seien es in manchen Jahren schon gewesen, mittlerweile habe sie die Kürbisproduktion ein wenig zurückgefahren, doch ein paar tausend waren es sicher auch heuer wieder, die auf dem 0,35 Hektar großen Feldstück gewachsen sind.
2008
hatte sie mit den Kürbissen begonnen. Der damalige
BBV-Kreisobmann Hermann Mohr hatte in Österreich
Kürbisse entdeckt und wollte unbedingt, dass die
Frankenfarm in Himmelkron ebenfalls Kürbisse
anbietet. Kerstin Stengleins mittlerweile
verstorbener Vater Karl Kister, der wie Hermann Mohr
zu den Gründervätern der Frankenfarm gehörte, ebnete
den Weg und so gab es lange Jahre heimische Kürbisse
in der Frankenfarm. Sogar ein eigenes Kürbisfest
wurde dort bis zur Corona-Zeit veranstaltet.
Mittlerweile gibt es Zier-, Schnitz- und Speisekürbisse nur noch direkt auf dem idyllisch gelegenen Hof von Kerstin Stenglein unweit der Gemeindeverbindungsstraße von Wirsberg nach Marktschorgast. „Aufgrund der nassen Witterung hatten wir heuer weniger“, sagt Kerstin Stenglein. Was Speisekürbisse betrifft sei es schon beinahe ein Totalausfall gewesen. Zier- und Halloweenkürbisse habe es dagegen genug gegeben. Kerstin Stenglein hat die Vermutung, dass der viele Regen während der Blütezeit daran schuld war, dass heuer eigentlich ein relativ schlechtes Kürbisjahr gewesen sei. Doch noch kann sie auf dem Hof genug anbieten, die Zierkürbisse in der Regel für einen Euro, die großen Speisekürbisse für acht bis zehn Euro.
Bei
Kerstin Stenglein werden die Kürbisse Mitte Mai
gesät. Heuer habe sie nicht einmal gegen Unkraut
gespritzt. Die Ernte finde dann am ersten
Septemberwochenende statt. Freunde und Bekannte
helfen bei der schweißtreibenden Arbeit tatkräftig
mit. Mitte September gibt es dann das Kürbisfest auf
dem Hof, sozusagen der offizielle Verkaufsstart mit
Kinderprogramm. Werbung hat sie gar nicht mehr
nötig. Mittlerweile sei die Vermarktung zum
Selbstläufer geworden und funktioniere über
Mund-zu-Mund-Propaganda. „Es gibt schon auch eine
treue Kundschaft, die jedes Jahr wiederkommt“, sagt
Kerstin Stenglein. Außerdem werbe sie auf den
sozialen Medien und an der Gemeindeverbindungsstraße
weist ein großes Schild auf den Kürbisverkauf hin.
Natürlich kann man mit Kürbissen viel mehr machen, als ihn zu Halloween möglichst kunstvoll zu präsentieren. Da gibt es Kürbisöl und Kürbiskerne, die Kerstin Schnell von einem Landwirt aus dem Nürnberger Land bezieht. Doch auch mit den Kürbissen aus Oberpöllitz kann man so einige leckere Speisen zubereiten. Kürbis-Risotto beispielsweise, Kürbis-Gnocchi, Kürbis-Gratin, oder einfach Kartoffelspalten und Kürbisspalten aufs Backblech legen, würzen und mit Öl verfeinern. Sogar Vanille-Eis mit Kürbiskernöl hat Kerstin Stenglein schon mal angeboten.
Bilder: Kürbisse wohin man schaut: Kerstin Stenglein in Oberpöllitz bei Marktschorgast baut Zier-, Schnitz- und Speisekürbisse an.Tanz, Technik und Tradition / Erntedank in Bayreuth: Tag der offenen Tür in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten
Bayreuth.
Normalerweise findet das große Erntedankfest auf dem
Gelände der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in
Bayreuth alle zwei Jahre statt. Nach der
Corona-Zwangspause war es diesmal tatsächlich das
erste Erntedankfest nach sechs Jahren Pause. Der
große Andrang hat dabei eindrucksvoll gezeigt, dass
das Fest vermisst wurde. Viele tausend Besucher
konnten die Veranstalter im Laufe des
Erntedanksonntags verzeichnen. Publikumsmagneten
waren neben der großen Landtechnikausstellung und
jeder Menge Essensstände ein Erntekronen- und ein
Volkstanzwettbewerb der Landjugend.
Brauchtum, Genuss und Information standen im Mittelpunkt des Festes, das Tradition und Moderne vereinen sollte. In berster Linie gehe es um die Freude über die zurückliegende Ernte, sagte Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Der Bezirk Oberfranken ist Träger der Landwirtschaftlichen Lehranstalten. Der Präsident sprach von extremen Wetterverhältnissen während der zurückliegenden Monate, die eine höchst unterschiedliche Ernte hervorgebracht hätten. Er nannte das Kreiserntedankfest eine hervorragende Gelegenheit, die Region und ihre landwirtschaftlichen sowie kulinarischen Besonderheiten zu würdigen.
„Landjugend
muss man erleben“, so Sebastian Feulner,
Vorsitzender des Landjugend-Kreisverbandes Bayreuth.
Er freute sich ganz besonders darüber, dass der
Volkstanzwettbewerb beim Publikum auf derart große
Resonanz gestoßen war. Zeitweise gab es kein
Durchkommen mehr in der großen Bodenhalle der
Lehranstalten. Mit diesem Fest werde eine wichtige
Tradition gepflegt und fortgeführt, sagte Sebastian
Thiem, Leiter der Lehranstalten. Außerdem sei es
eine hervorragende Möglichkeit für alle Besucher,
die vielfältigen Aufgaben der Bildungseinrichtung am
Rande der Stadt näher kennen zu lernen.
„Hut ab vor dem, was die jungen Leute zum Erntedank in Bayreuth auf die Beine gestellt haben“, sagte der Landtagsabgeordnete Franc Dierl. Er gratulierte besonders der Landjugend Schreez, die von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker in diesen Tagen mit dem Preis für Heimatpflege ausgezeichnet wurde. Der Ursprung aller Lebensgrundlagen liege bei den Bauern, so Landrat Florian Wiedemann. Sie seien das wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Rückrat des Landes.
Den
ganzen Tag über war unter anderem ein Blick hinter
die „offene Stalltür“ möglich. Dazu gab es
Informationsstände unter anderem des
Bauernverbandes, des Maschinenrings, der
Waldbauernvereinigung, von Bayernland, der
verschiedener Selbsthilfeeinrichtungen und von
zahlreichen Firmen. Regionale Produkte aus der
Genussregion Oberfranken rundeten das Angebot ab.
Auch Technikinteressierte kamen auf ihre Kosten:
allein 60 Schlepper waren zu sehen. Moderne Land-
und Gartenbautechnik wurde ebenso präsentiert wie
Informationen rund um erneuerbare Energien. Dazu
stellten verschiedene Dienstleister rund um Haus und
Hof ihre Arbeit vor.
Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den Aus- und Fortbildungseinrichtungen der Landwirtschaft, die sich den Besuchern vorstellten und Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung präsentierten. Ebenso informierte ein Stand über Historisches aus dem Grünen Zentrum, anlässlich 100 gemeinsamer Jahre der „Gärtner Johann Popp´sche Stiftung“ und der Landwirtschaftsschule Bayreuth. Ergänzend dazu ga es eine Ausstellung bäuerlicher Arbeitsgeräte, die einen spannenden Einblick in vergangene Zeiten gewährte.
Beim
Volkstanz-Wettbewerb landeten die Landjugend Bad
Berneck-Bindlach vor Stockau-Lehen auf dem ersten
Platz. Die weiteren Teilnehmer waren die
Landjugenden aus Görschnitz, Schreez
Unterkonnersreuth-Cottenbach. Die ausgestellten und
prämierten Erntekronen kamen von den
Landjugendgruppen Stockau-Lehen, Gefrees und Schreez.
Bilder:
1. Landwirtschaft
am Rande der Stadt, das ließen sich die zahlreichen
Besucher nicht entgehen.
2. Blickfang
in der Bodenhalle: Die von den Landjugendgruppen
kunstvoll gebundenen Erntekronen.
3. Zum
Tag der offenen Stalltür haben die
Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks
Oberfranken eingeladen.
4. Was
man mit Schafwolle so alles machen kann, zeigte
Silvana Pezzi aus Neudrossenfeld den zahlreichen
Besuchern.
Einer der Höhepunkte des Erntedankfestes war der Volkstanzwettbewerb der Landjugendgruppen aus dem Bayreuther Raum (links). Landtechnik zum Anfassen und Bestaunen, dafür bot das weitläufige Gelände der Lehranstalten reichlich Platz (rechts).
Pflanzen, Pflügen und Persönlichkeit entwickeln / Freisprechungsfeier für den Beruf Landwirt – Abschlusszeugnisse für sechs Damen und 17 Herren aus vier Landkreisen
Bayreuth.
23 junge Landwirte aus
Ostoberfranken haben ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen. Bei der Freisprechungsfeier in
Bayreuth hat die Regierung den sechs Damen und 17
Herren die Abschlusszeugnisse überreicht. „Heute
können sie die Ernte einfahren und den Ertrag
entgegennehmen“, sagte Burkhard Traub von der
Regierung von Oberfranken.
Jeweils zwei Absolventen des Beruflichen Schulzentrums Hof und des Staatlichen Schulzentrums in Bayreuth haben mit Bestnoten, also 1,0, beziehungsweise 1,1 abgeschlossen: Eva John aus Bad Berneck (Landkreis Bayreuth) und Lucas Hirschmann aus Thurnau (Landkreis Kulmbach) sowie Marie-Theres Puff aus Selbitz (Landkreis Hof) und Lena Strößenreuther aus Tröstau (Landkreis Wunsiedel). Die Arbeit des Landwirts wird wieder wertgeschätzt, sagte der Bayreuther Schulleiter Bernhard Grünewald. Das zeige nicht zuletzt die steigende Zahl an Auszubildenden.
Die
Nahrungsproduktion werde trotz aller aktueller
Entwicklungen auch künftig die primäre Aufgabe von
Landwirten sein, sagte Burkhard Traub. Gerade die
aktuellen Krisen hätten die große Bedeutung der
Nahrungsmittelsicherheit wieder in den Focus einer
breiten Öffentlichkeit gerückt. Die Bauern hätten
aber auch auf viele andere Fragen die richtigen
Abtworten. Umweltverträgliche und nachhaltige
Produktion gehörten dazu, die Einhaltung von
Tierwohlstandards, der Erhalt und die Pflege der
Kulturlandschaft sowie ein unschätzbarer Beitrag zum
Dorfleben und zur Dorfkultur. Das alles zeige:
Landwirtschaft ist viel mehr als Säen, Melken,
Pflanzen und Pflügen.
Auch Manfred Neumeister, weiterer Stellvertreter des Landrats, bezeichnete den Beruf Landwirt als traditionsreich und zukunftsweisend. Landwirte spielten eine Schlüsselrolle beim Umwelt- und Naturschutz, Landwirte seien das Rückgrat der ländlichen Regionen und sie stünden wie kaum eine andere Berufsgruppe für regionale Wirtschaftskreisläufe. Weitere Gratulanten waren unter anderem der stellvertretende Prüfungsausschussvorsitzende und Leiter der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth Sebastian Thiem, der Bayreuther BBV-Kreisobmann Karl Lappe, der Kreisvorsitzende des Verbandes für ländliche Fachbildung (VlF) Rainer Zimmermann und Uwe Lucas vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg.
Sämtliche
Absolventen haben eine dreijährige duale Ausbildung
absolviert. Nach einem Berufsschuljahr in Vollzeit
arbeiteten sie zwei Jahre in landwirtschaftlichen
Ausbildungsbetrieben und besuchten parallel einmal
pro Woche die Berufsschule. Zusätzlich erhielten sie
praxisnahe Schulungen an Landmaschinen- und
Tierhaltungsschulen.
Die Absolventen aus Ostoberfranken sind:
Landkreis Bayreuth: Simon Böhner (Bindlach), Luca Eckert (Waischenfeld), Lukas Hauenstein (Schnabelwaid), Eva John (Bad Berneck), Felix Meyer (Hummeltal), Christian Wolfrum (Bad Berneck) und Lorenz Härtig (Bayreuth-Stadt).
Landkreis Hof: Susanne Benker (Rehau), Hannes Hoffmann (Schwarzenbach an der Saale), Jonas Pöhlmann (Konradsreuth), Marie-Theres Puff (Selbitz), Philipp Saalfranz (Schauenstein), Maria Schmidt (Töpen), Maximilian Weiß (Schwarzenbach an der Saale) und Jan Rödel aus Hof-Stadt).
Landkreis Kulmbach: Jan Fischer (Kulmbach), René Hampel (Neuenmarkt), Lucas Hirschmann (Thurnau), Julia Mlawez (sie kommt zwar aus Bad Staffelstein, aber hat ihre Ausbildung in Melkendorf absolviert) und Andreas Pöhlmann (Neudrossenfeld).
Landkreis Wunsiedel: Bastian Benker (Weißenstadt) und Lena Strößenreuther (Tröstau).
Dazu kommt noch Maik Schoer aus Bienenbüttel im niedersächsischen Landkreis Uelzen, der seine Ausbildung in Oberfranken absolviert hat.
Bilder:
1. Diese 23 jungen
Landwirte aus den vier ostoberfränkischen
Landkreisen Bayreuth, Hof, Kulmbach und Wunsiedel
haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und
ihre Abschlusszeugnisse erhalten.
2. Schulleiterin
Andrea Brönner (Mitte) vom Beruflichen Schulzentrum
Hof zeichnete Marie-Theres Puff (links) aus Selbitz
und Lena Strößenreuther aus Tröstau für ihre
Bestleistungen aus.
3. Bernhard
Grünewald (Mitte), der Leiter des Staatlichen
Berufsschulzentrums III in Bayreuth überbrachte
seine Glückwünsche an die beiden Besten Eva John aus
Bad Berneck und Lucas Hirschmann aus Thurnau.
Kirchliches Tagungszentrum stellt Landwirtschaft in den Focus / EBZ Bad Alexandersbad startet Veranstaltungsreihe „Land – Wirtschaft – Gesellschaft“
Bad
Alexandersbad. Den Dialog zwischen Landwirtschaft
und Gesellschaft hat eine Veranstaltungsreihe zum
Ziel, mit der das Evangelische Bildungs- und
Tagungszentrum Bad Alexandersbad (EBZ) im
Winterhalbjahr an die Öffentlichkeit geht. „Unter
der Überschrift Land – Wirtschaft – Gesellschaft
wollen wir die zukunftsweisende Rolle der
Landwirtschaft für die Entwicklung der Region
aufzeigen“, sagt EBZ-Leiter Andreas Beneker. Die
Reihe startet am 10. Oktober, weitere Abende folgen
im November, Januar und Februar. Die
Verantwortlichen denken bereits jetzt über eine
eventuelle Fortsetzung nach.
Die Anfänge des Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrums gehen zurück auf die Landwirtschaft, so Andreas Beneker. Zu Beginn sei das EBZ sogar komplett auf die Landwirtschaft ausgerichtet gewesen. Erst in den 1980er Jahren habe sich das ein wenig geändert und die geistlichen und politischen Themen seien mehr in den Vordergrund gerückt. Was aber immer geblieben ist, war die Einbeziehung der Landwirtschaft und des ländlichen Raumes. „Die Verbindung zur Landwirtschaft als gesellschaftlich und politisch entscheidende Bevölkerungsgruppe ist imme geblieben“, so der Leiter.
Daran anknüpfend sollen nun in Form von Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen landwirtschaftliche Themen wieder einmal in den Vordergrund gerückt werden. Auch die Bauernproteste hätten dazu beigetragen, dass sich wieder mehr Menschen mit landwirtschaftlichen Themen befassen. Dazu will das EBZ „mit einem weiteren Mosaikstein“ beitragen, wie es Andreas Beneker formulierte. Jeder, der Lust hat, sich zu beteiligen und vielleicht auch einzubringen sei herzlich eingeladen.
Unterstützt wird die Veranstaltungsreihe vom Verband für landwirtschaftliche Fachbildung und vom Bauernverband. „Bildung und Weiterbildung sind ja auch unsere urspünglichen Ziele“, begründete der Wunsiedler VLF-Kreisvorsitzende Jörg Fröber aus Röslau das Engagement seines Verbandes. Für den Bauernverband ist das Miteinander von Bevölkerung und gesellschaft wichtig. „Es liegt uns am Herzen, dass die Menschen auch die Probleme der Landwirte mitbekommen“, so der stellvertretende Kreisobmann Stephan Regnet.
Die Reihe startet am Donnerstag, 10. Oktober um 19.30 Uhr mit einem Abend zum Thema „Seelische Belastungen in der Landwirtschaft“. Damit soll der Dialog gestartet und vielleicht das eine oder andere Tabu aufgebrochen werden. Referenten sind der Landwirt Christoph Rothaupt aus der Rhön, der selbst betroffen war, und Walter Engeler von der Landwitschaftlichen Familienberatung der Evangelischen Landeskirche auf dem Hesselberg.
Am 19. November geht es dann unter dem Titel „Ackergold?“ um Flächenverbrauch und Bodennutzung. Nicht nur Landwirte, der gesamte ländliche Raum sei schließlich unter anderem von Ortsumgehungen, Neubaugebieten, Photovoltaikflächen oder Windrädern betroffen. Referentin ist die aus New York (!) stammende Professorin für Regionalmanagement und sozialwissenschaftliche Methode an der Landwirtschaftlichen Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.
Das Thema Soziale Landwirtschaft steht am 23. Januar 2025 auf dem Plan. Referenten sind Theresia Nüßlein von der Landesanstalt für Landwirtschaft in Ruhstorf an der Rott und Carsten Gleissner von der Diakonie Wunsiedel. Den vorläufigen Abschluss bildet ein Abend zum Thema „Genossenschaften als Weg regionaler Entwicklung“ unter anderem mit Michael Diestel vom BBV in der Rhön.
Weitere Information: www.ebz-alexandersbad.de.
Bild: Sie stecken hinter der neuen Veranstaltungsreihe „Land – Wirtschaft – Gesellschaft“ an Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad (von links): der stellvertretende Wunsiedler BBV-Kreisobmann Stephan Regnet, die stellvertretende Kreisbäuerin Nicole Orschulok, Karl Fischer und Jörg Fröber vom VLF Kreisverband, die Thiersheimer Ortsbäuerin Kathrin Reichel und EBZ-Leiter Andreas Beneker.
Ertrag in Ordnung, Qualitäten stellenweise schwierig / Bauern blicken optimistisch auf die Ernte im Kulmbacher Land – Schlechte Ernte bei Obst
Kulmbach.
Oberfrankenweit geht der Bauernverband heuer von
einer durchschnittlichen Ernte aus. Während es in
der Vergangenheit stets zu heiß und zu trocken
gewesen sei, habe es heuer genügend Wasser gegeben.
Dabei sei der gesamte Regierungsbezirk aber noch
ganz gut davongekommen, denn von Überschwemmungen
blieb Oberfranken und damit auch das Kulmbacher Land
weitgehend verschont.
Von einer durchschnittlich bis guten Ernte spricht der Kulmbacher BBV-Kreisobmann Harald Peetz aus Himmelkron. „Wir sind mit der Ernte rundum zufrieden“, sagt er. Hauptgrund dafür: es habe genug Regen gegeben, die Erträge seien im Gegensatz zum bayerischen Durchschnitt teilweise sogar besser, zumindest besser als in den zurückliegenden Jahren. Harald Peetz wusste auch nichts von irgendwelchen Ausreißern: „Es ist heuer wirklich einmal ein Jahr, in dem alles gepasst hat, in dem alle Früchte genug Wasser hatten.“ Auch bei der mittlerweile praktisch abgeschlossenen Ernte habe das Wetter mitgespielt und es habe keinerlei Schwierigkeiten gegeben. Von größeren Unwettern oder gar von Hagelschäden seien die Kulmbacher Landwirte verschont geblieben. Nicht nur die Erntebedingungen seien gut gewesen, auch die Qualitäten seien in Ordnung, selbst die Braugerste habe heuer genügend Wasser gehabt. „Die Qualitäten beim Weizen und bei der Braugerste passen heuer.“ Nicht einmal zwischen dem Oberland und dem Jura gebe es, wie oft in den Jahren zuvor, gravierende Unterschiede.
„Im Großen und Ganzen hat es gepasst“, sagt auch Harald Köppel, Geschäftsführer des Bauernverbandes Bayreuth-Kulmbach-Kronach. Probleme gebe es allenfalls mit dem Eiweißgehalt bei Braugerste aufgrund des ständigen Wechsels zwischen Sonne und Regen. Von Ertrag her haut es hin, die Qualitäten haben ein wenig gelitten“, fasst Harald Köppel das Erntejahr zusammen. Auf jeden Fall sei genug Wasser da gewesen, deshalb habe mancherorts auch das Unkraut überhandgenommen.
Natürlich gebe es immer wieder regionale Unterschiede. Einzelne Landwirte klagten über kleine Körner, andere über zu wenig Körner, das könne aber auch andere Ursachen haben. Einige Landhändler hätten das Getreide aufgrund des niedrigen Eiweißgehalts unter Vorbehalt angenommen, weil Mühlen und Mälzereien vereinzelt über zu wenig Eiweiß geklagt hätten. Ein geringer Eiweißgehalt mindert in der Regel die Backqualität. Ganz anders sei die Sache beim Obstbau: „Da schaut es heuer eher mau aus“, sagt Harald Köppel.
Von guten Erträgen gehen die meisten Bauern bei der Braugerste aus. Nach fünf mageren Ernten hoffen sie erstmals wieder auf eine, vielleicht sogar leicht überdurchschnittliche Ernte. Der Wachstumsverlauf habe schöne dichte Bestände ergeben, den Krankheitsdruck habe man auch aufgrund zahlreicher resistenter Sorten und geringen Problemen mit dem Mehltau sehr gut in den Griff bekommen, so Markus Herz von der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) kürzlich bei der oberfränkischen Braugerstenrundfahrt. Er zeigte sich „vorsichtig optimistisch“, dass der Ertrag heuer über dem Fünf-Jahres-Mittel liegen könnte. Der Landkreis mit der größten Sommergersten-Anbaufläche in Oberfranken ist der Statistik zufolge Hof mit 6607 Hektar, gefolgt von Kulmbach mit 3529 Hektar und Wunsiedel mit 3437 Hektar.
Nicht ganz so positiv wie im Kulmbacher Land und auch im gesamten Regierungsbezirk ist die Situation einer Mitteilung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) zufolge, wenn man ganz Bayern betrachtet. Die Ernte 2024 stehe im Zeichen extremer Witterungsbedingungen, die die Landwirtschaft vor große Herausforderungen gestellt haben. Vielerorts sei die Aussaat aufgrund der hohen Niederschlagsmengen nur verspätet oder gar nicht möglich gewesen. Auch der Frühling habe sich von seiner launischen Seite gezeigt: Hochwasser in Süddeutschland, Kälteeinbrüche und anhaltende Trockenperioden hätten deutliche Spuren in den Kulturen hinterlassen. Besonders der Sommer sei von häufigen Regenfällen geprägt gewesen. „Landwirte konnten aufgrund andauernd nasser Böden nicht für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten auf den Acker fahren. Das führte zu hohem Druck von Schaderregern, vor allem durch Unkraut und Pilze“, so heißt es ijn der Mitteilung des Bauernverbandes.
Die Misere beim Obstanbau bestätigte auch Kreisfachberaterin Anna Lena Ostermeier vom Landratsamt Kulmbach: „Dieses Jahr ist eher bescheiden ausgefallen“, so die Kreisfachberaterin. Als Ursache dafür nennt sie den späten Frosteinbruch Ende April, der gerade in die Zeit der Obstblüte gefallen sei. Auffällig sei es aber auch, dass es regional, selbst innerhalb des Landkreises, große Unterschiede gibt. In manchen Lagen sei der späte Frosteinbruch deutlich heftiger ausgefallen als in anderen Bereichen.
Kirschen und auch Pfirsiche seien heuer nahezu ein Totalausfall, bei Zwetschgen, Pflaumen und auch bei Äpfeln sei die Situation total unterschiedlich und sowohl vom Standort, als auch von der Sorte abhängig. Insgesamt gebe es vor allem bei Äpfeln weniger Ertrag als in den zurückliegenden Jahren. Allerdings ließe sich dabei im Gegensatz zu den Feldfrüchten der Landwirte noch keine endgültige Aussage treffen.
Schlecht sei das nass-warme Wetter auch für Tomaten, weil dadurch Pilze gefördert würden. Gut gelaufen sei dagegen heuer das Beerenobst, das vom Kälteeinbruch nicht betroffen war. Ebenso gebe es Haselnüsse in Hülle und Fülle. Hier seien die Pflanzen wassertechnisch gut versorgt worden, Regen sei genug gefallen. Davon hätten auch die Ziergärten profitiert. „Man musste ja fast nicht gießen“, so Anna Lena Ostermeier.
„Sind und bleiben Mitte der Gesellschaft“ / BBV zieht beim Schirradorfer Bauerntag positives Fazit: Bauerndemos haben mehr gebracht als jede Imagekampagne- Hohe Ehrung für Reinhard Kortschack
Schirradorf.
Konstruktiv, innovativ und sympathisch: so sieht der
bayerische Bauernverbandspräsident Günther Felßner
seit den Großdemos Anfang des Jahres das Bild der
Landwirtschaft. „Wir wollen eine moderne
Interessensvertretung sein, eine Denkfabrik für die
gesamte Gesellschaft und nicht nur ein Lobbyverband
für die zwei Prozent Landwirte in der Bevölkerung“,
sagte er beim Schirradorfer Bauerntag.
Mit den Bauernprotesten sei es gelungen, den Leistungsgedanken wieder ein Stück weit auf die Füße zu stellen. „Wer sich etwas leisten will, muss erst selbst einmal etwas leisten“, so Günther Felßner. Die Landwirte seien bei den Menschen angekommen, „weil sie anständig waren und nicht chaotisch“, sagte er mit einem Seitenhieb auf die Klimakleber der Letzten Generation: „Nicht die Letzte Generation wird die Zukunft gestalten, sondern die künftige.“
Keine Imagekampagne hätte für den Bauernstand das erreicht, was die Bauernproteste bewirkt haben. Da gehe es auch um „zammhalten“ und um ein Miteinander, Werte, für die die Landwirte stehen und die man jetzt nicht leichtfertig wieder hergeben dürfe. „Wir sind und wir bleiben die Mitte der Gesellschaft“, sagte Günther Felßner.
Auch die Kulmbacher Bauern hätten ihren Anteil dazu geleistet, als es Anfang des Jahres mit den Protesten losging. „Unser Landkreis war gut vertreten“, sagte Kreisobmann Harald Peetz. Gleich zu Beginn hätten rund 250 Schlepper ganz Kulmbach lahmgelegt und die Menschen seien trotzdem hinter den Bauern gestanden. An der großen Protestrundfahrt durch den gesamten Landkreis hätten sich dann sogar bis zu 600 Traktoren beteiligt. Auch bei den Autobahnblockaden seien die Kulmbacher Bauern dabei gewesen. Kritikern nahm Harald Peetz den Wind aus den Segeln: „Bei uns ist alles nach Recht und Gesetz und stets in Absprache mit dem Landratsamt verlaufen.“
Der Kreisobmann stellte aber auch die Frage: „Was hat es letztlich gebracht?“ Lediglich die Kfz-Steuerbefreiung von landwirtschaftlichen Maschinen sei entgegen ursprünglichen Plänen beibehalten worden. Die Vergünstigungen beim Agrardiesel seien aber lediglich auf drei Jahre gestreckt worden, ehe sie ganz wegfallen sollen. Hier machte BBV-Präsident Felßner den Bauern durchaus Hoffnung, dass eine neue Bundesregierung ab dem Herbst 2025 wieder zurücknehmen könnte und dass der Agrardiesel durchaus auch ein Wahlkampfthema für die nächste Bundestagswahl werden könnte.
Auch Edwin Nicklas, Chef des Landtechnikunternehmens Nicklas, in dessen Halle der Schirradorfer Bauerntag mittlerweile seit rund 20 Jahren stattfindet, vertrat die Auffassung, dass die Landwirte mit den Demonstrationen die Zustimmung der Bevölkerung nachhaltig erreicht hätten. „Ein derartiger Zusammenhalt zwischen den Landwirten und allen vor- und nachgelagerten Berufsständen ist bislang einmalig“, sagte Nicklas. ER sprach allerdings auch von ernüchternden Ergebnissen des zurückliegenden Anbaujahres. Grund dafür sei aktuell ein drastischer Verfall des Getreidepreises. Bei sehr vielen Nebenerwerbslandwirten aus der Region, die ausschließlich Ackerbau betreiben, werde sich die Frage stellen, wie lange sie das in einer Zeit extremer Inflation noch durchhalten.
Eine ganz besondere Ehrung wurde beim Bauerntag dem langjährigen Kreisvorstandsmitglied Reinhard Kortschack aus Fölschnitz zuteil. BBV-Präsident Günther Felßner überreichte ihm die Ehrenurkunde des Bauernverbandes. Reinhard Kortschack gehörte der Kreisvorstandschaft 40 Jahre lang an. Er habe in dieser Zeit vier Kreisobmänner und sieben Amtschefs überdauert, sagte Harald Peetz. Dabei sei er nie in die Kreisvorstandschaft gewählt worden, weil er immer kraft Amtes automatisch dabei war. So war er unter anderem Vorsitzender der bayerischen Jungbauernschaft und Vorsitzender des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung (VlF).
Reinhard Kortschack war Ortsobmann in Fölschnitz, war über 45 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr Fölschnitz aktiv, war Mitglied des Kirchenvorstandes in Untersteinach und gehört noch immer den Ködnitzer Gemeinderat für die Freien Wähler an. Daneben führte er zusammen mit seiner Frau Renate einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb mit Milchviehhaltung. Und einen Hauptberuf hatte Reinhard Kortschack auch: er war als Fußbodenleger tätig.
Bilder:
1. Hohe
Ehrung für Reinhard Kortschack aus Fölschnitz (von
links): der stellvertretende Kreisobmann Martin
Baumgärtner, Renate und Reinhard Kortschack,
BBV-Präsident Günther Felßner, Kreisobmann Harald
Peetz und der stellvertretende Landrat Jörg
Kunstmann.
2. Kreisobmann
Harald Peetz und Friedbert Pflüger vom
mitveranstaltenden John-Deere-Fanclub überreichten
dem BBV-Präsidenten Günther Felßner (von rechts)
einen Präsentkorb mit Produkten aus dem Kulmbacher
Land.
Gute fachliche Praxis statt überzogener Regelungen / Bauernverband diskutierte mit örtlichen Mandatsträgern
Bayreuth.
Vom bewegten Jahresanfang mit den bundesweiten
Bauerndemos wegen der Streichung des Agrardiesels
ist wenig übrig geblieben. „Wir können keinesfalls
zufrieden sein, da ist von der Politik einfach zu
wenig gekommen“, sagte BBV-Kreisobmann Karl Lappe
bei einem Politikergespräch zwischen
Kreisverbandsmitgliedern und den örtlichen
Mandatsträgern. Insbesondere kritisierten Karl
Lappe, Kreisbäuerin Angelika Seyferth und Mitglieder
der Vorstandschaft einmal mehr die Bürokratie, mit
der die Landwirtschaft überzogen werde. Statt wie
versprochen weniger, werde es von Mal zu Mal mehr
Bürokratie.
„Es wird immer mehr, als Betriebsleiterin hat man da ganz schön zu tun“, sagte Johanna Hohlweg aus Bad Berneck. Besonders für die ältere Generation sei es mittlerweile ein echtes Problem, dass es nur noch E-Rechnungen gebe und kaum noch Papierrechnungen. Martin Gebhardt aus Görau bezweifelte, dass die zunehmende Digitalisierung wirklich zur Entbürokratisierung beiträgt. Vielmehr würden die Betriebe immer gläserner und stünden immer mehr unter Kontrolle. „Da wissen viele noch nicht, was auf sie zukommt“, so Martin Gebhardt.
In Sachen Bauerndemos übte Heimat- und Finanzstaatssekretär Martin Schöffel (CSU) heftige Kritik an der Ampel in Berlin. Dort sei man der Auffassung gewesen, man dürfe sich von den Demonstrationen nicht beeindrucken lassen. Das Ergebnis sehe man aktuell bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen. Als wenig praktikabel bezeichnete Martin Schöffel die sogenannten „GLÖZ“-Maßnahmen (Standards für den Guten Landwirtschaftlichen und Ökologischen Zustand von Flächen). Diese Grundbedingungen muss künftig jeder Betrieb einhalten, der Direktzahlungen oder flächen- und tierbezogene Fördermaßnahmen des ländlichen Raumes beantragt. Die Maßnahmen seien nicht praktikabel und müssten dringend verändert werden. Stattdessen sollte die gute fachliche Praxis wieder mehr Gewicht bekommen. Das würde dann auch zur Entbürokratisierung führen. Überhaupt könne es mit den Vorgaben aus Brüssel und Berlin so nicht weitergehen. Als Beispiel nannte der Staatssekretär die Kombihaltung, für die man flexible Regelungen statt eines strikten Verbots der Anbindehaltung benötige.
Die pauschale Kritik an der Bundesregierung empfand der Landtagsabgeordnete Tim Pargent von den Grünen als unfair. Die Politik habe sehr wohl auf die Bauerndemos reagiert. Das ließ Martin Schöffel allerdings nicht gelten. Die Agrardieselregelung werde trotzdem auslaufen, sie sei lediglich von einem auf drei Jahre hinausgeschoben worden. Was die Digitalisierung angeht, so erhofften sich sowohl Tim Pargent als auch Thomas Hacker (FDP), dass davon sehr wohl eine Entbürokatisierung ausgehe. Dort, wo die E-Rechnung bereits vor zehn Jahren eingeführt worden sei, würden die Unternehmen heute davon schwärmen. Thomas Hacker gab zu bedenken, dass jede Umstellung zunächst einmal als Belastung empfunden werde. Trotzdem sei die Umstellung der einzige mögliche Weg.
Ein weiteres Thema des Politikergesprächs war die Zunahme von Beutegreifern wie Wolf und Fischotter. Die Landwirte begrüßten einhellig, dass es aktuell möglich gewesen sei, einen „Problemwolf“ in Unterfranken zu „entnehmen“. Zwar spiele der Wolf im Landkreis Bayreuth derzeit nicht die große Rolle, Um so heftiger sei die Situation aber beim Fischotter. „Hier brauchen wir eine dauerhafte gerichtsfeste Lösungt“, forderte BBV-Geschäftsführer Harald Köppel. Viel zu viele Teichwirte hätten bereits aufgegeben und wer einmal aufgegeben habe, der fange nicht wieder an.
Gerne werde übersehen, dass der Fischotter reihenweise seltene Fische und Amphibien ausrotte, sagte Staatssekretär Martin Schöffel. Ziel sollte es deshalb sein, möglichst einfache Regelungen zur „Entnahme“ zu finden. So sollten darüber künftig die Landratsämter entscheiden, wo und wie viele entnommen werden dürfen. „Man kann ja schließlich nicht jeden Teich einzäunen“, sagte Martin Schöffel. Es müsse wieder möglich werden, den Fischottger zu fangen und zu schießen, anders gehe es nicht. Landtagsabgeordneter Franc Dierl kritisierte in diesem Zusammenhang das Verbandsklagerecht. So sei es beispielsweise einem Verband aus Niedersachsen möglich gewesen, gegen eine bayerische Regelung zu klagen. „Menschen, die mit der Sache nichts zu tun und auch keine Ahnung davon haben, können gegen alles klagen“, so der Abgeordnete. Ein solches Verbandsklagerecht gebe es beispielsweise in Österreich nicht.
Korn ist out, Gin ist in / Tradition und Leidenschaft: Matthias Erlwein aus der Fränkischen Schweiz ist mit dem Staatsehrenpreis für Edelbrenner ausgezeichnet worden
Weigelshofen.
Powerpoint und Strategie, Handarbeit und Genuss: die
beiden beruflichen Welten von Matthias Erlwein aus
Weigelshofen bei Eggolsheim könnten
unterschiedlicher nicht sein. Tagsüber ist er bei
Siemens in Erlangen im Service tätig, an den
Wochenenden macht er aus heimischem Obst edle
Brände. So edel, dass er vor wenigen Wochen mit
einem Staatsehrenpreis ausgezeichnet wurde.
„Eigentlich wollte ich das nie machen“, gibt er unumwunden zu. Und das, obwohl schon drei Generationen vor ihm in Weigelshofen Brenner waren. Zu mühsam war ihm das Ganze und er denkt noch immer mit Schrecken daran, als er im Kindesalter stundenlang Stiele aus den Birnen zupfen musste. Doch als 2016 ganz plötzlich sein Vater verstarb, blieb die Brennerei erst einmal an ihm hängen. Matthias Erlwein hat sich tief in die Materie eingearbeitet, sogar einen Brennerkurs an der schwäbischen Universität Hohenheim belegt. Investiert hat er aber nicht nur in Know-how, sondern auch in Technik, Gerätschaften und ins Marketing. „Ich habe meine Leidenschaft gefunden“, sagt er heute.
Über
die Technik des Brennens könnte er stundenlang
erzählen. Über die Maischebereitung und die
Vergärung von Obst, über Destillationsgrundlagen und
-techniken, die Verarbeitung bestimmter Rohstoffe
und über das Zollrecht, denn beim Brennen gibt es
nichts, was dem Zufall überlassen wäre. Alles ist
bis in das kleinste Detail geregelt. Jeder
Brennvorgang müsse Tage vorher beim Zoll in
Stuttgart angemeldet werden, der Zoll habe stets
Zugang zu den Brennräumen. Wer Alkohol erzeugt, der
unterliegt außerdem bestimmten steuerrechtlichen
Vorgaben und nicht zuletzt habe auch die
Lebensmittelkontrolle ein Wörtchen mitzureden.
Da der Betrieb im Nebenerwerb ausgeübt wird, verbleiben nur die Samstage zum Brennen. Der Brenntag beginnt meistens um sechs Uhr morgens und endet um 20 Uhr. Größere Pausen sind da gar nicht drin. „Es ist schon schwer verdientes Geld“, sagt er, und doch merkt man ihm die Liebe zu dem, was er macht, an. Auf Nachfrage gibt es auch die Möglichkeit einer Brennereiführung, getreu dem Motto von der Blüte in die Flasche.
Äpfel
und Birnen kommen von der eigenen Plantage.
Williams-Birnen sind dabei, Wahl´sche Schnapsbirnen
und Conference-Birnen, bei den Äpfeln setzt er ganz
klassisch auf Elstar, Gravensteiner und Boskop. Die
Plantage ist gut ein halbes Hektar groß, auf ihr
stehen rund 100 Bäume. Zur Erntezeit hilft die ganze
Familie mit, drei Tage dauert das mindestens, von
Sonnenauf- bis zum Sonnenuntergang, sogar gegessen
wird im Freien. Die eigene Fläche ist Vorschrift,
ohne sie würde Matthias Erlwein das Brennrecht
verlieren.
Alle anderen Früchte, Himbeeren, Haselnüsse, Kirschen, Mirabellen, Quitten, Schlehen, Vogelbeeren oder Zwetschgen kauft er zu. Wenn irgendwie möglich kommen sämtliche Früchte aus der Region. „Wir verarbeiten alles, was hier wächst“, sagt er. Etwa ein Dutzend verschiedener Sorten hat er im Angebot. Nur wenn die Ernte mal total ausfällt, auch das ist schon passiert, dann muss er Obst aus dem Bodensee-Gebiet oder sogar auch mal aus Südtirol zukaufen. Heuer rechnet er aufgrund der Spätfröste mit Einbußen von bis zu 30 Prozent. Die Schorfbildung auf den Früchten sei relativ hoch. Manchmal war auch schon das ausbleibende Wasser ein Problem. Dann musste er das Wasser zu den Bäumen bringen, was ziemlich aufwändig und auch kostspielig ist, doch ohne Wasser keine Ernte.
Die
Vermarktung erfolgt zu zwei Dritteln direkt.
Matthias Erlwein hat gleich neben der Brennerei eine
kleine Direktvermarktung aufgebaut, in der die 0,1
bis 0,5-Liter-Flaschen ansprechend präsentiert
werden. Ein-Liter-Flaschen gibt es auch, aber nur
auf Bestellung. Hier sind auch die vielen
Auszeichnungen der Brennereien-Verbände zu sehen,
immer wieder ist die fränkische Edelbrennerei schon
prämiert worden.
Mundpropaganda ist das Wichtigste, aber auch das Internet. Bewusst hat er sich aber gegen einen eigenen Webshop entschieden, zu kompliziert sind die Regularien und mit der Amazon-Mentalität „heute bestellt, morgen geliefert“, kann und will er nicht mithalten. In der Edeka Pfister im Nachbarort gibt es eine regionale Theke und auch der gleichnamige Brauerei-Gasthof vor Ort vertreibt seine Produkte.
Die Brennerei ist im Untergeschoss seines Elternhauses direkt an der Hauptstraße in Weigelshofen untergebracht. Im Stockwerk darüber wohnt seine Mutter und ganz oben gibt es eine hübsche Ferienwohnung, schließlich ist Region touristisch durchaus gefragt. Er selbst wohnt mit seiner Familie ein paar Straßen weiter, ist aber auch wenn er nicht gerade brennt, oft hier anzutreffen.
Wie
die gesamte Landwirtschaft, so klagt auch Mathias
Erlwein über die überbordende Bürokratie, aber auch
über die vielen unsinnigen Vorschriften. „Es gibt so
viele Auflagen, die das Wirtschaften erschweren“,
sagt er und hofft, dass die von der EU geforderte
Nährwertangabe auf Spirituosen bald wieder vom Tisch
ist. Er beklagt auch, dass seine Fläche, nicht
KULAP-gefördert wird. „Mit unter einem Hektar
erreiche ich die Basisprämie nicht.“ Zu schaffen
machen ihm nicht zuletzt die hohen Energiepreise.
Vor ein paar Jahren wurde alles mit Holz geheizt.
Jetzt hat er auf Strom umgestellt. Der ist natürlich
auch in der Fränkischen Schweiz teuer geworden. Doch
mit Strom sei es halt auch viel einfacher, die
Temperatur konstant zu halten und das wiederum ist
für die Qualität so wichtig.
Wichtig ist auch die Qualität der Frucht. „Wir reißen alles mit der Hand“, sagt er. „Je sauberer das Obst, desto höher die Qualität.“ Fünf Tonnen Williams-Birnen wollen allerdings erst einmal gepflückt sein. Damit auch wirklich keine störenden Stoffe in die Maische kommen, hat er eigens eine professionelle Passiermaschine angeschafft.
Weniger
Probleme macht ihm der häufig geänderte Blick der
Gesellschaft auf das Thema Alkohol. „Wir produzieren
für Genießer“, sagt er. Lediglich beim Marketing
wird es halt schwieriger. Richtige Werbung sei
praktisch nicht mehr möglich. Da sei immer wieder
Aufklärung nötig. Auch deshalb halte er nichts von
einem Internetvertrieb. Wie sollte er sicherstellen,
dass der Amazon-Bote die Ware so zustellt, dass kein
Jugendlicher rankommt?
Mehr am Herzen liegt ihm dagegen die Aufwertung der fränkischen Region. Matthias Erlwein ist Mitglied der Genussregion Oberfranken und setzt sich sehr für Werbemaßnahmen ein, die der Fränkischen Schweiz zugutekommen. Beim „Walberlafest“ war er auch vertreten, das „Walberla“ ist der Kultberg der Fränkischen Schweiz, und im „Landbierparadies“ in Nürnberg gibt es die Brände aus Weigelshofen ebenfalls.
Natürlich bemerkt auch Matthias Erlwein Veränderungen bei den Kundenwünschen. Der klassische Korn hat ausgedient. „Jetzt trinkt man Whisky“, erklärt er. In ist auch das Modegetränk Gin. Den habe mittlerweile jeder fränkische Brenner im Programm. Ein absoluter Kassenschlager ist bei ihm der fränkische Williams mit Honig, eine Eigenkreation, wobei der Honig ebenfalls lokal „von der Wiese nebenan“ kommt. Der fränkische Williams ist auch sein ganz persönlicher Favorit. Was immer geht sind die typisch fränkischen Sorten Schlehe, Mirabelle, Zwetschge und Kirsch.
Mit seinen beiden Kindern steht die fünfte Brennergeneration aus Weigelshofen schon in den Startlöchern. Das wäre dann die fünfte Generation. Gegründet hatte die Brennerei sein Urgroßvater August Erlwein im Jahr 1926. Erst 1973 hat dessen Tochter Anna Erlwein zusammen mit Ihrem Sohn Georg Erlwein ein neues Brenngerät eingerichtet und das kleine Unternehmen als Familienbetrieb weitergeführt, bis 2017 Matthias übernahm. An die fünfte Generation denkt er aber noch nicht. „Das hat noch viel Zeit“, sagt er. Interesse am Brennen hätten die beiden jedenfalls schon mal signalisiert.
Bilder:
1. Das ist die jüngste Urkunde, die Matthias Erlwein
vor wenigen Wochen vom Landwirtschaftsministerium
bekommen hat: der Staatsehrenpreis für Edelbrenner.
2. Technik, wohin man schaut: Matthias Erlwein in
seiner Brennerei.
3. Matthias Erlwein setzt vor allem auf
Direktvermarktung: in einem kleinen Hofladen hält er
das komplette Sortiment vor.
4. Zahlreiche Auszeichnungen hat Mathias Erlwein für
seine Edelbrände schon bekommen.
5. An der Hauptstraße in Weigelshofen weist diese
Tafel auf die Edelbrennerei Erlwein hin.
6. Oberfranken voranbringen möchte der Verein
Genussregion, bei dem Matthias Erlwein Mitglied ist.
„Rat zur Saat“ in Himmelkron und Scheßlitz / Erzeugerring informiert über aktuelle Themen
Himmelkron/Scheßlitz. Empfehlungen für den Wintergetreideanbau, Pflanzenschutz in Winterraps und Wintergetreide sowie Tipps zur Gräserbekämpfung bei widerstandsfähigen und resistenten Ungräsern: diese Themenschwerpunkte möchte der Erzeugerring für landwirtschaftlich pflanzliche Qualitätsprodukte Bayreuth in diesem Jahr bei seinen Herbstveranstaltungen in Himmelkron (Landkreis Kulmbach) und Neudorf bei Scheßlitz (Landkreis Bamberg) aufgreifen.
Unter dem Motto „Rat zur Saat“ werden die Pflanzenbauberater des Erzeugerrings, Klaus Stadter, Wolfgang Söllner, Dominik Schmitt sowie der Geschäftsführer und Beratungsteamleiter des Erzeugerrings Frank Kerkhof zu den ausgewählten Themen Stellung nehmen. Die Veranstaltungsreihe „Rat zur Saat gibt es bereits seit dem Jahr 2010.
Zielgruppe seien alle interessierten Landwirte, so Frank Kerkhoff, auch wenn sie nicht Mitglied des Erzeugerrings sind. Neben den Informationen zur Sortenwahl sollen auch die Ergebnisse aus den Landessortenversuchen in Wolfsdorf und Almesbach in der Oberpfalz vorgestellt werden. Vor allem gehe es aber auch um die Mittelauswahl beim Pflanzenschutz und um aktuelle Strategien zur Gräserbekämpfung bei resistentem Weidegras und beim Ackerfuchsschwanz.
Auch die Politik wird bei den Veranstaltungen nicht außen vor bleiben. Unter andern werden die Referenten erläutern, was es mit den GLÖZ-Maßnahmen (Standards für den Guten Landwirtschaftlichen und Ökologischen Zustand von Flächen auf sich hat. Diese Grundbedingungen muss künftig jeder Betrieb einhalten, der Direktzahlungen oder flächen- und tierbezogene Fördermaßnahmen des ländlichen Raumes beantragt.
Die pflanzlichen Erzeugerringe Oberfranken sind eine Selbsthilfeeinrichtung landwirtschaftlicher Betriebe. Ihr Ziel ist die Förderung der marktgerechten Produktion und die Verbesserung der Qualität der jeweiligen pflanzlichen Erzeugnisse seiner Mitgliedsbetriebe.
„Rat zur Saat“ in Himmelkron findet am 29. August 2024 um 19.30 im Gasthof Opel, Lindig 2 statt. Termin in Neudorf bei Scheßlitz ist der 3. September um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Neudorf 15. Die Veranstaltungen werden jeweils zwei Stunden dauern. Weitere Information: www.er-ofr.de.
Methusalem-Bäume, ökologische Trittsteine und Naturwälder / Forstbetrieb Forchheim stellt sein regionales Naturschutzkonzept vor
Leesten.
Ökologie, Ökonomie und gesellschaftliche
Anforderungen: es gibt kaum einen Platz, an dem die
drei Ansprüche enger zusammenliegen, als den Wald.
Die Bayerischen Staatsforsten haben 2023 ein
eigenes Naturschutzkonzept verabschiedet, das vor
Ort auf Ebene der Forstbetriebe ergänzt wird. Damit
wird zum einen das Inventar an ökologischen
Besonderheiten in den Staatswäldern aufgezeigt, zum
anderen beschrieben, mit welchen Maßnahmen der
Forstbetrieb sensible Lebensräume und seltene Arten
schützt. Wie dieses regionale Konzept konkret vor
Ort aussieht, erläuterten die Verantwortlichen für
den Forstbetrieb Forchheim im Eichwald bei Leesten
in der gemeinde Strullendorf, östlich von Bamberg.
Kälberberger Rangen heißt der locke bewaldete Landstrich, auf dem eine Bewirtschaftung aufgrund des steilen Anstiegs über eine weite Strecke nicht mehr wirtschaftlich wäre. Er sei deshalb vollständig aus der Nutzung genommen worden, erläutert der Leiter Stephan Keilholz vom zuständigen Forstbetrieb Forchheim der Bayerischen Staatsforsten. Davon profitiere die Artenvielfalt, Fledermäuse finden Unterschlupf, Spechte sind zu sehen und zu hören, viele Käfer krabbeln am Boden.
In anderen Bereichen des Eichwaldes gibt es Trittsteine. Sie verfolgten das Ziel, Biotope zu vernetzen oder einzelne Arten durch besondere Maßnahmen zu schützen. Die Baumarten würden hier gemischt, um das Risiko zu streuen, so Axel Reichert, der für ganz Nordbayern zuständige Naturschutzbeauftragter der Bayerischen Staatsforsten. Mindestens vier Baumarten sollten es schon sein, falle einer aus, könne man immer noch mit den anderen drei weiterarbeiten. Die reguläre Forstwirtschaft müsse auf den Trittsteinflächn zurückstehen. Davon profitiert zum Beispiel die seltene fränkische Mehlbeere, der Baum des Jahres 2024. „Wir helfen der Mehlbeere, indem wir die konkurrierenden Buchen wegschneiden“, erläutert der Leiter des dortigen Forstreviers Oberngrub Sebastian Feulner die Notwendigkeit der einen oder anderen Maßnahme. Der Trittstein im Eichwald ist knapp vier Hektar groß.
Nicht
weit davon haben die Staatsforsten einen neuen
Esskastanienbestand angelegt. Ziel sei es, Saatgut
zu gewinnen, so Forstbetriebsleiter Stephan
Keilholz. Die eingezäunte Fläche ist rund einen
Hektar groß. Bis die Kastanien die ersten Früchte
tragen, werde es aber schon noch 20 Jahre dauern.
Forstwirtschaft braucht eben einen langen Atem. Noch
viel länger dauert es, bis eine Baum zum Methusalem
wird. So bezeichnen die Forstspezialiste einen sehr
alten Baum mit einem Durchmesser von 80 bis 100
Zentimetern in einer Höhe von 1,30 Meter.
Eine weitere überaus effektive Maßnahme zu Gunsten der Artenvielfalt ist die Anlage eines Feuchtbiotops am Rande einer Lichtung. „Hier wird kein Dünger benutzt und der früheste Schnittzeitpunkt ist der 1. Juli“, sagt Stephan Keilholz. Das Biotop, für das mehrere Wurzelstöcke aufgeschichtet wurden, helfe vor allem Reptilien und Amphibien. Da sonnt sich die Waldeidechse, da schlängelt sich die Ringelnatter, Grasfrösche und Erdkröten könne man hier beobachten, anderswo durchaus auch mal eine Schlingnatter oder eine Kreuzotter. „Naturschutz im Wald, da geht es nicht nur um Bäume“, so der Forstbetriebsleiter.
Der Forstbetrieb Forchheim der Bayerischen Staatsforsten trägt die Verantwortung für die Staatswälder rund um Bamberg, Forchheim und Erlangen. Vorrangiges Ziel bei der Bewirtschaftung des Staatswaldes sind nach den Worten von Stephan Keilholz der Umbau der noch überwiegend aus Fichten und Kiefern bestehenden Bestände in klimaresiliente, stabile Mischwälder und eben auch die Förderung der biologischen Vielfalt.
Bilder:
1.
Stephan Keilholz vom
Forstbetrieb Forchheim der Bayerischen Staatsforsten
zeigt in einem der neu ausgewiesenen Trittsteine ein
Exemplar der fränkischen Mehlbeere, Baum des Jahres
2024.
2. Naturschutzbeauftragter
Axel Reichert (links) und der Leiter des
Forstreviers Sebastian Feulner begutachten das
angesammelte Totholz im Naturwald am Kälberberger
Rangen.
Fischwirtschaft seit über 800 Jahren / „Culmone“-Teiche nahe Neustadt bei Coburg wurden als überregional bedeutsames Kulturgut ausgezeichnet
Neustadt
bei Coburg. Die „Culmone“-Teiche in Thann bei
Neustadt bei Coburg sind mit dem Prädikat „Kulturgut
Teich“ ausgezeichnet worden. Der oberfränkische
Bezirkstagspräsident Henry Schramm überreichte eine
entsprechende Urkunde vor wenigen Tagen an die
Eigentümer und Bewirtschafter Elke und Otto Norbert
Grußka. Damit verbunden war auch die Aufstellung
einer Informationstafel direkt am Ufer der Teiche.
Die „Culmone“-Teiche prägten als Rest des ehemaligen großen Mönchröder Teichs die seit über 800 Jahren bestehende Teichwirtschaft im Tal der Röden. Sie seien ein wesentlicher Bestandteil des Landschaftsbildes und würden in entscheidender Art und Weise zum Erhalt der Artenvielfalt bei tragen. Ihren Namen haben die Teiche von dem im Jahr 1380 verschwundenen Dorf „Culmone“.
Neben einer traditionsreichen Geschichte komme es dabei vor allem auf die landschaftsprägende und ökologische Bedeutung an, erläuterte Vorsitzender Dr. Peter Thoma. Die Auswahl treffe dabei eine Jury, die sich aus Vertretern der Teichgenossenschaft, des Bezirks Oberfranken und dessen Fachberatung für Fischerei besteht. Aufgrund ihrer traditionsreichen Geschichte stellten die „Culmone“-Teiche innerhalb der oberfränkischen Teichlandschaft ein herausragendes Kulturgut dar, begründete Thoma die Entscheidung. „Die Zusammenarbeit aller Bewahrer der Teichwirtschaft habe es auch bei diesem Kulturgut möglich gemacht, den Teich in seiner von Alters her überbrachten Nutzungsform der Nachwelt zu erhalten“, so der Vorsitzende
Fischmeister Otto Norbert Grußka unterhält und bewirtschaftet die „Culmone“-Teiche zusammen mit seiner Frau Elke seit 1996. Mehrfach seien bereits umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt worden. Aufgrund der witterungsabhängig nicht immer ausreichenden Wasserversorgung im Sommer und Temperaturen an der Wasseroberfläche von bis zu 30 Grad Celsius sei eine Haltung von Salmoniden, also Forellen oder Saiblingen, nicht möglich. So beschränke sich die Fischhaltung auf wärmeresistente Arten wie Spiegel-, Schuppen- oder Graskarpfen, Waller, Hecht, Aal, Schleien und Giebel. Die Besatzfische bezieht Otto Norbert Grußka dabei aus dem Zuchtbetrieb von Walter Jacob im Aischgrund.
Die Abgabe von Fische erfolge nur an Privatpersonen. Dabei werden die Fische nur geschlachtet abgegeben. Sie würden unabhängig vom Wochentag, maximal am Vortag des Verzehrs unter Hinweis auf die Einhaltung der Kühlkette abgegeben, um sicherzustellen, dass nur frischer Fisch auf den Tisch kommt. Nach den Worten von Otto Norbert Grußka bleiben die Fische in der Regel zwei Perioden im Teich, das Abfischen finde grundsätzlich am 3. Oktober eines jeden Jahres statt. Dabei werden abwechselnd ein oder zwei von den insgesamt drei Teichen abgefischt. „So wird auch noch heute, nach etwa 800 Jahren, die einst von den Benediktiner-Mönchen in Mönchröden begründete Fischzucht zur Herstellung eines köstlichen Nahrungsmittels fortgeführt“, so Otto Norbert Grußka.
Die Teichgenossenschaft Oberfranken verleiht die Auszeichnung „Kulturgut Teich“ seit 24 Jahren. Damit werden kulturhistorisch bedeutsame Teiche prämiert, die für den jeweiligen Raum eine besonders prägende Bedeutung haben.
Bild: Zahlreiche Ehrengäste waren dabei, als die neue Informationstafel an den „Culmone“-Teichen in Thann nahe Neustadt bei Coburg enthüllt wurde. Links von der Tafel die Eigentümer und Bewirtschafter Elke und Norbert Grußka, rechts davon der Vorsitzende der Teichgenossenschaft Oberfranken Dr. Peter Thoma.
Verkorkste Fußball-EM lässt Bierabsatz schrumpfen / Ernte braucht stabile Witterung - Oberfränkische Braugerstenrundfahrt: Hoffen auf gute Erträge
Kulmbach
/ Leupoldsgrün. „Das können wir nicht auf uns sitzen
lassen“, sagte Staatssekretär Martin Schöffel
augenzwinkernd. Martin Schöffel ist 2. Vorsitzender
des oberfränkischen Braugerstenvereins mit Sitz in
Kulmbach. Er musste gerade feststellen, dass im
„Bierland Oberfranken“ weniger Braugerste angebaut
wird, als in Oberbayern und in Unterfranken.
Die Statistik, die bei der Braugerstenrundfahrt bekannt gegeben wurde, spricht allerdings eine klare Sprache: Über 20000 Hektar Anbaufläche waren es heuer in Oberbayern, rund 18300 Hektar in Unterfranken. Mit 17700 Hektar liegt Oberfranken nur auf Platz drei. Dem Braugerstenverein war die Anbaufläche binnen Jahresfrist um 5433 Hektar von exakt 23160 auf 17727 Hektar zurückgegangen. Die Gründe dafür seien vielfältig, so Markus Herz von der Landesanstalt für Landwirtschaft. Als erstes nannte er die Vielfalt an Alternativen, die in der Landwirtschaft mittlerweile geboten sind. Da sei der Braugerstenanbau eben nicht mehr so attraktiv. „Viele Landwirte haben den Spaß daran verloren“, sagte der Fachmann. Dafür wiederum seien zahlreiche Neuregelungen und Auflagen schuld, etwa die neuen Fruchtfolgeregelungen.
Doch auch der Bierabsatz lässt bereits seit Jahren zu wünschen übrig. Heuer hatten die brauer große Hoffnungen auf die Fußballeuropameisterschaft gesetzt, doch de Kicker ließen die Brauer im Stich. „Der Malz- und Bierausstoß hat sich vielfach nicht so entwickelt, wie erhofft“, sagte Markus Burteisen, Präsident des Deutschen Mälzerbundes. Neben der verkorksten Fußball-EM nannte er auch die galoppierende Inflation sowie Kriege und Krisen auf der Welt, die den Biertrinkern den Spaß verdorben hätten. Die globale Bierproduktion sei rückläufig, deshalb seien auch die Brauereien zurückhaltend.
Trotzdem gab es bei der braugerstenrundfahrt aber auch positive Stimmen. Nach fünf mageren Ernten hoffen die Bauern heuer erstmals auf eine, vielleicht sogar leicht überdurchschnittliche Ernte. Der Wachstumsverlauf habe schöne dichte Bestände ergeben, den Krankheitsdruck habe man auch aufgrund zahlreicher resistenter Sorten und geringen Problemen mit dem mehltau sehr gut in den Griff bekommen, so Markus Herz von der LfL. Er zeigte sich „vorsichtig optimistisch“, dass der Ertrag heuer über dem Fünf-Jahres-Mittel liegen könnte.
Voraussetzung dazu sei aber auch das entsprechende Erntewetter in den kommenden Wochen. „Wir hoffen, dass das Wetter hält, dann können wir auch die Früchte vom Feld holen“, sagte Mälzerbundpräsident Markus Burteisen. „Wenn der August trocken bleibt, können wir eine tolle Ernte reinbringen“, so Frithjof Thiele vom Braugerstenverein. Nach all den Turbulenzen der zurückliegenden Monate hätten dies die Bauern auch wirklich verdient, so Martin Schöffel.
Der Landkreis mit der größten Sommergersten-Anbaufläche in Oberfranken ist der Statistik zufolge Hof mit 6607 Hektar, gefolgt von Kulmbach mit 3529 Hektar und Wunsiedel mit 3437 Hektar. Die Sommergersten-Anbauflächen gibt es in Lichtgenfels (1267 Hektar), Kronach (772 Hektar) und Coburg (480 Hektar).
Die Braugerstenrundfahrt, die der Oberfränkische Braugerstenverein regelmäßig zusammen mit dem Amt für Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg und der Erzeugerring für pflanzliche Qualitätsprodukte durchführt, machte heuer in Steinbach bei Marktleugast im Landkreis Kulmbach auf dem Betrieb Petzold und auf dem Betrieb Kießling in Plösen bei Münchberg im Landkreis Hof Station. Außerdem wurde der Landessortenversuch Sommergerste in Bärlas bei Weißdorf im Landkreis Hof besichtigt.
Bild: Optimismus nach schweren Jahren: Bei der oberfränkischen Braugerstenrundfahrt nahmen die Fachleute die Bestände, hier auf einem Feld bei Marktleugast im Landkreis Kulmbach, genau unter die Lupe.
Kühl und nass statt heiß und trocken / Keine größeren Schäden: Bauernverband blickt einigermaßen optimistisch auf die Ernte in Oberfranken
Haig.
Von einer durchschnittlichen bis leicht
unterdurchschnittlichen Ernte geht der Bauernverband
in Oberfranken aus. Optisch sehen die Bestände gut
aus, sagte BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif bei
der Erntepressekonferenz auf einem Feld des
stellvertretenden Kronacher Kreisobmanns Benedikt
Zehnter in Haig. Von überdurchschnittlichen Erträgen
sei man aber weit entfernt. Grund dafür: war es in
der Vergangenheit stets zu heiß und zu trocken, sei
es heuer eher kühl und fast schon ein wenig zu naß.
Dabei sei Oberfranken aber noch gut davon gekommen,
denn von Überschwemmungen blieb der Regierungsbezirk
weitgehend verschont.
Schon der Herbst 2023 sei von Niederschlägen geprägt gewesen, so dass Winterweizen, Wintergerste und Winterraps wochenlang unter Wasser gestanden hätten. Ein weiteres Problem sei dann der späte Wintereinbruch mit Schnee und Temperaturen von unter 7 Grad Celsius Ende April gewesen. Trotzdem zeigten sich die fränkischen Landwirte dankbar, dass sie von lang anhaltenden Starkregenereignissen und damit einhergehenden dramatischen Überschwemmungen verschont geblieben seien. Die gleichmäßig verteilten Niederschläge der zurückliegenden Monate hätten sogar ihr Gutes: Auf dem Grünland konnten hohe Erträge und gute Qualitäten erzielt werden. Damit hätten die Rinderhalter, allen voran die Milchviehbetriebe, aber auch Biogasanlagenbetreiber einen ordentlichen Grundfuttervorrat schaffen können, der nach den mageren Ernten der letzten Jahre aber auch dringend notwendig gewesen sei.
Von einem geringeren Hektarertrag und niedrigeren Ölgehalten gehen die oberfränkischen Landwirte beim Raps aus. Aufgrund der Nässe und des Frostes hätten viele Bestände gelitten. Bei Frühjahrtskulturen, wie Mais, Kartoffeln oder Zuckerrüben würden erst die kommenden Wochen über Erntemengen und Qualitäten entscheiden. Wärmere Temperaturen förderten die Photosynthese und damit auch die Einlagerung von Zucker und Stärke in der Pflanze. „Deshalb sind uns momentan trockene und sonnige Tage lieber, als der Regen“, so Hermann Greif.
In Oberfranken werden nach den Zahlen des Bauernverbandes rund 300,000 Hektar Fläche landwirtschaftlich genutzt. Ein gutes Drittel davon ist Grünland, der rest Ackerfläche. Während sich der Grünlandanteil in den zurückliegenden zehn Jahren um rund 5000 Hektar erhöht hatte, waren im gleichen Zeitraum etwa 15000 Hekta Ackerfläche verschwunden.
Interessant ist ein Blick in die Statistiken der oberfränkischen Landwirtschaftsämter: keine Kultur hat demnach einen höheren Anteil als 17 Prozent. „Monokulturen sind damit in Oberfranken ein Fremdwort“, sagte Hermann Greif. Den Hauptumfang der Früchte machen Mais und Winterweizen mit jeweils über 30000 Hektar, gefolgt von Wintergerste (25000 Hektar) und Klee-/Ackergras mit (21000 Hektar) aus.
Auffällig sei vor allem, dass der für das „Bierland Oberfranken“ typische Anbau von Sommerbraugerste in den letzten zehn Jahren massiv zurückgegangen ist. Machte die Sommergerste 2015 noch einen Anteil von 15 Prozent (32000 Hektar) aus, seien es heuer nur noch neun Prozent (knapp 18000 Hektar). Als Gründe dafür nannte der BBV-Präsident die eher niedrigeren und unsicheren Erträge in Kombination mit sinkenden Preisen und der alternative Anbau von zwischenzeitlich bei Mälzern und Brauern anerkannten Winterbraugersten-Sorten.
Die Erntepressekonferenz des oberfränkischen Bauernverbandes fand in diesem Jahr an einem Feldstück von Benedikt Zehnter in Haig statt. 2017 hatte er von seinem Vater den ehemaligen Gutsbetrieb am Fuße des Frankenwaldes übernommen, den er nun mit seiner Frau zusammen führt. Zwei Standbeine hat der Betrieb: Ackerbau und Fresseraufzucht, also die Mast weiblicher Nutzkälber. Außerdem beschäftigt sich Benedikt Zehnter sehr mit dem Thema Saatgutvermehrung. Er bewirtschaftet eine Fläche vn 165 Hektar und baut darauf im Wesentlichen Winterbraugerste, Winterweizen, Raps und Mais an. Eine Besonderheit ist der Anbau von Zuckerrüben.
Bild: Der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif, BBV-Direktor Wilhelm Böhmer, der Kronacher Kreisobmann Klaus Siegelin, Landwirt Benedikt Zehnter aus Haig, BBV-Geschäftsführer Harald Köppel und Kreisbäuerin Marina Herr (von links bei der Erntepressekonferenz im Landkreis Kronach.
Trockenschäden trotz feuchter Witterung? / Blick in die Glaskugel: Landwirte gehen von gemischten Ernteaussichten aus
Kulmbach.
Viele Landwirte in Bayern haben in den
zurückliegenden Wochen vor überschwemmtem Ackerland
gestanden. Während in Südbayern viele Bauern noch
gar nicht abschätzen können, wie sich das auf ihre
Ernte auswirkt und wie viel der Schäden sie ersetzt
bekommen, scheint Nordbayern mit einem blauen Auge
davongekommen zu sein. Hier ist sogar von
Trockenschäden die Rede.
„Das Erntejahr 2024 sieht bis jetzt ganz gut aus“, sagt der Kulmbacher BBV-Kreisobmann Harald Peetz aus Himmelkron. Die Bestände hätten den Winter ohne Schäden überstanden und auch die zwei Nächte mit Spätfrost bis minus sieben Grad, die im Wein und Obstbau große Schäden angerichtet haben, hätten das Getreide nicht nennenswert geschadet. Durch den nassen Winter und die vielen Niederschläge im Frühjahr bis jetzt seien die Böden gut mit Wasser versorgt und die Bestände dadurch gut bis sehr gut entwickelt. Durch die feuchte Witterung im ganzen Jahr war der Krankheitsdruck vor allem durch Pilzkrankheiten sehr hoch und man musste seine Bestände häufig kontrollieren, um geeignete Maßnahmen nicht zu verpassen.
In diesem Jahr konnten sich nach den Worten von Harald Peetz auch die Sommerkulturen einschließlich Mais, Klee und die Dauerwiesen gut entwickeln, so dass zurzeit die Futtersituation auf den Betrieben sehr gut ist. „Gott sei Dank sind wir von den extremen Unwettern der letzten Wochen in unserer Region, mit Ausnahme von kleinen Überschwemmungen auf Wiesen an Flussläufen, verschont geblieben, so dass wir positiv der Ernte entgegensehen können“, sagt der Kreisobmann. Und weiter: „Zur Ernte bräuchten wir natürlich auch einmal ein paar schöne trockene Wochen, dass das Getreide auch mit entsprechend hoher Qualität geerntet werden kann.“
Momentan mit Silage und Heu machen gut beschäftigt ist Martin Baumgärtner aus Unterzaubach. Er ist einer von zwei stellvertretenden Kreisobmännern im BBV-Kreisverband Kulmbach und betreibt am Ortsrand von Unterzaubach Mutterkuhhaltung mit rund 70 Tieren. „Die Ernte schaut aktuell nicht schlecht aus, vom Hochwasser sind wir überwiegend verschont geblieben“, sagt Martin Baumgärtner. Eine Herausforderung werde heuer aber die Ernte selbst, also die Bergung des Getreides sein.
Die Silage sei bis jetzt gut verlaufen, da reichten im Normalfall auch zwei bis drei Tage ohne Regen für die Bergung aus. Die Heuernte gestalte sich dagegen bislang sehr schwierig, deshalb sei auch noch sehr viel Heu auf den Fluren. Gut sei die Situation auch beim Getreide, bei den Winterkulturen auf jeden Fall, bei den Sommerkulturen komme es darauf an, wann gesät wurde.
Durch die „normalen Wetterbedingungen“ gegenüber den zurückliegenden paar Jahren, sei sicherlich auch der Pils und Krankheitsdruck beim Getreide wieder gestiegen. Auch das Unkraut bekomme dieses Jahr wieder verstärkt auf den Felder vor. Was die Wassersättigung der Böden angeht, sagt Martin Baumgärtner: „Das Grundwasser sollte jetzt wieder auf dem Normalstand sein.“ Flächen, die schon immer etwas feuchter waren, seien es auch in diesem Jahr wieder. „Die Böden sind gut mit Wasser versorgt, aber auch nicht überversorgt. Die Sonnenstrahlen und Intensität sind extremer und stärker geworden.“
Ähnlich sieht es Norbert Erhardt, der in Motschenbach, in der Gemeinde Mainleus einen klassischen Milchviehbetrieb mit rund 130 Kühen bewirtschaftet. Der Grundwasserspiegel sei hoch. Da aber gerade die Vegetationszeit ist und alles wächst, sei der Wasserbedarf auch entsprechend hoch. Norbert Erhardt machte sogar bereits erste Anzeichen von Trockenschäden bei der Braugerste aus. Der Landwirt bewirtschaftet rund 150 Hektar Fläche, alles im Gemeindegebiet von Mainleus. Er baut unter anderem auch Weizen, Wintergerste, Mais, Raps und Luzerne an.
Durch die feuchte Witterung rechnet Norbert Erhardt mit einer guten Ernte, da die Wasserversorgung immer gegeben war. „Für Landwirte war die Witterung bisher optimal“, sagt er. Von Überschwemmungen sei er nicht betroffen gewesen. Allerdings sei das Getreide krankheitsanfälliger: „Ja, der Krankheitsdruck ist durch die feuchte/warme Witterung extrem hoch. Der Aufwand, es gesund zu halten, auch“, so Norbert Erhardt. Was die Futtersituation angeht, antwortet er mit einer Bauernregel: „Ist der Mai feucht und nass, füllt er des Bauern Scheun` und Fass“. Die Wettersituation sei für den Futterbau momentan perfekt. Man habe einen guten Futtervorrat.
Wie die Ernte ausfallen wird, das sei eher ein Blick in die Glaskugel, so Anton Weig, Pflanzenbauexperte beim Amt für Landwirtschaft Coburg-Kulmbach. Es komme vor allem auch darauf an, wie sich das Wetter jetzt weiterentwickelt. Für das Getreide sei das kühl-feuchte Wetter eigentlich ideal gewesen, weil es schön langsam wachsen konnte. Problem des kühl-feuchten Wetters sei aber auch das Auftreten zahlreicher Pilzkrankheiten gewesen. Es sei immer gut, wenn es im Frühjahr nicht gleich so warm werde, denn dann hätten die Pflanzen Zeit, sich zu entwickeln. So habe auch der Raps gut gedeihen können, habe auf der anderen Seite aber auch unter einem höheren Krankheitsbefall gelitten.
Ein besonderes Ereignis sei der kurzzeitige Wintereinbruch am letzten Aprilwochenende im Zusammenhang mit einigen Frostnächten davor gewesen. Da habe es vor allem im Landkreis Bamberg ziemlich viel Raps „umgedrückt“, nicht ganz so schlimm sei es in Kulmbach gewesen. Bei Getreide und Raps habe es teilweise leichte Frostschäden gegeben.
Während der Januar und der Februar recht warm gewesen sei, waren die folgenden Wochen eher einen Tick zu kühl und zu feucht, so Pflanzenbauexperte Anton Weig. Aber insgesamt bewege sich dies alles im Rahmen. Geändert habe sich die Situation bei Starkniederschlägen. Die hätten mittlerweile eine wesentlich höhere Intensität, soll heißen, sie kommen immer plötzlicher und die Tropfen würden immer größer. Dadurch werde das Getreide nach unten gedrückt und vor allem frisch bestellte Maisfelder hätten stark unter Erosion und Verkrustung der Oberflächen zu leiden.
Manche Tallagen oder Senken seien momentan schon noch sehr feucht, so dass man oft gar nicht hineinfahren kann. Besonders problematisch sei dies beim Grünland, weil die Zeitfenster zwischen den einzelnen Regenfällen so kurz seien. Fährt der Landwirt dann doch hinein, hinterlässt er tiefe Spuren. Viele Landwirte hätten ihr Grünland heuer noch gar nicht mähen können. Nun hofften alle auf beständigeres Sommerwetter.
Bild: Schaut gar nicht so schlecht aus: Bauern aus dem Kulmbacher Land blicken hoffnungsvoll auf die anstehende Ernte
Landwirtschaft trifft Verbraucher, Bauernhof trifft Stadt / Zentrale Veranstaltung zum Tag des offenen Hofes in Oberfranken
Hirschberglein.
Schmecken, riechen, anfassen und mit den Menschen
sprechen. Per Facebook, Instagram oder Tik Tok geht
das nicht. Wer Landwirtschaft live erleben wollte,
der musste am Sonntag schon zu den Tagen des offenen
Hofes kommen. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung
fand dabei in Bayern ganz oben statt, im
Geroldsgrüner Ortsteil Hirschberglein im Landkreis
Hof.
Hier hat die Familie Browa ihren Betrieb. Eine bayernweite Besonderheit: Elke Browa ist die Hofer Kreisbäuerin, ihr Mann Ralph Kreisobmann. Hier, auf den Höhen des Frankenwaldes, bewirtschaftet die Familie seit 2007 in fünfter Generation einen Milchviehbetrieb mit 80 Milchkühen plus Nachzucht. 75 der insgesamt rund 100 Hektar Fläche sind Ackerland, der Rest Grünland. Ihre Milch liefert die Familie Browa an die Milchwerke Oberfranken-West in Meeder bei Coburg, das Schlachtvieh geht über die Nordbayerische Vermarktungsgesellschaft (NVG) nach Bayreuth, männliche Nutzkälber werden über den Rinderzuchtverband Oberfranken vermarktet. Mit Andrea, Nicole, Matthias und Carina hat das Ehepaar Browa vier Kinder, die alle auf dem Hof kräftig mitanpacken.
So
auch beim Tag des offenen Hofes. Da gab es vieles
vorzubereiten, wochenlang habe man geplant,
organisiert, aufgebaut und alles auf Hochglanz
gebracht. Nötig wäre das alles nicht gewesen, denn
der Hof ist auch so ein echter Vorzeigebetrieb.
Belohnt wurde die Familie Browa mit bestem Wetter
und mehreren tausend Besuchern, nicht nur aus dem
Hofer Land, sondern auch aus den Nachbarlandkreisen
Kronach und Kulmbach und teilweise auch von weiter
her.
Prominenteste Gäste zur zentralen Eröffnung waren die neue bayerische Milchkönigin Elisabeth Heimerl aus dem oberpfälzischen Nittenau, BBV-Präsident Günther Felßner und die stellvertretende Landesbäuerin Christine Reitelshöfer. „Die Landwirtschaft ist die Lösung für viele zentrale Zukunftsfragen“, sagte BBV-Präsident Felßner. „Die Agrikultur ist die Mutter aller Kulturen.“ Der Mensch könne auf einiges verzichten, aber auf das Essen nicht, so Felßner. Dabei gehe es den Landwirten schon lange nicht mehr nur um die Ernährung, sondern auch um die Energie. Auch die stofflichen Grundlagen könnten ohne die Landwirtschaft nicht auf eine nachhaltige Basis gestellt werden. Um all dies dem Verbraucher immer wieder klarzumachen, seien Tage des offenen Hofes so wichtig. „Das ist Öffentlichkeitsarbeit im besten Sinne“, so der Präsident. Hier treffe die Landwirtschaft den Verbraucher und der Bauernhof die Stadt.
Für
die neue Milchkönigin Elisabeth Heimerl war es der
erste große öffentliche Auftritt. Ihr Ziel sei es,
den landwirtschaftlichen Betrieben eine Stimme zu
geben, sagte die 23-Jähriger aus dem Landkreis
Schwandorf. Dies sei wichtiger denn je zuvor, denn
die Verbraucher seien noch nie so kritisch gewesen.
Ihre Grüße überbrachten auch die beiden politischen
Vertreter, der Bundestagsabgeordnete Jonas Geissler
und der Landtagsabgeordnete Kristan von Waldenfels,
bei de CSU. Gerade den ländlichen Raum habe die
Politik derzeit nicht im Blick, kritisierte Geissler
und Waldenfels merkte an: „Euer Einsatz ist einfach
unglaublich, dafür können wir gar nicht genug
danken.“
Zuvor hatte Pfarrer Klaus Wiesinger eine Andacht gehalten, in der er sich als ein starker Fürsprecher der Bauern erwies. Seinen Worten wurden sogar spontan mit Applaus quittiert. Nahrung sei im Überfluss vorhanden, deshalb seien die meisten Menschen auch gar nicht interessiert daran, wie es in der Landwirtschaft zugeht. Dazu kämen Verordnungen, Vorschriften und immer wieder auch ungerechtfertigte Vorwürfe. Das könne er schon verstehen, wenn den Bauern die Landwirtschaft keine Freude mehr macht. Allen Kritikern schrieb der evangelische Geistliche aber ins Stammbuch: „Ohne Lebensmittel wäre das Leben schnell zu Ende.“ Auf alles könne man notfalls verzichten, nur auf das Essen nicht. Und das könne nun mal nicht aus dem Reagenzglas kommen, denn selbst für ein Steak aus dem Labor brauche man zuvor eine lebendige Kuh.
Umrahmt
wurde die Eröffnungsfeier von den örtlichen
Jagdhornbläsern, dem Landfrauenchor Hof und der
Landjugend aus Weidesgrün. Den ganzen Tag über gab
es Informationsstände und Mitmachangebote von
Landtechnikunternehmen, Futtermittelfirmen, der
Maschinenring Münchberg war zur Stelle, mehrere
Direktvermarkter, die Besamungsstation Wölsau
stellte sich vor, für die kleinsten gab es
Ponyreiten und die Traktorfreunde Geroldsgrün hatten
zwischen all dem modernen Gerät sogar einige
Oldtimer postiert
Bilder:
1. BBV-Präsident
Günther Felßner, die stellvertretende Landesbäuerin
Christine Reitelshöfer, Milchkönigin Elisabeth
Heimerl sowie Elke und Ralph Browa (von links) bei
der Eröffnung zum Tag des offenen Hofes.
2. Einige
Volkstänze führte die Landjugend Geroldsgrün vor.
3. Ein
Besuchermagnet beim Tag des offenen Hofes war der
Jungviehstall.
4. Elke
Browa führte BBV-Präsident Günter Felßner durch den
großzügigen Laufviehstall.
5. Zu
jeder Tageszeit gut besucht war die Hofstelle der
Familie Browa in Hirschberglein in Landkreis Hof.
6. Landwirtschaft
live erleben: so lautete das Motto auf dem
Milchviehbetrieb der Familie Browa.
7. Mehrere
tausend Besucher hat der Tag des offenen Hofes in
den Landkreis Hof gelockt.
8. Historische
Traktoren und moderne Landtechnik: Zahlreiche
Mitstreiter sorgten für ein abwechslungsreiches
Programm.
Multifunktional, klimaeffizient und ressourcenschonend / Zuverlässiger Partner für die bayerische Landwirtschaft: BBJ-Unternehmensgruppe eröffnete ortsbildprägenden Bürokomplex
Kulmbach.
Mit einem Festakt hat die BBJ-Unternehmensgruppe ihr
großes Bürohaus am Gumpersdorfer Weg in Kulmbach
eröffnet. Der Komplex beherbergt künftig den
Landwirtschaftlichen Buchführungsdienst (LBD), die
BERATA-Steuerberatungsgesellschaft für die
gewerbliche Buchführung und Steuerberatung sowie die
Wirtschafts-Revisions-Beratungs-GmbH (RWB). In dem
ortsbildprägenden Gebäude sind derzeit 70
Mitarbeiter tätig.
Von Untersteinach auf der Umgehung kommend ist der riesige moderne Bau mit seinem großen Glasfronten am Gumpersdorfer Weg in Kauernburg kaum zu übersehen. Er war in den zurückliegenden zwei Jahren an der Stelle eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens entstanden. Das Gebäude hat eine Nutzfläche von 2300 Quadratmetern und ist mit neuester und innovativster Technik ausgestattet. Beheizt und gekühlt wird es von zwei Wärmepumpen, auf dem Dachwurde eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung installiert, Tiefgarage und Parkdeck bieten Platz für 60 Fahrzeuge.
Die Einführung der Buchhaltung habe in den Sechziger Jahren in vielen Betrieben noch als Revolution gegolten, daran erinnerte Staatssekretär Martin Schöffel bei der Einweihung. Doch schnell habe sich gezeigt, dass auch in dieser Branche großer Bedarf an qualifizierter und umfassender Beratung herrscht, der weit über die Buchhaltung hinaus geht. Daraus habe sich ein starker Unternehmensverbund entwickelt. Rahmenbedingungen, Auflagen, Förderprogramme und steuerliche Vorgaben änderten sich auf europäischer und nationaler Ebene konstant und machten auch künftig eine fachliche Steuer- und Unternehmensberatung unverzichtbar.
Der
Bayerische Bauernverbandspräsident Günther Felßner
sprach bei der Eröffnung mit Blick auf die
Unternehmen LBD und BERATA von einer bemerkenswerten
Erfolgsgeschichte für die bäuerlichen
Familienbetriebe während der zurückliegenden 40
Jahre. Den Büroneubau bezeichnete der BBV-Präsident
als Best-Practice-Beispiel, wie multifunktional,
klimaeffizient und ressourcenschonend gebaut werden
kann. Landrat Klaus Peter Söllner nannte die
Beratungsfirmen zuverlässige Partner für die
Landwirtschaft und für landwirtschaftsnahe Betriebe.
Mit innovativen Ideen, hohen persönlichen Einsatz
und außergewöhnlichem Engagement habe Gerhard Müller
als Gründungsvater die Kulmbacher Niederlassung
hervorragend positioniert.
Auch Landtagsabgeordneter Rainer Ludwig würdigte den visionären Unternehmergeist von Gerhard Müller, der für eine eindrucksvolle Erfolgsstory auf höchstem Niveau stehe. Die BBJ-Unternehmensgruppe stehe für ein qualifiziertes Dienstleistungsnetz nicht nur für Landwirte, der Neubau drücke architektonische Eleganz, funktionelle Ausstattung und zukunftsweisende Planung aus.
Der Buchführungsdienst der Bayerischen Jungbauernschaft (BBJ) wurde 1968 als Verein gegründet. Nachdem die Beratungsleistungen im Laufe der Jahre immer mehr zugenommen hatten, entstanden 1978 die beiden Gesellschaften LBD und BERATA. In den folgenden Jahren wurde eine Reihe von Beteiligungen gegründet und erworben, darunter die Wirtschafts-Revisions-Beratungs-GmbH für Wirtschaftsprüfungen und ähnliche Dienstleistungen. Das Unternehmen umfasst derzeit eine Vielzahl von Dienstleistungen mit mehr als 1200 Mitarbeitern in über 40 Kanzleien in Bayern und in den östlichen Bundesländern. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei über 100 Millionen Euro. Etwa ein Drittel komme davon aus der Landwirtschaft, zwei Drittel aus dem gewerblichen Bereich, wobei auch hier viele Landwirte, etwa durch Photovoltaikanlagen, beteiligt sind.
Die für ganz Oberfranken zuständige Kanzlei in Kulmbach mit ihren Außenstellen in Bayreuth, Hof, Scheßlitz und im sächsischen Plauen hatte der ehemalige Landwirt und gelernte Steuerberater Gerhard Müller 1981 im Keller seines Wohnhauses gegründet. Nicht zuletzt deshalb hatte ihn Landrat Klaus Peter Söllner bei der Einweihung scherzhaft als „Bill Gates von Kauernburg“ bezeichnet. Nachdem Gerhard Müller die ehemalige Hofstelle seiner Eltern abgerissen, um- oder neu gebaut hatte, reichten die Kapazitäten nicht mehr aus, so dass er sich 2015 für den Neubau entschied. Die Kulmbacher Kanzlei betreut rund 2000 Landwirte im gesamten Regierungsbezirk und angrenzenden Gebieten sowie zahlreiche gewerbliche Kunden. Der Umsatz im Kanzleiverbund vor Ort liegt bei rund 10,5 Millionen Euro, die Zahl der Mitarbeiter bei rund 120.
Bilder:
1. Ortsbildprägend
ist das neue Bürogebäude der BBJ-Unternehmensgruppe
am Gumpersdorfer Weg in Kauernburg.
2.
Bauherr Gerhard Müller (links) hat den symbolischen
Schlüssel für den Bürokomplex an Gunter Nüssel, dem
Geschäftsführer des Landwirtschaftlichen
Buchführungsdienstes und der
Steuerberatungsgesellschaft BERATA überreicht.
Landwirtschaft im Landkreis: Steigende Kosten, sinkende Einnahmen / Oberfränkischer Regierungspräsident informierte sich über Sorgen und Nöte der Bauern im Kulmbacher Land
Kulmbach.
Vier Betriebe und das Klima-Arboretum im Stadtwald
hat der oberfränkische Regierungspräsident Florian
Luderschmid bei einer Landwirtschaftsrundfahrt duch
den Landkreis Kulmbach besucht. Ihm sei es wichtig
gewesen, verschiedene Aspekte der Land- und
Forstwirtschaft kennenzulernen, erklärte Luderschmid.
Neben dem Öko-Legehennenbetrieb von Sabrina und
Michael Grampp bei Fölschnitz besuchte der
Regierungspräsident den Bio-Milchviehbetrieb von
Kerstin und Hermann Grampp in Unterkodach und den
Biohof Distler in Esbach. Weitere Stationen waren
das Klima-Arboretum am Trimm-Dich-Pfad und der
Fruchtgemüsebetrieb Scherzer & Boss in Feulersdorf.
Begleitet wurde Florian Luderschmid vom Leiter des
Bereichs Landwirtschaft an der Regierung, Rainer
Prischenk, und von Harald Weber, dem Chef des Amtes
für Landwirtschaft.
Bei seiner Tour durch den Landkreis erfuhr Florian Luderschmid auch von den vielen Problemen der Bauern. Steigende Kosten, sinkende Einnahmen, das ist es, was beispielsweise Sabrina und Michael Grampp umtreibt. „Die Futterpreise sind geradezu explodiert“, berichtete Michael Grampp. Im Gegenzug gebe der Verbraucher aufgrund der Inflation weniger aus und greife wieder auf die Billigeier aus dem Discounter zurück. „Wenigstens haben uns unsere Stammkunden die Treue gehalten“, so Sabrina Grampp.
Regierungspräsident
Luderschmidt bewunderte den Mut der Familie, aus der
klassischen Schiene auszusteigen und einen völlig
neuen Weg zu gehen. Genau das haben Sabrina und
Michael Grampp vor acht Jahren getan. Sie haben
ihren alten Anbindestall mit 25 Milchkühen plus
Nachzucht im Ort aufgegeben und sich für die
Alternative der Hühnerhaltung entschieden. Im Herbst
2015 war Baubeginn,im Juni 2016 konnten bereits die
ersten Hühner einziehen.
Es sei gar nicht so einfach, derartige Standorte für eine Betriebsaussiedlung zu finden, so Behördenchef Harald Weber. Das Immissionsrecht schreibe immer schärfere Abstände zu Biotopen, zum Wald oder zur nächsten Bebauung vor. Wenn bei der Familie Grampp alles problemlos gelaufen ist, dann sei das schon fast die Ausnahme.
Rund
9000 Hühner tummeln sich in den Stallungen bei
Fölschnitz, rund 8000 Eier werden pro Tag
produziert. Die Vermarktung erfolgt zum Teil direkt
im eigenen Hofladen, der größte Teil geht über den
Großhandel an Verbrauchermärkte. Auch das Posthotel
von Alexander Hermann im nahen Wirsberg wird mit den
Eiern aus Fölschnitz beliefert. Einen Teil des
Futters baut der Landwirt selbst an, den anderen
teil kauft er bei Bio.-Kollegen zu.
Ebenfalls nach biologischen Kriterien wirtschaftet die Familie, die auch Grampp heißt aber einen Milchviehbetrieb in Unterkodach bei Melkendorf bewirtschaftet. Kerstin und Hermann Grampp haben 2008 einen modernen Laufstall am Ortsrand errichtet. Mit seiner Nähe zum Stadtrand von Kulmbach, wenige Meter von der Melkendorfer Umgehung entfernt, hat der Hof der Familie Grampp schon eine ganz besondere Lage. War die alte Hofstelle, in der noch immer das Jungvieh sein Zuhause hat, gerade mal knapp 0,7 Hektar groß, hat die jetzige Hofstelle eine Fläche von stattlichen 2,7 Hektar.
Rund 200 Hektar bewirtschaftet die Familie, 70 Hektar Grünland, 130 Hektar Ackerland, auf dem unter anderem Kleegras, Getreide und Mais angebaut werden. Alles zum Eigenbedarf, denn die rund 160 Kühe brauchen schließlich genug zu Fressen. Nachdem das automatische Melksystem gut ausgelastet war, wurde später ein zweiter Melkroboter angeschafft. Seit 2017 wird der Betrieb nach den Bioland-Kriterien bewirtschaftet. Die Milch geht an die Milchwerke Oberfranken-West in Meeder bei Coburg.
Hauptproblem
der Familie Grampp aus Unterkodach ist die
EU-Öko-Verordnung, die künftig verpflichtend eine
Weidepflicht vorsieht. Für Hermann Grampp ein
absolutes Unding, denn von den 210 Hektar Fläche,
die von der Familie Grampp bewirtschaftet wird,
befindet sich nur ein kleiner Teil in seinem
Eigentum. Der weitaus größte Teil erstreckt sich auf
230 Feldstücke von 40 verschiedenen Pächtern. Die
Durchschnittsgröße eines Feldstücks liegt Hermann
Grampp zufolge bei einem einzigen Hektar. Diese
Konstellation ist so oder ähnlich in ganz
Oberfranken, wenn nicht in ganz Franken, zu finden.
Sollte die Weidepflicht so umgesetzt werden und es
keine Sonderregelung für Bestandsbetriebe gibt,
würden alle großen Bio-Milchviehbetriebe wieder
aussteigen, das befürchtet nicht nur Hermann Grampp
Das Ziel, 30 Prozent bio bis zum Jahr 2030 rückt
damit in weite Ferne.
Bilder:
1. Bereichsleiter
Rainer Prischenk, Bürgermeisterin Anita Sack,
Regierungspräsident Florian Luderschmid, Michael und
Sabrina Grampp sowie Behördenchef Harald Weber (von
links) besichtigen den Raum, in dem die Eier
sortiert und versandfertig gemacht werden.
2. So
sieht er aus, der Stall des Legehennenbetriebs von
Sabrina und Michael Grampp.
3. 160
Milchkühe haben im Stall von Kerstin und Hermann
Grampp ein Zuhause gefunden.
4. Kerstin
Grampp erläutert dem oberfränkischen
Regierungspräsidenten Florian Luderschmid die
vielfgältige Technik in dem modernen Laufstall in
Unterkodach bei Melkendorf
Mit Linsenanbau zum Meisterpreis / Tim Görl und seine Familie bewirtschaften einen ökologischen Nebenerwerbsbetrieb in der Fränkischen Schweiz
Neuhaus.
Miteinander statt gegeneinander: die Familie Görl,
die in Neuhaus bei Aufseß einen ökologischen
Nebenerwerbsbetrieb bewirtschaftet meint damit nicht
nur das Miteinander von konventioneller und
biologischer Landwirtschaft, sondern auch das
Miteinander mit der Gesellschaft. „Wenn ich als
Landwirt möchte, dass sich die Gesellschaft über
Lebensmittel Gedanken macht, dann muss ich auch auf
die Gesellschaft zugehen“, sagt Tim Görl.
Gerade hat der 23-jährige seinen Landwirtschaftsmeister an der Schule in Landshut abgelegt. Weil er dort einer der besten seines Jahrgangs war, ist er mit dem Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet worden. Bereits im zurückliegenden Jahr hat er den Wirtschafter für ökologischen Landbau absolviert. Und er hat Großes vor: Vielleicht will er sogar aus dem heimischen Nebenerwerbsbetrieb einen Vollerwerbsbetrieb machen, aber das ist noch Zukunftsmusik. Derzeit ist er bei einem landwirtschaftlichen Dienstleister beschäftigt.
Er
sei schon immer praktisch veranlagt gewesen, sagt
Tim Görl, der sein Abitur an der Gesamtschule in
Hollfeld gemacht hat. Die Lehre dauerte aufgrund der
bestandenen Hochschulreife nur zwei Jahre, dann ging
es nach Landshut–Schönbrunn. Die Wahl fiel deshalb
auf das Agrarbildungszentrum in der
niederbayerischen Stadt, weil es dort einen
Schwerpunkt Ökolandbau gibt. Und auch, weil man
dort, fernab von zuhause, mit den Mitschülern offen
über den eigenen Betrieb reden kann, ohne dass die
Zahlen gleich kritisch beäugt werden. „Der Austausch
mit den anderen war mir immer ganz wichtig“, sagt
Tim Görl. Die Mitschüler kamen dabei nicht nur aus
allen Teilen Bayerns, sondern auch aus Baden
Württemberg und einer sogar aus Rügen. Nächtelang
habe man da oft diskutiert, habe sich ausgetauscht
und stehe noch immer in gutem Kontakt miteinander.
Mit dem Meisterprojekt hat Tim Görl Neuland beschritten. Er hat Anbauversuche mit Linsen unternommen. Obwohl, so ganz neu ist die Linse nicht, die Hülsenfrucht gilt als eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. Allerdings ist sie Hierzulande etwas in Vergessenheit geraten. Erst mit den verschiedenen Eiweißinitiativen wurde die Linse wieder interessant. Auf einem Hektar bei Neuhaus hat Tim Görl für sein Meisterprojekt verschiedene Anbauvarianten untersucht und unterschiedliche Linsensorten verglichen. Als Ergebnis könnte man festhalten, dass die Linse durchaus eine ernstzunehmende Alternative zu vielen anderen Feldfrüchten darstellt, zumal sie Trockenheit sehr gut wegsteckt und mit den hiesigen kargen Böden sehr gut zurechtkommt. Vermarktet werden die Linsen derzeit direkt im Hofladen eines befreundeten Betriebes ganz in der Nähe.
In
Neuhaus, direkt am Bierwanderweg, betreibt die
Familie, das sind die Eltern Heike und Matthias Görl
sowie die beiden Schwestern Lea und Mona den
Nebenerwerbsbetrieb, der sich in erster Linie als
Ackerbaubetrieb versteht. Auf den Feldern ringsum
wird Roggen und Dinkel angebaut, das direkt an eine
Bäckerei nach Bamberg vermarktet wird. Die
Braugerste geht ebenfalls nach Bamberg zur Mälzerei
Weyermann. In kleinerem Umfang werden noch Ferkel
erzeugt und die Mutterschafe dienen der
Landschaftspflege. Im Hauptberuf ist Vater Matthias
als Berater beim Amt für Landwirtschaft in Bamberg
tätig. Nachdem die Familie den Betrieb 2006 von den
Eltern übernommen hatte, entschied man sich, auf
eine ökologische Bewirtschaftungsweise umzustellen.
Die Entscheidung fiel auf Naturland. „Wir waren
überzeugt, das ist unser Weg, das ist die Zukunft“,
so Matthias Görl.
Auch Mona und Lea Görl setzen sich aktiv für die Landwirtschaft ein. Mona (22) ist gelernte Landmaschinenmechatronikerin und studiert derzeit Metallbau, Lea (24) studiert Informatik in München. Zusammen halten sie Vorträge und veranstalten Seminare für die Hanns-Seidel-Stiftung. Unter dem Titel „No farmers, no food“ erklären sie Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zusammen mit Bruder Tim und Vater Matthias, was Landwirtschaft ausmacht. „Mit dem Thema Ernährung haben sich viele beschäftigt, mit der Landwirtschaft kaum“, stellen sie immer wieder fest. „Wir wollen anderen Menschen, die wenig Berührungspunkte mit Landwirtschaft haben, nahe bringen, warum Landwirtschaft jeden betrifft, warum es wichtig ist zu informieren, sich eine Meinung zu bilden und zu diskutieren.“
Bilder:
1. Die Familie Görl mit Mona, Matthias, Heike, Lea
und Tim (von links) bewirtschaftet in Neuhaus bei
Aufseß einen Nebenerwerbsbetrieb mit Ackerbau,
Ferkelerzeugung und Schafhaltung.
2. Ausgezeichnet mit dem Meisterpreis der
bayerischen Staatsregierung: Tim Görl ist
Landwirtschaftsmeister und hat mit seinem Projekt
des Linsenanbaus in der Fränkischen Schweiz bereits
für Aufsehen gesorgt.
Schauversuche auf acht Hektar / Am 19. Juni findet der Pflanzenbautag in Lopp statt
Lopp.
Für die Landwirte im Kulmbacher Raum ist er ein
fester Termin: der Pflanzenbautag nahe der kleinen
Ortschaft Lopp bei Kasendorf. Er findet in diesem
Jahr am 19. Juni statt, die beiden Führungen
beginnen um 13 und um 19 Uhr. Veranstalter sind der
Erzeugerring für landwirtschaftlich pflanzliche
Qualitätsprodukte Oberfranken, der Maschinenring
Kulmbach und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Coburg-Kulmbach.
„Der Grundgedanke ist es, die Landwirte im Kulmbacher Raum in Sachen Sortenwahl zu beraten“, sagt Dominik Schmitt, Pflanzenbauberater beim Erzeugerring, der in Danndorf den Naturlandhof Schmitt bewirtschaftet. Beim Pflanzenbautag in Lopp werden dazu zahlreiche Schauversuche erörtert, bei denen verschiedene Sorten, teilweise alte und bewährte, aber auch ganz neue, auf Parzellen nebeneinander angebaut wurden. Das Ganze finde unter praxisüblichen Bedingungen statt was Düngung, Pflanzenschutz oder Aussaatstärke angeht, so Dominik Schmitt.
Die acht Hektar große Fläche, auf der Hafer, Raps, Weizen, Triticale, Sommer- und Wintergerste eigens für den Schauversuch angebaut wurde, gehört dem Landwirt Gerhard Friedlein aus Lopp. Was die Saaten anbelangt, sei einiges geboten, erklärt er. Pro Kultur gebe es zwischen fünf und zehn Sorten zu begutachten, so dass jeder Landwirt für sich einen individuellen Nutzen aus der Veranstaltung ziehen könne.
Welche Krankheiten treten bei welcher Sorte auf? Wie reagiert die Pflanze auf Fungizide? Was ist für die hiesigen Böden optimal? Wie reagieren die jeweiligen Sorten auf die verminderte Düngung hier im roten Gebiet? Um dieser und viele andere Fragen wird es beim Pflanzenbautag gehen.
„Mein Antrieb ist das Interesse an neuen Sorten“, sagt Gerhard Friedlein, der für die Veranstaltung einen gewaltigen Aufwand betreibt. Das Saatgut wurde in der Regel von der Industrie zur Verfügung gestellt, so Dominik Schmitt, der wieder mit knapp 100 Besuchern rechnet.
Bild: Pflanzenbauberater Dominik Schmitt (links) und Landwirt Gerhard Friedlein erwarten zum Pflanzenbautag in Lopp an die 100 Landwirte aus der Region.
Landwirtschaft für die breite Bevölkerung / Tag des offenen Hofes: Bayernweite Eröffnung in Hochfranken
Hirschberglein.
Der Tag des offenen Hofes wird in diesem Jahr in
Hirschberglein bei Geroldsgrün auf dem Betrieb von
Elke und Ralph Browa zentral für ganz Bayern
eröffnet. Dafür wird BBV-Präsident Günther Felßner
am 9. Juni in den oberfränkischen Landkreis Hof
kommen und alle Besucher willkommen heißen. Der
BBV-Kreisverband rechnet mit mindestens 2000
Besuchern, schönes Wetter vorausgesetzt.
„Es ist seit sechs oder sieben Jahren der erste Tag des offenen Hofes, der wieder im Landkreis Hof stattfindet“, sagt BBV-Geschäftsführer Thomas Lippert. Ihm sei es wichtig, die breite Bevölkerung anzusprechen. Warum sich Günther Felßner ausgerechnet Hirschberglein ausgesucht hat ist nicht nur mit den guten Kontakten der Familie Browa zur Bauernverbandsspitze zu erklären, sondern auch mit der bayernweit einzigartigen Konstellation, dass Elke Browa die Kreisbäuerin und ihr Mann Ralph der Kreisobmann des Landkreises Hof sind.
Das Fest zum Tag des offenen Hofes beginnt um 9.30 Uhr mit einer Ökumenischen Andacht in der Maschinenhalle, an der auch der weit über Landkreisgrenzen hinaus bekannte Hofer Landfrauenchor unter der Leitung von Helmut Lottes mitwirken wird. Danach gibt es Einblicke in den modernen Laufviehstall, Hofführungen und eine großangelegte Landtechnikausstellung sowie viele Info-Stände land- und forstwirtschaftlicher Organisationen, Verbände und handwerklicher Betriebe. Für Unterhaltung sorgen die Jagdhornbläser und die Tänze der Landjugend. Regionale Spezialitäten an Bauernmarktständen runden das breite Angebot ab. Dazu gibt es ein Kinderprogramm mit einem Traktor-Parcours, Ponyreiten, einer Hüpfburg und einer Schminkstation.
Elke und Ralph Browa bewirtschaften hier auf den Höhen des Frankenwaldes einen Milchviehbetrieb mit 80 Milchkühen plus Nachzucht. 75 der insgesamt rund 100 Hektar Fläche sind Ackerland, hier wird Mais, Weizen, Kleegras, Winter- und Sommergerste sowie Raps angebaut. Die restlichen 25 Hektar sind Grünland, hier wächst das Futter für den Eigenverbrauch. Die Milch liefert die Familie Browa an die Milchwerke Oberfranken-West in Meeder bei Coburg, das Schlachtvieh geht über die Nordbayerische Vermarktungsgesellschaft (NVG) nach Bayreuth, männliche Nutzkälber werden über den Rinderzuchtverband Oberfranken vermarktet. Mit Andrea, Nicole, Matthias und Carina hat das Ehepaar Browa vier Kinder, die alle auf dem Hof kräftig mitanpacken. Tochter Nicole hat erst vor kurzem die Meisterprüfung abgelegt. Elke und Ralph Browa führen den Betrieb seit 2007 in fünfter Generation.
Einen weiteren Tag des offenen Hofes gibt es ebenfalls am 9. Juni im Nachbarlandkreis Wunsiedel auf dem Buchberghof von Martina und Florian Reichel in Fichtenhammer bei Kirchenlamitz. Dort hat BBV-Präsident Günther Felßner für 15 Uhr sein Kommen angekündigt.
Bild: Elke Browa, Stefanie Schmidt, Tochter Nicole, Ralph Browa und BBV-Geschäftsführer Thomas Lippert (von links) bereiten den Tag des offenen Hofes in Hirschberglein vor.
Bachsaiblinge statt Bratwürste / Oberfränkische Teichwirte eröffneten die Fischgrillsaison – Kritik am Umweltpolitik: „Fischerei und Fischotter schließen sich aus“
Lauter.
Es müssen nicht immer Steaks und Bratwürste sein.
Zur Eröffnung der Grillsaison auf dem Forellenhof
Deusdorfer Mühle bei Lauter im Landkreis Bamberg hat
die Teichgenossenschaft Oberfranken die Werbetrommel
für den heimischen Süßwasserfisch gerührt. Der
Zusammenschluss von rund 700 Teichwirten aus allen
Landkreisen des Regierungsbezirks will damit zeigen,
dass sich Bachsaiblinge und Regenbogenforellen
genauso gut zum Grillen eignen, wie T-Bone-Steaks
oder Spareribs.
„Der Fisch kommt meistens zu kurz, wenn es ums Grillen geht“, sagte der Vorsitzende der Teichgenossenschaft, Peter Thoma aus Thiersheim. Die Bemühungen des Zusammenschlusses tragen inzwischen auch schon Früchte: „Wir haben seit Jahren steigende Absatzzahlen“, so der Vorsitzende.
Ein wenig getrübt hat die Stimmung allerdings der Fischotter. Hatten die Teichwirte, die ihre Gewässer meist im Nebenerwerb bewirtschaften, in der Vergangenheit immer wieder Ärger mit Kormoranen oder Bibern, so sei der Fischotter mittlerweile zur echten Katastrophe geworden, so hieß es. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die grüne Umweltministerin Steffi Lemke mit rund 5,8 Millionen Euro die Verbreitung des Fischotters fördern möchte.
„Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Teichwirte“, so hieß es. „Das sind Steuergelder, mit denen die Teichwirtschaft vernichtet werden soll“, schimpfte Peter Thoma. „Fischerei und Fischotter schließen sich weitgehend aus.“ Wertvolle heimische Speisefische würden an den Fischotter verfüttert, während gleichzeitig Fische aus Südostasien nach Europa importiert werden. „Wo bleibt da die Nachhaltigkeit?“, so Peter Thoma, der auch zu bedenken gab, dass der Otter auch Amphibien, Reptilien und sogar Vögel jagt. Früher habe es in der nahen Oberpfalz sogar Prämien für den Abschuss des Fischotters gegeben.
So weit wollte die Politik bei der Eröffnung der Fischgrillsaison dann doch nicht gehen, doch der Landtagsabgeordnete Holger Dremel sagte zumindest zu, dass er sich für rechtliche Rahmenbedingungen einsetzen werde, um die heimische Fischversorgung sicherzustellen. „Wir müssen den Fischotter aus dem Schutzstatus rausbekommen.“ Ohne entsprechende Maßnahmen sei die Fischzucht am Ende, so der oberfränkische Bezirkstagsvizepräsident und Bamberger Landrat Johann Kalb.
Der Forellenhof Deusdorfer Mühle gilt als eine der bekanntesten Fischspeisegaststätten Oberfrankens und ist in Fachkreisen weit über den Regierungsbezirk hinaus bekannt. Maria und Gerhard Rudolf bewirtschaften dort mehrere Naturteiche und ziehen die Setzlinge Jahr für Jahr in einem Quellwasserteich auf.
Bild: Fisch als Grillgut, dafür warben (von links) der Landtagsabgeordnete Holger Dremel, Maria und Gerhard Rudolf vom Forellenhof Deusdorfer Mühle, der Vorsitzender der Teichgenossenschaft Peter Thoma und der oberfränkische Bezirkstagsvizepräsident und Bamberger Landrat Johann Kalb.
Ohne Pflanzenschutz kein Raps / „Vorboten des Sommers“: Oberfränkische Landwirte erwarten durchschnittliche Rapsernte
Schmölz.
Die goldgelb blühenden Rapsfelder in vielen Regionen
Oberfrankens sind aktuell ein echter Hingucker und
ein beliebtes Motiv. Selbstverständlich ist das
allerdings nicht. Der heftige Wintereinbruch mit
Schnee bis in die Niederungen und teilweise
zweistelligen Minustemperaturen Ende April hat
vielen Landwirten einen gehörigen Schrecken
eingejagt. Nun aber steht fest, wenn überhaupt, dann
hat der Schnee beim Raps zwar den Haupttrieb
abgebrochen, so dass die Seitentriebe den Schaden
einigermaßen kompensieren konnten. Die
oberfränkischen Landwirte können deshalb im
laufenden Jahr von einer durchschnittlichen
Rapsernte ausgehen. Das haben der Vorsitzende Klaus
Siegelin und Geschäftsführer Torsten Gunselmann von
der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps
Oberfranken bei einem Pressetermin auf einem
Rapsfeld des Landwirts Markus Koch oberhalb der
Ortschaft Schmölz im Landkreis Kronach bekannt
gegeben.
Gemeinhin gelten die blühenden Felder im Mai als Vorboten des Sommers. Vor allem im östlichen Oberfranken und in den höheren Lagen der Fränkischen Schweiz hatte dies bis vor kurzem allerdings noch ganz anders ausgesehen. An Obstbäumen seien beispielsweise viele Blüten dem späten Wintereinbruch zum Opfer gefallen. Auch beim Raps könne später Frost und Schnee zur Blütezeit große Schäden anrichten. Sollte der Schnee ganze Blüten abgebrochen haben, können die Ausfälle erheblich sein. Danach sieht es nach Angaben der Verantwortlichen in der Erzeugergemeinschaft allerdings nicht aus. Wie groß die Schäden aber tatsächlich sind, könne man erst dann beurteilen, wenn es wieder wärmer wird. „Eine richtige Prognose ist noch nicht möglich, wir gehen aber davon aus, dass es heuer eine durchschnittliche Ernte gibt“, so Torsten Gunselmann, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft und Referent beim oberfränkischen Bauernverband in Bamberg.
Raps sei eine besondere Frucht, denn sie werde in der Regel im August ausgesät und stehe bis zum Juli darauf auf dem Feld, erläuterte Klaus Siegelin, Vorstand und BBV-Kreisobmann von Kronach. „Mit seiner elfmonatigen Bodenbedeckung schützt der Raps Boden und Bodenlebewesen vor Erosion und Sonne.“ Trotzdem sei der Rapsanbau in Oberfranken zwischen 2010 und 2019 stetig zurückgegangen. Waren es 2010 noch rund 21000 Hektar Raps im gesamten Regierungsbezirk, habe der wert 2019 mit knapp unter 10000 Hektar seinen Tiefststand erreicht. Aktuell geht man von einer Anbaufläche von gut 14000 Hektar aus.
Grundsätzlich
komme der Raps sehr gut mit den klimatischen
Bedingungen und den Standortvoraussetzungen in
Oberfranken zurecht, sagte Klaus Siegelin. Leider
hätten in den zurückliegenden Jahren die nur noch
eingeschränkten Möglichkeiten im Pflanzenschutz den
Rapsanbau für die Landwirte unattraktiv gemacht.
Doch ohne Pflanzenschutz kein Raps, oder zumindest
kaum Raps, da sind sich die verantwortlichen von de
Erzeugergemeinschaft einig. Es gebe auch so gut wie
keine Ökobetriebe, die Raps anbauen, sagte Klaus
Siegelin. Dabei sei die neonicotinoide Beize ohnehin
nicht mehr zulässig. Der Schutz vor Rapsschädlinge
wie Erdfloh oder Kohlfliege könne damit nicht mehr
sichergestellt werden.
Auch die Düngung mache Probleme. Die Frühjahrsdüngung mit Stickstoff und Phosphor werde durch politische Vorgaben und ideologisch behaftete Auflagen so erschwert, dass eine rechtzeitige Düngung der Bestände gar nicht mehr möglich ist. Außer, der Landwirt sei bereit, Ertragseinbußen hinzunehmen, für die es keinerlei Ausgleich gibt.
„Raps ist ein Alleskönner“, so die Verantwortlichen der Erzeugergemeinschaft. Mit einem Ölgehalt von über 40 Prozent gilt er als eine der wichtigsten Ölpflanzen nach Palm und Soja. Ein Großteil des Rapses wird zu Biodiesel verarbeitet. Neben der Verwendung als technisches Öl wird Rapsöl auch in der Lebensmittelherstellung genutzt und in der wohl bekanntesten Form als Speiseöl angeboten und zum Braten, Kochen, für Salate oder bei der Margarineherstellung verwendet. Der Pressrückstand gilt als eiweißreiches Futter für Rinder und Schweine und obendrein bieten Rapsfelder für Bienenvölker einen enormen Honigertrag.
Bild: Andreas Sollmann von der Mara-Ölmühle Untersiemau, Vorstand und Kreisobmann Klaus Siegelin, Landwirt Markus Koch und Geschäftsführer Torsten Gunselmann (von links) von der Erzeugergemeinschaft begutachten ein Rapsfeld oberhalb der Ortschaft Schmölz im Landkreis Kronach.
Mehrheiten für vernünftigen Menschenverstand / Marlene Mortler tritt bei den kommenden Europawahlen nicht mehr an – BBV-Veranstaltung in Himmelkron
Himmelkron.
Am 9. Juni ist Europawahl. Vom Wahlkampf ist bislang
allerdings recht wenig zu spüren. Bei einer
Veranstaltung des BBV-Bildungswerkes in Himmelkron
hat mit Marlene Mortler aus Lauf an der Pegnitz eine
CSU-Politikerin, die gar nicht mehr zur Wahl steht,
über die Landwirtschaft aus europäischer Sicht
gesprochen. Dabei wurde auch klar: die Europaskepsis
ist groß.
Brüssel steht überwiegend negativ da, sagte beispielsweise Hans Engelbrecht, langjähriger Landwirtschaftsfunktionär aus Weidenberg. Immer neue Gesetze und Verordnungen schränkten nicht nur die Bauern ein. Die verantwortlichen Politiker sollten endlich die Zeichen der Zeit erkennen. Hans Engelbrecht wurde noch deutlicher: „Die verfehlte Agrarpolitik geht von Brüssel aus und wird in Deutschland vollzogen.“ Ähnlich argumentierte ein anderer Redner: „Handwerker und Bauern sind das Herzstück der Gesellschaft.“ Doch die Politik möchte dies alles ganz offensichtlich kaputt machen.
Marlene Mortler, ehemalige Nürnberger Kreis-, mittelfränkischen Bezirks- und stellvertretende bayerische Landesbäuerin sowie langjährige Bundestagsabgeordnete und zuletzt sechs Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments widersprach den Kritikern energisch. Viele Menschen seien skeptisch, sie seien aber nicht in der Mehrheit. „Die Leute wissen sehr wohl, was sie an Europa haben.“ Doch auch Marlene Mortler fand kritische Worte. Auch in Brüssel hätten sich mittlerweile Leute breit gemacht, die eine „linke Denkschule“ haben und die nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft verankert sind.
So werde es immer schwieriger, Mehrheiten für den normalen Menschenverstand zu finden. Dabei habe man in Europa die sichersten Lebensmittel in bester Qualität. Wenn dies Aktivisten immer wieder in Frage stellen, dann sei das jedes Mal ein neuer Schlag gegen die Bauern. Als Beispiel nannte Marlene Mortler das Pflanzenschutzgesetz, bei dem regelmäßig alle Landwirte unter Generalverdacht gestellt werden. Als weiteres Beispiel nannte sie die Erneuerbare Energien-Richtlinie, nach der Holz keine erneuerbare Energie mehr gewesen wäre. Keine Fraktion habe sich bemüht, Änderungen herbeizuführen, lediglich die Europäische Volkspartei habe derartige Vorhaben immer wieder vom Kopf auf die Füße gestellt.
Die
Sicherstellung der eigenen Ernährung und der eigenen
Energieversorgung, das seien die zentralen Themen
des nächsten europäischen Parlaments, so die
Politikerin. Marlene Mortler sagte aber auch: „Und
bitte keine Hitparade der Nebensächlichkeiten wie
Mohrenapotheken, Gendersternchen oder
Zigeunerschnitzel.“ So würde die Politik nicht mehr
ernst genommen.
Auch gegen das geplante Verbrennerverbot machte sich Marlene Mortler stark. „Wir brauchen Technologieoffenheit“, sagte sie. Pflanzenöle hätten schon einmal hervorragend funktioniert. 2025 soll nun ein neuer Versuch unternommen werden, die Entscheidung des Verbrennerverbots ab 2035 zu korrigieren. Ähnlich könnte es mit den geplanten Flächenstilllegungen gehen. Zumindest bis zum Jahr 2027 sei dieses Vorhaben erst einmal vom Tisch, wobei die Bauerndemos zu Beginn des laufenden Jahres einen großen Beitrag dazu geleistet hätten. „Ohne diesen Druck wäre da nicht gelaufen“, so Marlene Mortler.
„Wo geht die Landwirtschaft hin“, lautete das eigentliche Thema des Abends. Manchmal aber habe man den Eindruck, mit der Landwirtschaft gehe es dahin, hatte der stellvertretende Kreisobmann Harald Unger zuvor festgestellt. Egal ob GAP-Reform oder Düngeverordnung: vieles sei schief gelaufen in den zurückliegenden Jahren. Und immer wieder kämen neue Bürokratiemonster auf die Bauern zu.
Bild:
1. „Keine
Hitparade der Nebensächlichkeiten“: die
CSU-Politikerin und langjährige Verbandsfunktionärin
Marlene Mortler tritt bei der kommenden Europawahl
nicht mehr an.
2. Die
Bamberger CSU-Europakandidatin Annamarie Bauer, der
stellvertretende Kulmbacher Kreisobmann Harald
Unger, Marlene Mortler und die Kulmbacher
Kreisbäuerin Beate Opel bei einer Veranstaltung des
BBV-Bildungswerks zur Europäischen Agrarpolitik in
Himmelkron.
„Das Menschliche muss passen“ / Klaus Wiedemann aus dem Fichtelgebirge gehört zu den Top-Ausbildern der Region
Wintersreuth.
„Das haben wir schon immer so gemacht.“ Diesen Satz
wird man bei Klaus Wiedemann nicht hören. 25 oder 26
Lehrlinge hat er in den zurückliegenden 20 Jahren
schon ausgebildet. So genau weiß er das gar nicht.
Ist ja eigentlich auch egal, denn Klaus Wiedemann
gehört eher zu den Bescheidenen, zu denen, die nicht
unbedingt in der ersten Reihe stehen wollen. Ihm
geht es um die Sache. Das sieht man schon daran,
dass er schon lange kein berufsständisches Amt mehr
bekleidet. Ihm geht es um die Ausbildung, deshalb
ist er aktuell auch Vorsitzender im
Prüfungsausschuss. Und in der Kommission für den
Staatsehrenpreis. Das war es dann aber auch schon.
Genug
zu tun hat Klaus Wiedemann. Zusammen mit dem
festangestellten Mitarbeiter Christian Stöhr, einem
seiner ehemaligen Lehrlinge, seiner Auszubildenden
Susanne Benker und aktuell einer Betriebshelferin
bewirtschaftet er mitten im Fichtelgebirge nahe der
Festspielstadt Wunsiedel einen Milchviehbetrieb mit
130 Kühen. Auf den Flächen rund um den Hof baut er
fast ausschließlich Kleegras, Lucerne, Mais und ein
wenig Weizen, alles für den Eigenbedarf an. „Wir
sind ein reiner Futterbaubetrieb“, sagt er. Den
großzügigen Stall am Ortsrand hat er im Jahr 2010
errichtet. Seit sieben Jahren gehört er dem
Bioland-Anbauverband an.
„Ich
war schon immer offen für Neues“, sagt der
55-Jährige. Der Stallbau gehörte damals dazu, die
Umstellung auf die biologische Wirtschaftsweise,
aber vor allem auch die regen
Ausbildungsaktivitäten. Schon mit 22 hatte Klaus
Wiedemann den Meister gemacht und den Hof von seinen
Eltern übernommen.
Eine Art Schlüsselerlebnis sei für ihn der Austausch mit Praktikanten aus Osteuropa und aus Russland gewesen, den das Landwirtschaftsamt damals angeboten hatte. Er selbst sei zwar nicht groß weg gewesen, doch die angehenden Landwirte aus den fremden Ländern hätten bei ihm auf dem Hof mitgearbeitet. Als er dann den Meister in der Tasche hatte, legte er so nach und nach los mit der Ausbildung junger Leute.
Warum
er das macht, das ist gar nicht so einfach zu
erklären. Eigentlich sei er es sebst, der dabei am
meisten lernt: andere Menschen kennen, andere
Arbeitsweisen, Dinge zu hinterfragen. Wichtig ist
für ihn dabei, dass die jungen Leute selbstständig
arbeiten, selbstständig denken und selbst auch mal
kritisch sind. „Die sollen keine Revolution
veranstalten, sondern aus ihrer eigenen Perspektive
Dinge beurteilen.“ Dabei weiß er ganz genau, dass
man den Lehrlingen nichts vorspielen kann, was man
nicht selber lebt. Da ist das eine oder andere Mal
auch Selbstkritik gefragt. Eines ist dabei ganz
wichtig: „Das Menschliche muss passen.“
Bei
Susanne Benker passt alles. Die 20-Jährige kommt aus
dem 30 Kilometer entfernten Rehau, wo ihre Eltern
ebenfalls im Nebenerwerb einen Milchviehbetrieb
bewirtschaften. Nach ihrem Realschulabschluss
startete sie mit dem Berufsgrundschuljahr, leistete
zwei Fachpraktika ab und startete gleich bei Klaus
Wiedemann. Weil der elterliche Betrieb ebenfalls zum
Bioland-Anbauverband gehört, war der Kontakt
entstanden. Eigentlich sei es schon von Anfang an
klar gewesen, dass es eine landwirtschaftliche
Ausbildung wird, sagt Susanne Benker. Der ältere
Bruder ist Kfz-Mechatroniker, die jüngere Schwester
geht noch zur Schule.
„Die
Stimmung passt, das Arbeiten hier ist verdammt
cool“, zeigt sich Susanne Benker selbstbewusst.
Derzeit fährt sie jeden Abend nach Hause, zeitweise
hat sie aber auch schon auf dem Ausbildungsbetrieb
übernachtet. Ein eigenes Zimmer steht zur Verfügung.
„Eigentlich ist es wie zuhause“, sagt sie und lässt
nichts auf ihren Ausbilder kommen. Was nach der
Lehre kommt, da ist sie sich noch nicht so ganz
sicher. Die Übernahme des elterlichen Hofes
vielleicht und vorher die Meisterschule.
„Wahrscheinlich werde ich es schon versuchen“, lässt
sie ihren künftigen Weg noch etwas offen..
Bestimmt
wird das auch klappen, denn Klaus Wiedemann nimmt
sich Zeit für seine Lehrlinge und er lässt sie auch
machen: „Bei mir gibt es das nicht, dass ich den
Schlepper fahre und der Lehrling sitzt nur daneben.“
Natürlich muss der Auszubildende auch mit Interesse
dabei sein. Auf diese Weise hat es bei Klaus
Wiedemann fast immer geklappt. Zu vielen seiner
Azubis hat er noch heute prima Kontakte. Einige
erledigen Lohnarbeiten für ihn, mit anderen arbeitet
er auch vielfältige Art und Weise zusammen. Seine
weiblichen Lehrlinge sind auch der beste Beweis
dafür, dass Landwirtschaft alles andere als
Männersache ist. „Die Mädels machen ihre Arbeit“,
sagt er anerkennend. Einmal hatte er sogar eine
Auszubildende, die zuvor ein Studium der
Umwelttechnik abgeschlossen hatte. Ein anderes Mal
waren es (nacheinander) Bruder und Schwester, die
beide aus einem außerlandwirtschaftlichen Bereich
kamen.
Wenn
bei Klaus Wiedemann alles so gut funktioniert, dann
liegt das auch an seiner Persönlichkeit. „Ich kann
absolut ruhig bleiben, wenn wirklich mal etwas
passiert“, sagt er und man nimmt es ihm ab, dass er
die Dinge absolut gelassen sieht. Wirklich laut
werden, das kann man sich bei ihm beim besten Willen
nicht vorstellen. Selbst wenn das passiert, was er
absolut nicht leiden kann: Dass der Lehrling zu spät
kommt.
Tipps von Klaus Wiedemann für eine gelingende Ausbildung (für den Ausbilder):
- Es muss menschlich passen.
- Ruhe bewahren und Dinge zulassen.
- Sich selbst zurücknehmen und sich selbst nicht so wichtig nehmen.
- Geben, nicht immer nur nehmen, und Selbstbewusstsein vermitteln.
- Darauf achten, wo die Stärken des Lehrlings sind.
Tipps für eine gelingende Ausbildung (für den Auszubildenden):
- Betriebe vorher genau ansehen und herausfinden, wo die Schwerpunkte liegen.
- Vorher verschiedene Betriebe besichtigen und mit den Betriebsleitern sprechen.
- Überlegen, wo die eigenen Ziele sind und wo man hin möchte.
- Nicht unter Wert verkaufen.
- Mit Selbstbewusstsein in die Ausbildung starten.
Sohn Marco, Klaus Wiedemann, Auszubildende Susanne Benker, Mitarbeiter Christian Stöhr, Tochter Sonja und deren Freund Noah (von rechts).
Historische Holzmenge vermarktet / Kritik an Forstpolitik der Ampel: Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei den Bayreuther Waldbauern
Bayreuth.
Über 115.000 Festmeter Holz hat die
Waldbesitzervereinigung Bayreuth im zurückliegenden
Jahr im Auftrag ihrer Mitglieder vermarktet.
Vorsitzender Hans Schirmer und Geschäftsführer
Gerhard Potzel sprachen bei der Jahresversammlung in
der Halle des oberfränkischen Rinderzuchtverbandes
in Bayreuth von einer historischen Menge. Die Zahl
bedeutet gegenüber dem Vorjahr die doppelte Menge,
gegenüber dem Jahr 2020 sogar die vierfache Menge.
Gerhard Potzel hatte noch einen anderen Vergleich: 115.000 Festmeter bedeute auch die unvorstellbare Zahl von exakt 4456 vollbeladenen Lkw oder anders ausgedrückt, 17 Lkw pro Tag. „Diese Menge kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen“, sagte der Geschäftsführer.
Nun hat die Rekordmenge natürlich auch ihre Ursache, und die ist für die Waldbesitzer weniger erfreulich. Es war der Borkenkäfer, der ganze Wälder zerstört hat. Über 100.000 Festmeter der gesamten vermarkteten Menge seien Schadholz, sagte der Vorsitzende Hans Schirmer. Die Aufarbeitung laufe noch immer auf Hochtouren. Allein die WBV Bayreuth habe aktuell fünf Harvester im Einsatz. „Das Käferholz muss raus aus dem Wald“, so der Vorsitzende. Er ging davon aus, dass sich die Misere auch im laufenden Jahr fortsetzt.
Diese
Auffassung vertrat auch Hubert Aiwanger. Der
bayerische Wirtschaftsminister war der prominenteste
Gast der Jahresversammlung. Er hatte sich zuvor im
Wald bei Gefrees ein Bild von der katastrophalen
Käfersituation gemacht. Aiwanger ging davon aus,
dass die Situation im laufenden Jahr noch
dramatischer werde als in den Vorjahren: „Wir werden
heuer eher vier Käferjahrgänge haben“. Zuletzt seien
es nur drei gewesen. Er appellierte deshalb an alle
Waldbesitzer, dem Käfer mit vorausschauender
Waldnutzung zuvorzukommen. „Nutzwald gehört
rechtzeitig geerntet“, sagte er.
Überhaupt sei der wirtschaftlich stabile Wald auch der gesündeste Wald, im Gegensatz zum stillgelegten Borkenkäferwald. „Nutzung ist noch immer der beste Schutz“, sagte Hubert Aiwanger und ging mit der Forstpolitik der Bundesregierung hart ins Gericht. Das geplante Bundeswaldgesetz nannte er „hirnrissig“. Man könne nur hoffen, dass die dafür Verantwortlichen noch vor der Umsetzung abgewählt werden.
Nach wie vor werde Biomasse politisch diskriminiert, statt unterstützt. Auch von der EU, die den Waldbesitzer verpflichten möchte, jeden einzelnen verkauften Baum in einer Datei nach Brüssel zu melden. Dabei gab der Minister auch zu bedenken, dass 1 Ster Holz 120 Liter Heizöl ersetzt und, dass in einem Kubikmeter Holz eine Tonne Kohlendioxid gespeichert sei.
Nach
den Worten von Geschäftsführer Gerhard Potzel hat
die Waldbesitzervereinigung Bayreuth aktuell 1844
Mitglieder, 94 mehr als noch vor einem Jahr. Sie
bewirtschaften zusammen eine Waldfläche von
stattlichen 9710 Hektar. Unter den Mitgliedern sind
auch 19 Körperschaften und Stiftungen.
Von der vermarkteten Holzmenge der Mitglieder waren über 103.000 Festmeter Fichten, gut 6.000 Festmeter Kiefern und nur 107 Festmeter Laubholz. Trotzdem zeige die Sammelbestellung bei den Pflanzen, dass der Waldumbau auch in der Region im Gang sei. Von den über 53.000 bestellten Pflanzen seien knapp drei Viertel Laubhölzer gewesen.
Bilder:
1. Hemdsärmelig
und leutselig war der bayerische Wirtschaftsminister
Hubert Aiwanger bei der Jahresversammlung der
Waldbauern in der Halle des oberfränkischen
Rinderzuchtverbandes aufgetreten.
2. Einen
Geschenkkorb gab es für Wirtschaftsminister Hubert
Aiwanger aus den Händen von Geschäftsführer Gerhard
Potzel (links) und dem Vorsitzenden Hans Schirmer.
3. Mit
Urkunden, Gutscheinen und Sachgeschenken wurden bei
der Versammlung zahlreiche langjährige Mitglieder
geehrt.
Von den Comedian Harmonists bis zu den Toten Hosen / Ländliche Kultur und traditionelles Liedgut: Treffen der oberfränkischen Landfrauenchöre
Landfrauenchor Bayreuth
Trogen. Rund 100 Sängerinnen, fünf Chöre und fast drei Stunden Musik: das oberfränkische Bezirkstreffen der Landfrauenchöre im Bürgersaal von Trogen war eine außergewöhnliche Veranstaltung. Nicht nur, dass der gesamte Sonntag im Zeichen der Landfrauen stand, schließlich gehörte zum Treffen der Chöre bereits ein festlicher Gottesdienst in der Markgrafenkirche mit Pfarrer Jochen Amarell. Zum Programm gehörte auch die gesamte Bandbreite der Chormusik von traditionellen Volksweisen bis hin zu Songs von Peter Maffay oder den Toten Hosen.
Landfrauen singen nicht nur bei Bauerntagen und in Konzerten, sondern auch in Altenheimen und Krankenhäusern, bei Maiandachten, Messen und bei vielen andere Gelegenheiten. „Die Landfrauen geben ihre Freude am Singen auch an Andere Menschen weiter“, sagte Bezirksbäuerin Beate Opel. „So pflegen und erhalten die Chöre die ländliche Kultur und das traditionelle Liedgut.“ Nachwuchs sei jederzeit willkommen, um mitzuerleben, wieviel Spaß und Freude das gemeinsame Singen, als Ausgleich zum Alltag bringt, warb die Bezirksbäuerin um die Chorarbeit der Landfrauen.
Für die außergewöhnliche Veranstaltung im Trogener Bürgersaal bedankten sich nicht nur Kreisbäuerin Elke Browa und Bürgermeister Sven Dittrich sondern auch der Hofer Landrat Oliver Bär. Jeder Landfrauenchor repräsentiere seine Region, sagte der Landrat. „Mit ihrem Gesang vermitteln sie den Menschen Freude an der Musik, an der Heimat, die Sängerinnen seien die besten Botschafter für das Land.“
In zwei Blöcken präsentierten die Landfrauenchöre jeweils zwei Lieder aus ihrem Repertoire. Den Anfang machte der Chor aus Hof unter der Leitung von Helmut Lottes. Mit dem Song „An Tagen wie diesen“ schlug der Zusammenschluss gleich zu Beginn ungewohnte Klänge an. Um so traditioneller dann der Auftritt des Lichtenfelser Chors in typischer Tracht unter der Leitung von Eva-Maria Schnapp und begleitet von Artur Häußinger am Akkordeon. Mit dem Titel „Berge der Heimat“ hatten die Lichtenfelser Landfrauen einen Titel des unvergessenen Rennsteig-Komponisten Herbert Roth im Programm.
Dritter im Bunde war der Landfrauenchor aus Bayreuth unter der Leitung von Roland Küffner, der die Damen auch auf dem Akkordeon begleitete. In traditioneller Bayreuther Tracht erinnerten die 18 Sängerinnen mit dem Schlager „Wochenend und Sonnenschein“ unter anderem an die legendären Comedian Harmonists. Mit dem Kulmbacher Landfrauenchor hatte erneut Helmut Lottes seinen Auftritt. Ihn hatten sich die Kulmbacher seit geraumer Zeit von Hof ausgeliehen und auch wenn der Chor aus der Bierstadt zahlenmäßig der kleinste war, so hatte er doch unter anderem mit dem Carpenter-Song „Top oft the world“ eine anspruchsvolle Auswahl getroffen. Fünfter und letzter Chor war der aus Coburg unter der Leitung von Brigitte Buron. Der Chor wurde vor 35 Jahren gegründet und noch immer singen vier Gründungsmitglieder mit, unter anderem die Ehrenkreisbäuerin und ehemalige Bezirksbäuerin Hilde Scheler.
Bayernweit gibt es aktuell 58 Landfrauenchöre mit rund 1500 Sängerinnen. Der erste Landfrauenchor wurde 1972 in Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gegründet.
Landfrauenchor Coburg
Landfrauenchor Lichtenfels
Landfrauenchor Kulmbach
Landfrauenchor Hof
Beste Landwirtschaftsmeisterin kommt aus Kulmbach – Melissa Gräf aus Wickenreuth wurde für ihre Bestleistung mit dem Meisterpreis der bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet
Kulmbach.
19 frischgebackene Landwirtschaftsmeister aus ganz
Oberfranken hat die Bezirksregierung vor kurzem
verabschiedet. Die Jahrgangsbeste Melissa Gräf kam
dabei aus Kulmbach, genauer gesagt aus dem Ortsteil
Wickenreuth. Hier packt die 27-Jährige auf dem
elterlichen Betrieb derzeit kräftig mit an, sonst
ist sie im Landwirtschaftsamt tätig und berät
Berufskollegen etwa beim Ausfüllen des
Mehrfachantrags.
„Es hat mich schon gepackt“, sagt Melissa Gräf. Offen räumt sie ein, ehrgeizig und auch sehr zielstrebig gewesen zu sein. Anders wäre es wohl auch nicht möglich gewesen, Jahrgangsbeste mit einer Eins vor dem Komma zu werden. Melissa Gräf sagt aber auch, dass ihr die gesamte Ausbildung viel Freude und Spaß gemacht habe. Geholfen hat ihr dabei sicher auch die Kombination ihrer Tätigkeit im Amt und auf dem elterlichen Betrieb. „Durch den Kontakt mit den Berufskollegen bekommt man halt einfach mehr mit“, sagt sie.
Der Betrieb in Wickenreuth hat zwei Schwerpunkte: die Zuchtsauenhaltung und eine Biogasanlage. Die Familie bewirtschaftet rund 75 Hektar Ackerland und etwa 45 Hektar Grünfläche, alles im Umkreis von wenigen Kilometern. Das angebaute Getreide wird nahezu komplett an die Schweine verfüttert.
Die Biogasanlage wurde 2010 realisiert, als die Familie die Rinderhaltung aufgegeben hatte und auf der Suche nach einer Alternative war. Das Problem der Gülleausbringung habe ihn schon länger beschäftigt, sagt Melissas Vater Armin Gräf. Aufgrund der Nähe zur Stadt und insbesondere zur Siedlung habe man sich entschieden, die Anlage zu errichten. Mit der Wärme wird das gesamte Anwesen, also das Wohnhaus der Familie und der Zuchtsauenstall beheizt. „Das war die beste Entscheidung überhaupt“, ist sich Armin Gräf noch immer sicher.
Auch
Melissa Gräf hat eine gute Entscheidung getroffen,
als ihr klar wurde, dass der ganze Tag im Büro nicht
so ihr Ding sei. Nach dem Abschluss an der
Realschule hatte sie beim Lebensmittelproduzenten
Ireks in Kulmbach zunächst den Beruf der
Industriekauffrau erlernt. 2016, nach dem Abschluss
der Lehrzeit, habe sie ihre Zukunft allerdings
woanders gesehen. Schließlich wollte sie mit 13
schon den Führerschein für den Schlepper machen, was
freilich erst mit 16 möglich war.
Was lag also näher, als eine Landwirtschaftsausbildung zu starten. Aufgrund einer bereits erfolgreich absolvierten Ausbildung in einem anderen Beruf konnte die Lehrzeit auf zwei Jahre verkürzt werden. Das praktische Jahr absolvierte sie zuhause, dann legte sie eine kurze Pause ein, ehe sie 2021 die dreisemestrige Ausbildung zur staatlich geprüften Wirtschafterin für Landbau und schließlich ihre Meisterarbeit zum Thema „Anbau von Silomais im gelben Gebiet“ obendrauf setzte.
Wie es für Melissa Gräf so ganz genau weitergeht, das steht noch nicht fest. In den kommenden Monaten ist sie erst einmal weiter halbtags im Amt für Landwirtschaft als Beraterin tätig. Die restliche zeit arbeitet sie auf dem Hof der Eltern mit. „Ich genieße das erst einmal“, sagt sie Da der Bruder im außerlandwirtschaftlichen Bereich tätig ist, käme sie als potenzielle Hofnachfolgerin in Frage. Doch ernsthafte Gedanken macht sich darüber noch niemand.
Wenn sie sich tatsächlich einmal nicht mit der Landwirtschaft beschäftigt, dann hat Melissa Gräf bei der Kulmbacher Showtanzgarde einen idealen Ausgleich gefunden. Sie habe schon von Kind auf gerne getanzt, sagt sie. Ihre Mutter Sabine gehörte sogar zu den Gründerinnen des sportlichen Zusammenschlusses.
Bilder:
1. Keine Angst vor
schwerem Gerät: Melissa Gräf ist die beste
Landwirtschaftsmeisterin des aktuellen Jahrgangs.
2. Armin, Melissa und
Sabine Gräf auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in
dem zur Stadt Kulmbach gehörenden Ortsteil
Wickenreuth.
Landfrauen machen Mode / Bauernverband lädt am 24. April ins Modehaus ein
Naila.
„In der Mode zeigt man sein Ich“, sagt Silke
Spitzner, Chefin des Modehauses Pöpperl in Naila.
Das wollen sich künftig auch die Hofer Landfrauen zu
Herzen nehmen. Unter dem Motto „Modisches und
sicheres Auftreten“ veranstaltet der Bauernverband
deshalb am 24. April um 19.30 Uhr einen ganzen Abend
im Modehaus, bei dem es um individuelle und
typgerechte Kleidung, um Farben, Formen und Schnitte
sowie um die richtige Auswahl alltagstauglicher und
angesagter Mode gehen soll.
„Die Nachfrage ist groß“, sagt Christina Thieroff, Ortsbäuerin von Naila. Zusammen mit Kreisbäuerin Elke Browa aus Hirschberglein hat sie den Abend in die Wege geleitet. „Auch Landfrauen können sich stylisch und modisch anziehen“, sagt Christina Thieroff. Das soll an diesem Abend unter Beweis gestellt werden. Und irgendwie geht es auch darum, mit einem Klischee aufzuräumen, denn auch Bäuerinnen können chic sein und mit der Mode gehen.
Silke Spitzner will den Landfrauen dabei beratend zur Seite stehen. Sie ist die Fachfrau, wenn es um Mode geht. Schließlich gilt ihr Modehaus schon seit über 75 Jahren als eine der ersten Adressen in der Region. Es soll kein langweiliger Vortrag oder eine öde Schulungsveranstaltung werden. Vielmehr wird Silke Spitzner mit ihrem Team individuell auf alle Teilnehmerinnen eingehen und ihnen vermitteln, wie sie sich möglichst vorteilhaft präsentieren können.
Wobei das mit en Teilnehmerinnen nicht so ganz stimmt. „Es haben sich sogar schon einige Männer angemeldet“, verrät Christina Thieroff. Für Silke Spitzner kein Problem, sie und ihr Haus ist vorbereitet. „Männer seien durchaus willkommen, denn sie lockern die Runde erfahrungsgemäß auf.“ Auch altersmäßig gebe es keinerlei Grenzen, vom Teenager bis zur Oma ist Mode stets ein Thema und an diesem Abend seien alle willkommen.
„Wir wollen einfach mal ein neuartiges Veranstaltungsformat ausprobieren“, so die Ortsbäuerin. Auch wenn das Thema Jeans im Vordergrund stehen soll, so wird es insgesamt um sportliche und alltaugliche Kleidung gehen, denn Kleidung habe stets auch mit Selbstbewusstsein und einem gewissen Wohlgefühl zu tun.
Das Modehaus Pöpperl gibt es bereits seit 1947. Damen-, Herren- und Kinderabteilung erstrecken sich auf circa 1300 Quadratmetern über fünf Stockwerke. Das Unternehmen hat rund 20 Beschäftigte und ist dabei auch ein wichtiger Arbeitgeber für Naila und die Umgebung.
Wer dabei sein will, sollte sich beeilen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und die Nachfrage ist groß. Anmeldungen sind noch bis zum 10. April in der Geschäftsstelle des Bauernverbandes in Münchberg, Telefon 09251/438920 möglich. Es wird ein symbolischer Unkostenbeitrag von drei Euro erhoben. Der Abend findet am 24. April um 19.30 Uhr im Modehaus Pöpperl, Hauptstraße 1-5 in 95119 Naila statt.
Bild: Die Nailaer Ortsbäuerin Christina Thieroff (links) und Silke Spitzner, Chefin des Modehauses Pöpperl, bereiten sich auf den Abend mit dem Bauernverband am 24. April vor.
Anschlussboom bei Photovoltaik / Bayreuther Bauerntag: Energiewende nimmt an Fahrt auf
Bayreuth.
Die Energiewende ist in Bayern auf einem guten Weg.
Den Anteil regenerativer Energien m Netz des
Betreibers Bayernwerk bezifferte Markus Seidel,
Leiter des für Bayreuth zuständigen Kundencenters
Kulmbach, auf 70 Prozent. „Damit geht die
Energiewende in eine neue Phase und nimmt immer mehr
an Fahrt auf“, sagte Markus Seidel beim Bauerntag in
Bayreuth.
War die Landwirtschaft bisher ausschließlich für die Ernährungsproduktion zuständig, hat sie sich im Laufe der zurückliegenden Jahrzehnte mehr und mehr auch zum Energieproduzenten entwickelt, sagte BBV-Kreisobmann Karl Lappe. Er sprach auch von einer Zeitenwende, weil Energie nicht mehr nur an großen Kraftwerksstandorten produziert wird, sondern in der Fläche. Dies stelle die Netzbetreiber vor große Herausforderungen, was innerhalb des Berufsstandes und in den Kommunen für große Diskussionen sorge. Da gebe es Streit um Windkraftstandorte und ein regelrechtes Pokerspiel um die Flächen. Trotzdem sah auch Karl Lappe die Energiewende auf einem guten Weg, was nicht zuletzt an der großen Investitionsbereitschaft abzulesen sei.
Bereits im Jahr 2040 soll in Bayern die Klimaneutralität erreicht sein, die Weichen dafür seien gestellt, sagte Markus Seidel. Er rechnete vor, dass in seinem Zuständigkeitsbereich im zurückliegenden Jahr rund 82000 Photovoltaikanlagen ans Netz gegangen seien, satte 120 Prozent mehr als im Vorjahr. Dies habe unter anderem den Ersatzbau von über 1000 Kilometer und den Neubau von 860 Kilometer Leitungen erfordert. „Der Anschlussboom setzt sich weiter fort“, sagte Markus Seidel. Mit derartigen Maßnahmen sei das Bayernwerk unter anderem darauf vorbereitet, dass im Jahr 2040 vier von fünf Haushalte ein Elektrofahrzeug besitzen werden.
Das
Kulmbacher Kundencenter des Bayernwerks ist für die
Landkreise Bayreuth, Kulmbach und Lichtenfels, sowie
für angrenzende Teilbereiche in den Landkreisen
Nürnberger Land, Tirschenreuth und Wunsiedel
zuständig. Im Freistaat beschäftigt das Bayernwerk
3400 Mitarbeiter und versorgt rund 1200 Kommunen.
Allein 800 davon sind Servicetechniker, die täglich
für ein störungsfreies Netz sorgen. Im Bereich des
Kulmbacher Kundencenters sind es aktuell 83
Mitarbeiter. Das Bayernwerk ist für Mittel- und
Niederspannungsnetze zuständig, das
Höchstspannungsnetz veratwortet der in Bayreuth
ansässigen Übertragungsnetzbetreiber Tennet.
Auf die aktuellen Sorgen und Nöte der Landwirte ging Landrat Florian Wiedemann ein. Kinder und Jugendliche würden heute in der Regel fernab von der Landwirtschaft aufwachsen und deshalb keinerlei Bezug mehr dazu haben. Er appellierter deshalb an die Bauern, ihre Arbeit immer wieder nach außen zu tragen und zu zeigen, was Tag für Tag geleistet wird. Was das Energiethema betrifft, ging Wiedemann auch auf die Beiträge des Landkreises zur Energiewende ein. Zug um Zug sollen sämtliche kommunalen Gebäude mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Die Kreisbauhöfe in Weidenberg und Hollfeld gehörten dazu, genauso wie die Jugendstätte Heidenaab. Bei Neubauten gehöre die Photovoltaikanlage immer gleich dazu, wobei der erzeugte Strom in erster Linie für den Eigenverbrauch genutzt werden soll.
Photovoltaik auf Freiflächen bezeichnete der Landrat dagegen als „Fluch und Segen zugleich“. Zwar könnten sie entscheidend zum Gelingen der Energiewende beitragen, doch würden sie auch die Pachtpreise in die Höhe treiben. Er habe deshalb die Linie vorgegeben, erst einmal die Dächer auszurüsten und nicht überall alles zuzupflastern.
Bilder:
1.
Volkslieder aus der Region hatte der Bayreuther
Landfrauenchor eigens für den Bauerntag in der
Tierzuchtklause einstudiert.
2. BBV-Geschäftsführer
Harald Köppel (links), Kreisbäuerin Angelika
Seyferth und Kreisobmann Karl Lappe bedankten sich
bei Markus Seidel vom Bayernwerk für seinen Beitrag
beim Bayreuther Bauerntag.
Walnuss und Esskastanien statt Fichte und Buche / Borkenkäfer: WBV Kulmbach/Stadtsteinach musste Rekordmenge an Holz vermarkten
Stadtsteinach. Ausnahmezustand bei der Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach. Die mit 2055 Mitgliedern größte WBV in Oberfranken hat im zurückliegenden Jahr rund 250.000 Festmeter Holz vermarktet. Das sind etwa 100.000 Festmeter mehr als noch im Jahr zuvor. „Und das bei einem geschrumpften Personalstand“, wie die Vorsitzende Carmen Hombach anmerkte. „So ein Jahr haben wir noch nicht erlebt“, sagte sie bei der Jahresversammlung in Stadtsteinach. Schuld daran ist der Borkenkäfer, der aktuell schon wieder in den Startlöchern sitzt.
Geschäftsführer Theo Kaiser rechnet mit knapp 2000 Holzabrechnungen für die Mitglieder. Fast die Hälfte davon ist noch offen, was der schlechten Personalsituation geschuldet sei. Sie sollen in den kommenden Wochen aber zügig erstellt werden, zumal eine neue Teilzeitkraft für die Holzaufnahme bereits gefunden werden konnte. „Wir suchen dringend Personal“, so Carmen Hombach. Leider sei der Forstarbeitsmarkt derzeit komplett leergefegt.
Geschäftsführer Theo Kaiser rechnet aber auch damit, dass es in zwei, drei Jahren mit den Riesenumsätzen wieder vorbei sein wird. Bis dorthin gilt es, alle Kraft auf die Bekämpfung des Borkenkäfers zu richten. „Bitte kontrollieren sie ihre Bestände“, rief Carmen Hombach die Waldbauern auf. Sie befürchtete für das laufende Jahr das gleiche Chaos, wie 2023. „Ich glaube, da kommt noch was Großes auf uns zu.“ Deshalb sollten alles Strategien eingesetzt werden, um weitere Kahlflächen zu vermeiden.
Auch Geschäftsführer Theo Kaiser richtete den dringenden Appell an alle Waldbauern, die Bestände zu kontrollieren sowie Windwurf und Schneebruch aufzuarbeiten. Das Einzige, was immer hilft, sei die Polterspritzung, also die Bearbeitung von liegend gerücktem Holz mit entsprechenden Insektiziden. Dem Geschäftsführer zufolge waren von der Gesamtmenge des vermarkteten Holzes im zurückliegenden Jahr rund 85 Prozent Käferholz. Geht es so weiter, dann wird spätestens in zwei bis drei Jahren die Fichte im Kulmbacher Oberland komplett weg sein.
Insgesamt hätten sich Theo Kaiser zufolge die Preise für Fichten- und auch für Kieferholz trotz der Misere wieder einigermaßen erholt. Wenig Nachfrage stelle die WBV aktuell für Industrie- und Brennholz fest. Praktisch gar nicht mehr zu vermarkten sei Papierholz, während der Markt für Hackschnitzel bestens laufe. Um die Holzmenge auch einigermaßen bewältigen zu können, konnte die WBV im zurückliegenden Jahr zwei neue Lagerplätze anlegen, in Kunreuth und in Gössenreuth.
Alternative Baumarten „für den neuen Wald“ stellte Gregor Aas, der frühere Leiter des Ökologisch-Botanischen Gartens der Universität Bayreuth den Waldbauern vor. Das können bewährte heimische Arten sein, aber auch neue Baumarten, die bislang in den hiesigen Breiten noch nicht heimisch sind. Am besten sei eine gesunde Mischung aus beiden, sagte Gregor Aas: „Vielfalt ist die beste Absicherung für künftige Risiken.“
Als Beispiele für solche neuen Baumarten nannte er unter anderem die Esskastanie, die Zerr-Eiche, die Hemlock-Tanne, den Walnuss-Baum, die Robinie oder die Libanon-Zeder. „Das alles seien ernstzunehmende Alternativen“, sagte der Experte. Eines ist sicher: die Fichte werde im Jahr 2100 keinerlei Bedeutung mehr haben, aber auch der Hoffnungsträger Douglasie und selbst die Buche nicht.
Gregor Aas gab aber auch zu bedenken, dass Waldumbau mehr sei als neue Pflanzungen. Auch die Pflege der Bestände und das Ausnutzen des Potenzials sowie eine angemessene Wildstandsregelungen gehörteb dazu und dabei müsse die Jagd mitspielen. Einzelschutzmaßnahmen würden dagegen über kurz oder lang nicht mehr praktikabel sein. Der Referent verschwieg dabei allerdings auch nicht, dass jede neue Baumart auch mit Risiken verbunden ist. Ob die Arten auch langfristig gedeihen, könne man nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Die Gefahr neuer Krankheiten sei auch nicht abzusehen. Die von Seiten des Naturschutzes immer wieder ins Spiel gebrachte geringe oder fehlende Bedeutung neuer Arten für Vögel, Insekten oder Pilze sei ebenfalls nicht von der Hand zu weisen.
Landwirtschaft lehnt „Tierwohl-Cent“ ab / Keine Verbrauchssteuer auf bestimmte tierische Produkte
Kulmbach. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat vor wenigen Tagen ein Eckpunktepapier für eine Verbrauchssteuer auf bestimmte tierische Produkte vorgelegt. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir spricht in diesem Zusammenhang von einem "Tierwohl-Cent", anderswo ist auch von einer „Fleischsteuer“ die Rede.
Die Einnahmen daraus sollen „für wichtige vornehmlich landwirtschafts- und ernährungspolitische Vorhaben“ genutzt werden, so heißt es. Der Bayerische Bauernverband (BBV) hat den aktuellen Vorschlag bereits als „Ablenkungsmanöver“ und „Nebelkerze“ abgelehnt. „Erst müssen Lösungen beim Agrardiesel her, die alle Bauernfamilien entlasten“, sagt Präsident Günther Felßner. Der Erhalt der Tierhaltung in Bayern und die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch, Milchprodukten oder Eiern habe höchste Priorität. Die bisherigen Gesetzesvorhaben der aktuellen Bundesregierung hätten aber nie auf ein Gesamtkonzept gesetzt, sondern seien stets lückenhaftes Stückwerk. Als Beispiele nannte er das praxisferne Tierhaltungskennzeichnungsgesetz und auch das völlig unzureichende Bundesförderprogramm für die Schweinehaltung.
Der „Tierwohl-Cent“ auf Fleisch und Fleischprodukte soll nach Ansicht des BBV-Präsidenten unter dem Deckmantel der Tierwohlförderung wohl vor allem dazu dienen, Haushaltslöcher zu stopfen. Von einem Gesamtkonzept für die Tierhaltung sei der Vorschlag weit entfernt. Stattdessen drohe eine bürokratieaufwendige Verbrauchssteuer. Und dabei bleibt völlig unklar, wie sichergestellt werden soll, dass das Geld bei den Bauern ankommt. Denn eine so genannte Zweckbindung sei rechtlich nicht möglich.
Deutliche Worte findet der Kulmbacher Kreisobmann im Bayerischen Bauernverband, Harald Peetz aus Himmelkron: „Von einer Tierwohlabgabe auf Fleisch und Wurst halte ich gar nichts, das ist der Versuch von den eigentlichen Problemen in der Ampel in Berlin abzulenken und die Verbraucher gegen die Landwirtschaft auszuspielen.“ Es sei ja noch nicht bekannt wie viele Prozent oder wie viele Euro aufgeschlagen werden sollen, aber es werde auf jeden Fall zu einer Verteuerung bei Fleischprodukten führen, egal welcher Art oder Herkunft.
„Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie eine nicht zweckgebundene Steuer dann in der Landwirtschaft zum Bau von neuen Ställen ankommen soll“, so Harald Peetz. In der Vergangenheit sei es immer so gewesen, dass bei einer Förderung für eine Maßnahme diese um die Förderhöhe teurer geworden ist und nach Auslaufen der Förderung so teuer geblieben ist. Es wäre viel Sinnvoller die Ansprüche und die Bürokratie beim Bauen zu vereinfachen, das würde nichts kosten, das Umsetzen einer Baumaßnahme beschleunigen und das Bauen bei gleichen Standards verbilligen und so schnell zu mehr Tierwohl führen.
„Aber das will man aus meiner Sicht mit dieser Abgabe gar nicht erreichen, man will wieder einmal den Verbraucher bevormunden und ihn in Richtung vegetarische Ernährung zwingen und das auf dem Rücken der Landwirtschaft“, sagt Harald Peetz. Nachdem der Versuch mit Verboten und Vorschriften den Verbraucher den Fleischkonsum zu vermiesen in den letzten Jahren fehlgeschlagen sei, versuche man es jetzt über die Hintertür die Tierwohlabgabe zu erreichen. „Es ist nichts anderes als wieder ein durch Ideologie getriebener Vorstoß ohne Sachverstand und Praxistauglichkeit.“ Zusammenfassend will die Politik mit dieser Abgabe aus Sicht des Kreisobmanns bewusst tierische Lebensmittel verteuern, den Verbraucher bevormunden, eine neue Einnahme für den Bundeshaushalt schaffen und tierhaltende Betriebe weiter diskriminieren und vom Markt drängen.
Auch Harald Köppel, der für Kulmbach zuständige BBV-Geschäftsführer, spricht von einem Ablenkungsmanöver, um Ruhe in die Diskussion zu bringen. Er gibt zu bedenken, dass beispielsweise ein Ackerbauer gar nichts davon hat und Fleisch für den Verbraucher wieder teurer wird. Einer Regierung, die eine pflanzenbasierende Ernährungsform favorisiert, komme dies natürlich gelegen, ihr Wählerklientel wäre davon überhaupt nicht betroffen. Der Tierwohl-Cent diene nach Ansicht des BBV-Geschäftsführers einzig und allein dazu, von Agrardiesel und ähnlichem abzulenken. „Das ist nicht unbedingt anständig und fair.“
Harald Köppel geht allerdings nicht davon aus, dass der Tierwohl-Cent kommt, nachdem die FDP bereits ihren Widerstand angekündigt hatte. Er gibt auch zu bedenken: „Die reden zwar von Cent, aber wahrscheinlich würden es deutlich mehr werden als nur ein oder zwei Cent.“ Angeblich sei bereits eine Höhe von 40 Cent in den Raum gestellt worden. Da werde es sich so manche Familie, die nicht im Geld schwimmt, überlegen müssen, ob es Schweine- oder Rindfleisch oder doch „nur“ eine Gemüsesuppe gibt.
Ähnlich argumentiert Landwirt Gerhard Reif aus Gößmannsreuth: „Ich halte nichts davon, weil das nur wieder Lebensmittel teurer macht“. Es gebe ja nicht nur Fleisch- und Milcherzeuger, sondern auch Getreide, Wein, Wald, Gemüse und vieles mehr. Er glaube auch nicht, dass das Geld beim Bauern ankommt. Sicher werde sich aber der Verbraucher auf höhere Preise einstellen müssen. „Das ist das Ziel, um das Verhältnis Landwirt-Verbraucher noch mehr zu spalten“, sagt Gerhard Reif. „Jetzt bekommen die Bauern noch mehr Geld“, heißt es dann fälschlicherweise. Und dann wird er deutlich: „Ich halte die Regierung für unfähig und finde deshalb, man sollte sparen und nicht ständig den Leuten mehr Geld abnehmen.“
Auch Michael Greim, Landwirt aus Marktschorgast, der unter anderem auf Mutterkuhhaltung mit Angus-Rindern setzt hält von der Tierwohlabgabe überhaupt nichts. „Wieder ein Büromonster“, schimpft er. „Wie soll das funktionieren?“, so Michael Greim weiter. Durch den ganzen Verwaltungsapparat, der hier wieder aufgebaut werde, komme beim Bauern nichts mehr an. Sollen die Bauern dann die nächste Subvention bekommen, die dann wieder gekürzt wird?“ Hier seien die Vermarkter und Metzger gefragt, damit Sie dem Bauern für besonders tiergerechte Haltung mehr bezahlen.
Waldbauern: Weiteres Käferjahr steht bevor / WBV Hollfeld: Erneut über 100.000 Festmeter Holz vermarktet
Hollfeld.
Im dritten Jahr in Folge hat die
Waldbesitzervereinigung Hollfeld mehr als 100.000
Festmeter Holz vermarktet. „Das ist nicht mehr
normal“, sagte der Vorsitzende Christian Dormann bei
der Jahresversammlung in der Stadthalle. Grund dafür
ist die Kalamitätssituation. „Der Käfer hat uns fest
im Griff“, sagte Dormann. Die Mitglieder der WBV
Hollfeld kommen aus den drei Landkreisen Bamberg,
Bayreuth und Kulmbach, die Geschäftsstelle ist in
Hollfeld.
Dort hat die WBV mitten in der Stadt, in der Forchheimer Straße 4 im zurückliegenden Jahr neue Räumlichkeiten bezogen. Das ursprüngliche Vorhaben eines Neubaus sei damit noch nicht vom Tisch. Mit den großzügigen Räumen in der Forchheimer Straßer habe man aber eine gute Interimslösung gefunden. Die bisherige Geschäftsstelle war aus allen Nähten geplatzt, so dass der Umzug dringend notwendig wurde. Die WBV Hollfeld hat aktuell 1.746 Mitglieder, 49 mehr als noch vor einem Jahr. Alle Mitglieder zusammen bewirtschaften eine Waldfläche von 13.174 Hektar.
Nach den Worten von Geschäftsführerin Stefanie Blumers wurden im zurückliegenden Jahr exakt 101.550 Festmeter Holz vermarktet, im Jahr zuvor waren es 104.481 Festmeter. „Die Regel ist eine solche Menge nicht“, sagte sie. 2021 seien es noch gut 80.000 Festmeter gewesen. Ursache für die riesige Menge ist natürlich der Käferholzeinschlag und da wird sich erst einmal auch nichts daran ändern. „Wir werden auf einem ähnlich hohen Niveau bleiben“, so Stefanie Blumers. Bis 2020 sei alles noch ganz normal gewesen, dann habe der Käfer zugeschlagen. Mit Sicherheit habe der Käfer im Boden überwintert, so dass auch das laufende Jahr wieder ein Käferjahr werden wird. Von den über 100.000 Festmetern Holz waren über 96.000 Festmeter Fichten, knapp 5.000 Festmeter Kiefern, der Rest Tannen, Lärchen und sonstige.
„Fordernde Jahre liegen hinter und fordernde Jahre werden vor uns liegen“, sagt Vorsitzender Christian Dormann. Und er gab zu bedenken: „Die Probleme des Waldes sind auch unsere Probleme.“ An die Waldbesitzer appellierte er: „Räumt euren Wald auf.“ Auch wenn dies stellenweise ein hoffnungsloses Unterfangen sei. „Nur wenn wir zusammenhalten, können wir dem Käfer Paroli bieten.
Um den Arbeitsaufwand bewältigen zu können, braucht die WBV nicht nur Platz, sondern auch Personal. Die Bearbeitung habe teilweise recht lange gedauert, doch nun sei Besserung in Sicht, so Stefanie Blumers. Forstwirt Christian Stier sei bereits seit September als Einsatzleiter hauptsächlich für den Bereich Hollfeld tätig, Försterin Rebekka Zeilmann als Einsatzleiterin im südlichen Teil der WBV. Dazu kommt seit Januar Forstwirtschaftsmeister Johannes Blechschmidt. Auch im Büro gibt es mit Katharina Schreiber seit Januar eine neue Kraft.
Auf großes Interesse war bei der Jahresversammlung der Auftritt von Wolfgang Kornder, dem Bundesvorsitzenden und langjährigen bayerischen Landesvorsitzenden des Ökologischen Jagdverbandes (ÖJV) gestoßen. Sein Fazit lautete: „Schalenwildbestände müssen im Focus der Jagd liegen, wenn die Waldverjüngung eine Chance haben soll.“ Maßstab für die Jagd müsse stets der Zustand des Waldes sein. Als Böswillige Unterstellung bezeichnete es Kornder, die Jagd als Schädlingsbekämpfung zu bezeichnen. Rehwild richte zwar Schäden an, „Wald vor Wild“ sei nicht gleichzusetzen mit „Wald ohne Wild“. Nur bei angepassten Wildbeständen gehe es dem Wald gut und er könne wachsen. Alarmierend sei nicht zuletzt auch die immens ansteigende Zahl an Wildunfällen. „Da gehe es ja schließlich auch um Menschenleben“, sagte Wolfgang Kornder.
Bild: Vorsitzender Christian Dormann (links) und sein Stellvertreter Matthias Weigand (rechts) bedankten sich bei Wolfgang Kornder vom Ökologischen Jagdverband.
Erdnüsse und Kichererbsen statt Braugerste und Weizen/ Regierung von Oberfranken verabschiedete 19 frischgebackene Meister der Landwirtschaft – Jahrgangsbeste kommt aus Kulmbach
Bayreuth: 19 junge Leute aus allen Teilen Oberfrankens haben ihre Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister erfolgreich bestanden. Aus den Händen von Regierungspräsident Florian Luderschmid erhielten die 15 Männer und vier Frauen ihre Zeugnisse. „Sie sind auf der höchsten Stufe der Fortbildung im praktischen Bereich angekommen“, sagte der Regierungspräsident. Alle 19 hätten ihren Traumberuf erreicht, sie müssten sich aber auch darüber im Klaren sein, dass sie vor einer Zukunft mit großen Herausforderungen stehen.
Die Absolventen seien mit dem Meisterbrief in der Tasche bestens gerüstet, den eigenen Betrieb zu bewirtschaften oder als Führungskräfte in vor- und nachgelagerten Bereichen tätig zu werden. Der Regierungspräsident appellierte an die frischgebackenen Meister, neben all den großen Herausforderungen wie Sicherung der Ernährungssouveränität, Versorgung mit regenerativer Energie, Ressourcen und Artenschutz immer auch den Dialog mit dem Verbraucher im Blick zu haben.
Die Meisterausbildung bezeichneter Finanz- und Heimatsstaatssekretär Martin Schöffel als die weltweit beste Ausbildung, wenn man einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten möchte. Schöffel gab auch zu bedenken, dass man die heimische Landwirttschaft zur eigenen Versorgung brauche. Auf Importe zu setzen, so wie sich das Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vorstellt, werde mit Sicherheit nicht funktionieren, denn niemand könne sagen, wo dann unsere Nahrung herkommen soll.
Nach einem Jahr praktischer Tätigkeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb besuchten die Absolventen für drei Semester die Landwirtschaftsschule. Anschließend bereiteten sie sich während eines weiteren Jahres mit berufsbegleitenden Lehrgängen auf die Abschlussprüfung zum Landwirtschaftsmeister vor. Inhalte der Meisterprüfung waren unter anderem der Vergleich und die Bewertung von Produktionsverfahren bei der pflanzlichen oder tierischen Erzeugung anhand eines zwölf Monate dauernden praktischen Arbeitsprojekts, die Analyse und Beurteilung eines fremden Betriebes sowie eine praktische Arbeitsunterweisung.
Festredner Stephan Sedlmayer von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft stellte einmal mehr den Klimawandel in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. „Die Veränderungen durch den Klimawandel werden uns alle treffen und wir alle werden uns damit auseinandersetzen müssen“, sagte er. Es gebe aber kein Problem, das nicht gelöst werden kann. Außerdem befinde sich Bayern in einer begünstigten Lage, so dass der Freistaat nicht in existentieller Art und Weise betroffen sein werde. „Andere Gegenden sind heftiger betroffen“, sagte Stephan Sedlmayer. Trotzdem empfahl er den jungen Meistern, auch einmal an den Anbau alternativer Fruchtarten zu denken. Ob es tatsächlich Kichererbsen, Trockenreis oder Erdnüsse sein werden, vermochte er nicht vorauszusagen. Über Körnerhirse, der fünftgrüßten Getreideart weltweit, könne man aber schon ernsthaft nachdenken.
Die folgenden frischgebackenen Landwirtschaftsmeister haben ihre Urkunden erhalten: Tabea Ritter und Moritz Starklauf aus Buttenheim im Landkreis Bamberg, Laurenz Albrecht aus Meeder, Georg Ehrsam aus Großheirath, Maximilian Platsch ais Itzgrund und Patrick Sämann aus Ahorn (alle Landkreis Coburg), Paul Schwarzmann aus Eggolsheim
im Landkreis Forchheim, Nicole Browa aus Geroldsgrün, Felix Leucht aus Naila, Max Schaller aus Feilitzsch (alle Landkreis Hof), Jonas Hofmann aus Weißenbrunn im Landkreis Kronach, Melissa Gräf aus Kulmbach und Dominik Pfändner aus Wonsees im Landkreis Kulmbach, Anna Pösch aus Lichtenfels, Hannes Schilling aus Bayreuth, Andreas Ritter aus Marktleuthen und Jakob Sroka aus Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel. Dazu kommen aus den beiden oberpfälzischen Nachbarandkreisen Neustadt an der Waldnaab und Amberg-Sulzbach Gabriel Speckner aus Vorbach und Simon Bauer aus Auerbach.
Jahrgangsbeste
ist Melissa Gräf aus Kulmbach mit einem
Notendurchschnitt von 1,29. Ihr überreichte Michael
Knarrer vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium
den Meisterpreis der Staatsregierung.
Regierungspräsident Florian Luderschmid überreichte
den Meisterbrief an Dominik Pfändner aus Wonsees.
Als einziger frischgebackener Landwirtschaftsmeister aus Bayreuth wurde Hannes Schilling vom oberfränkischen Regierungspräsidenten Florian Luderschmid ausgezeichnet.
Immer auf der Suche nach neuen Helfern / Maschinenring Bayreuth-Pegnitz: Trotz Personalmangel, Einsatzstunden auf nahezu gleichem Niveau
Bayreuth.
„Wir könnten mehr machen, wenn wir nur mehr Leute
hätten“: Der Helferengpass beherrscht derzeit
flächendeckend die Arbeit der Maschinen- und
Betriebshilfsringe. Beim MR Bayreuth-Pegnitz hat
sich die schwierige Personalsituation wie ein roter
Faden durch die Jahresversammlung gezogen. „Der
begrenzende Faktor ist nicht die Nachfrage, sondern
das Angebot“, sagte Geschäftsführer Johannes Scherm.
Zwei, die im zurückliegenden Jahr beste Werbung für die Betriebshilfe gemacht haben, sind Monika und Thomas Kaufenstein aus Stemmenreuth bei Pegnitz. Wie wurden im vergangenen Jahr mit dem Betriebshelfer-Award der deutschen Maschinenringe ausgezeichnet und gehören damit zu den besten Betriebshelfern Deutschlands. Das Ehepaar ist für den Maschinen- und Betriebshilfsring Bayreuth-Pegnitz tätig und bringt es zusammen auf fast 60 Jahre Tätigkeit für den Maschinenring. Im Juni wurden sie dafür auf der Bundesversammlung der 240 deutschen Maschinenringe in Köln ausgezeichnet.
Das Ehepaar bewirtschaftet in Stemmenreuth einen landwirtschaftlichen Betrieb im Zuerwerb. Sie haben schon vor Jahren die Milchviehhaltung aufgegeben und den Schwerpunkt ihres Betriebes auf die Färsenmast, also die Mast junger weiblicher Rinder zur Fleischerzeugung, verlagert. Für den Maschinenring sind die beiden nebenberuflich tätig. Monika und Thomas Kaufenstein unterstützen landwirtschaftliche Betriebe, die sich meist in einer schwierigen Situation befinden nicht nur mit ihrer Arbeitskraft sondern geben auch psychischen und menschlichen Beistand.
Trotz des personellen Engpasses konnte der MR Bayreuth-Pegnitz die Zahl der Einsatzstunden im Vergleich zum Vorjahr weitgehend gleich halten. 32681 Stunden haben die haupt- und nebenamtlichen Helfer im zurückliegenden Jahr geleistet. Gegenüber dem Vorjahr ist der Rückgang nur marginal, 2022 waren es 312700 Stunden. Gut zwei Drittel der Stunden waren soziale Einsätze, also bei Notfällen, wenn der Betriebsleiter erkrankt war, zur Kur oder Reha musste oder aus sonstigen Gründen ausgefallen ist. Nur etwa ein knappes Drittel der Stunden waren wirtschaftliche Einsätze, etwa zur Abdeckung von Arbeitsspitzen in der Erntezeit oder für eine Urlaubsvertretung.
Zweites
Standbein des Rings ist die Vermittlung von
Maschinen. Futterbau, Stroh- und Körnerernte sowie
organische Düngung waren dabei die Bereiche, die am
häufigsten nachgefragt wurden. Alles zusammen, also
in der Summe aller erbrachten Leistungen kam der MR
Bayreuth-Pegnitz auf einen Verrechnungswert von 8,4
Millionen Euro. Gegenüber dem Wert von 2022 in Höhe
von 7,8 Millionen Euro ist das eine Steigerung in
Höhe von 7,5 Prozent.
Die Maschinenring-Familie spiegelt auch immer den Zusammenhalt innerhalb des Berufsstandes wider. „Der Zusammenhalt war auch im zurückliegenden Jahr gigantisch“, sagte der Vorsitzende Reinhard Sendelbeck. Das gute Miteinander soll auch zu den beiden Nachbarringen Fränkische Schweiz und Kulmbach ausgebaut werden. „Wir wollen einen übergreifenden Einsatz der Mitarbeiter realisieren“, sagte Geschäftsführer Johannes Scherm. Ziel sei es, zum einen, besser zu werden und zum anderen Kosten zu sparen. Auch in der Geschäftsstelle hat sich im zurückliegenden Jahr ein Personalwechsel ergeben: Martin Freiberger ist auf eigenem Wunsch ausgeschieden. Seine Nachfolgerin ist Tatjana Felbinger. Zum zehnjährigen Jubiläum wurde die Mitarbeiterin Sandra Schönauer ausgezeichnet.
Zum weiteren Dienstleistungsangebot des Maschinenrings gehören die biologische Maiszünslerbekämpfung durch die Ausbringung von Schlupfwespen per Drohnen, Seilwindenprüfungen, Beratungsleistungen aller Art, vor allem rund um die Düngeverordnung, sowie alle möglichen Sammelbestellungen. In der MR Oberfranken Mitte GmbH hat der Maschinenring Bayreuth zusammen mit den Nachbarringen aus Kulmbach und aus der Fränkischen Schweiz seine gewerblichen Aktivitäten gebündelt. Hier geht es beispielsweise um die Klauenpflege oder um Futteranalysen. Geschäftsführer Bernd Müller ist dabei ebenfalls händeringend auf der Suche nach weiteren Helfern. „Wir könnten viel mehr abdecken, wenn wir nur mehr Leute hätten“, sagte er. Mit dem Ziel, Betriebshelfer zu gewinnen, soll deshalb künftig auch in den Schulen für eine landwirtschaftliche Ausbildung geworben werden.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Bayreuth-Pegnitz hat aktuell 1.254 Mitglieder, 18 weniger als im Jahr zuvor. Sie alle zusammen bewirtschaften eine Fläche von 41.536 Hektar, rund 120 Hektar mehr als im Vorjahr.
Bilder:
1. Sie
gehören zu den besten Betriebshelfern Deutschlands:
Monika und Thomas Kaufenstein aus Stemmenreuth bei
Pegnitz sind im zurückliegenden Jahr mit dem
Betriebshelfer-Award ausgezeichnet worden.
2. Personalwechsel
in der Geschäftsstelle des Maschinenrings
Bayreuth-Pegnitz: Geschäftsführer Johannes Scherm
(rechts) und Vorsitzender Reinhard Sendelbeck (2.
Von links) haben den bisherigen Mitarbeiter Martin
Freiberger verabschiedet und Sandra Schönauer zu
ihrer zehnjährigen Tätigkeit für den Ring
gratuliert.
Weniger Rehwild zur Rettung des Waldes / ARGE Jagdgenossenschaften zum Start des forstlichen Gutachtens
Kulmbach.
Biber, Fischotter, Krähen und Gänse haben den
Landwirten im zurückliegenden Jahr auch im
Kulmbacher Raum wieder stark zu schaffen gemacht.
Wildschweine spielen dagegen nicht mehr die große
Rolle im Kulmbacher Land. „Die Schwarzwildstrecken
sind rückläufig“, sagte der Kreisvorsitzende der
Arbeitsgemeinschaft Jagdgenossenschaften im
Bauernverband, Burkhard Hartmann aus Lindau.
Als Gund für die abnehmende Wildschweinpopulation nannte Hartmann vor allem die Aujeszkysche Krankheit, eine Viruserkrankung, die primär Schweine befällt. Sie habe wohl dafür gesorgt, dass sich die Schwarzwildproblematik der zurückliegenden Jahre entspannt habe. Aktuell kein Thema sei der Wolf im Kulmbacher Land, wobei der Vorsitzende zu bedenken gab, dass es nach offiziellen Zählungen bereits fast 200 Wolfsrudel in Deutschland gibt. Rund 4500 Nutztiere seien im zurückliegenden Jahr durch Wölfe gerissen worden, darunter auch mehrere hundert Rinder, die allgemein als sehr wehrhaft gelten.
Echte Probleme bereite im Landkreis aber der Biber, der zwischenzeitlich alle Gewässer erster und zweiter Ordnung besetzt habe. Einfangen und woanders freilassen führe zu keinem Ergebnis, da der Biber mittlerweile überall anzutreffen sei. Ebenfalls ein großes Thema sei der Fischotter, der immense Schäden verursacht, weil er ganze Fischteiche leer räumt. Vor allem Im Nachbarlandkreis Lichtenfels, aber auch schon im Kulmbacher Land trete seit dem zurückliegenden Jahr die Gänseproblematik auf. Egal ob Graugans, Nilgans, Kanadagans oder auch Saatkrähen: sie alle hätten es auf Saatgut, Mais oder Erbsen abgesehen. Während sie in früheren Jahren durch Beizmittel, also Pflanzenschutzmittel vergrämt wurden, könnten sie sich durch den immer stärkeren Verzicht darauf jetzt ungehindert ausbreiten.
Das große Thema sei aktuell allerdings die immer weiter voranschreitende Zunahme des Rehwildes. Die durch eine Überpopulation verursachten Schäden seien auch in der Region auf Rekordniveau. Burkhard Hartmann plädierte unter anderem dafür, die allgemeinen Jagdzeiten für Schalenwild flexibler zu gestalten und beispielsweise auf den 1. April vorzuverlegen. Hintergrund seien die veränderten Vegetationszeiten. Bäume, Büsche und Hecken würden mittlerweile viel früher austreiben, als in vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Geschlossene Schneedecken seien eher selten geworden. An die Bevölkerung appellierte er, den Jägern das Wildbret auch abzukaufen. Schließlich sei Wild eine hochwertige Ernährung, trotzdem hapere es immer wieder an der Vermarktung.
Von einer großen Herausforderung sprach Bereichsleiter Jens Haertel vom Landwirtschaftsamt Coburg-Kulmbach. Er meinte damit die Wiederbewaldung der zahlreichen Kahlflächen, die durch die Trockenheit und die Borkenkäferproblematik, aber auch durch den Einfluss des Wildes entstanden seien. Dabei komme der Landkreis Kulmbach mit über 1000 Hektar Kahlfläche im Gegensatz zum Nachbarlandkreis Kronach mit über 8000 Hektar Kahlfläche noch ganz gut weg. Damit die Wiederbewaldung gelingen kann gibt es das „Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung“, wie das Verbissgutachten offiziell heißt.
Es wird alle drei Jahre erstellt, offizieller Start war jetzt im Februar. Nach den Worten von Jens Haertel erstellt die Bayerische Forstverwaltung für die rund 750 bayerischen Hegegemeinschaften das Gutachten zur Situation der Waldverjüngung. Offizieller Start war jetzt im Februar. Darin äußern sich die Forstbehörden zum Zustand der Waldverjüngung und ihre Beeinflussung durch Schalenwildverbiss. Sie beurteilen die Verbiss-Situation in den Hegegemeinschaften und geben Empfehlungen zur künftigen Abschusshöhe ab. Die Forstlichen Gutachten sollen die Beteiligten vor Ort in die Lage versetzen, für die Schalenwild-Abschussperiode einvernehmlich gesetzeskonforme Pläne aufzustellen. Für die unteren Jagdbehörden stellen sie eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei der behördlichen Abschussplanung dar.
Allein für das Amtsgebiet kam Jens Haertel auf 13 Reviere mit exakt 1009 Meßpunkten in den vier Landkreisen Coburg, Kronach, Kulmbach und Lichtenfels. Oberstes Ziel ist es nach den Worten des Bereichsleiters, die natürliche Waldverjüngung durch stadortgemäße Baumarten ohne Schutzmaßnahmen zu ermöglichen. Die Ergebnisse lägen bis Juli vor, den Sommer über würden sie ausgewertet und im Herbst bekannt gegeben. Dann werde auch klar sein, ob die Abschüsse in den Hegegemeinschaften das Kulmbacher Landes gesenkt oder gesteigert werden müssen. „Unser Ziel ist ein transparentes und aussagekräftiges Verfahren zur Ermittlung der Abschusszahlen, um einen klimaresistenten Wald zu erhalten“, so Jens Haertel.
Zuletzt wurden im Kulmbacher Land gleich zwei „dauerhafte Rote Hegegemeinschaften“ festgestellt. Dabei handelte es sich um die Gemeinschaften „Jura“ und „Frankenwald“. In beiden Gebieten sei die Verbiss-Situation dreimal hintereinander zu hoch gewesen. Die Verbiss-Situation hatte allgemein im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zugenommen und lag meist über dem bayerischen Durchschnitt. Im „Verbissgutachten“ war nicht nur die Rede von schwerwiegenden ökonomischen Auswirkungen für die Waldbesitzer, etwa durch hohe Kosten für dringend notwendigen Bau von Schutzzäunen, sondern auch von ökologischen Auswirkungen, zum Beispiel durch das Aussterben mancher Baumarten.
Bild: Bereichsleiter Jens Haertel vom Landwirtschaftsamt Coburg-Kulmbach informierte die ARGE Jagdgenossenschaften mit dem Vorsitzenden Burkhard Hartmann aus Lindau und dessen Stellvertreter Michael Sack vom Maierhof in Ködnitz (von links) über den Start des forstlichen Gutachtens.
Deutliche Steigerung in allen Bereichen / Maschinen- und Betriebshilfsring Wunsiedel: So viel Betriebshilfe wie lange nicht mehr
Höchstädt.
„Wirtschaften in turbulenten Zeiten.“ Unter diesem
Motto hat der Maschinen- und Betriebshilfsring
Wunsiedel diesmal seine Jahresversammlung gestellt.
Tatsächlich konnte der Zusammenschluss in allen
seinen Tätigkeitsfeldern deutliche Anstiege
verzeichnen. Das zeigt, dass die Arbeit des Rings
wichtiger als je zuvor ist.
Da ist einmal die Betriebshilfe, bei der die Einsatzstunden um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen sind. Waren es 2022 noch 17560 Stunden kamen die Verantwortlichen im zurückliegenden Jahr auf 23162 Stunden. „Man muss sich fast schon wundern, wie wir das alles abdecken konnten“, sagte Geschäftsführer Andreas Hager. Über 23000 Stunden, so viel habe es schon lange nicht mehr gegeben. Fast drei Viertel der Stunden entfallen dabei auf die soziale Betriebshilfe, die immer dann notwendig wird, wenn zum Beispiel ein Betriebsleiter erkrankt, einen Unfall hat, wegen einer Operation außer Gefecht ist oder zur Kur muss. Ein gutes Viertel macht die wirtschaftliche Betriebshilfe, meist zur Abdeckung von Arbeitsspitzen aus.
Auch in der Maschinenvermittlung, dem zweiten klassischen Tätigkeitsfeld der Ringe, war Wunsiedel wieder gut unterwegs. Absoluter Spitzenreiter war diesmal der Bereich Futterbau und Strohernte mit einem Verrechnungswert von allein über einer Million Euro. „Das zeigt, dass die Silos gut gefüllt sind“, sagte Geschäftsführer Hager. Insgesamt, also mit Maschinenvermittlung, Betriebshilfe und auch der Leistungen für den Landschaftspflegeverband hat der Maschinenring einen Verrechnungswert von über 3,4 Millionen Euro erzielt, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 21 Prozent bedeutet.
Der gewerbliche Bereich ist beim Maschinenring in die MR Hochfranken GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft ausgelagert. Der Maschinenring Münchberg, der zuletzt 50 Prozent gehalten hatte, ist seit 2022 kein Teilhaber mehr. Als Hauptumsatzträger der GmbH bezeichnete dessen Geschäftsführer Reinhard Rasp den Winterdienst mit rund 200 Kunden. Ein weiterer wichtiger Bereich sei die Baumpflege. Im Auftrag des Straßenbauamtes führt die GmbH unter anderem insektenschonende Mäharbeiten durch, für das Bayernwerk erledigt die MR Hochfranken Trassenpflege entlang der 20-KV- und der Nebenspannungsleitungen. Die gewerbliche Tochter kümmere sich um die Sportplatzpflege und ist an der Holzenergie Hochfranken, die in Weißenstadt dien Therme beheizt, beteiligt.
Nach den Worten des 1. Vorsitzenden Martin Goldschald hat der Maschinenring Wunsiedel aktuell exakt 591 Mitglieder. Acht Neuzugängen standen 14 Austritte gegenüber. Alle Mitglieder zusammen bewirtschaften eine Fläche von 22418 Hektar, was nahezu komplett der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Landkreis entspricht. Mit Sandra Dornhöfer, Hans Tröger und Toni Zeitler wurden bei der Jahresversammlung auch die drei Betriebshelfer geehrt, die im zurückliegenden Jahr am meisten Stunden geleistet hatten.
Eine Überraschung hatte Gerhard Fritsch aus Röthenbach zur Jahresversammlung mitgebracht. Er überreichte dem Betriebshelferausschuss des Maschinenrings einen Scheck in Höhe von 5500 Euro. Das Geld stammt aus dem Brandschadenshilfeverein Bergnersreuth und Umgebung. Der Verein hatte sich im zurückliegenden Jahr, ausgerechnet im 100. Jahr seines Bestehens aufgelöst. „Die Zeit hat uns überholt“, sagte Gerhard Fritsch. Zu Hochzeiten hatte der Verein über 300 Mitglieder, doch aufgrund des Strukturwandels sei die Arbeit überflüssig geworden. Zum Schluss seien noch 5500 Euro in der Kasse gewesen, üb er die sich jetzt der Maschinenring freuen kann.
Bild: Der Maschinen- und Betriebshilfsring Wunsiedel hat seine stundenstärksten Betriebshelfer geehrt und einen Scheck über 5500 Euro in Empfang nehmen können. Im Bild von links: Toni Zeitler, Hans Tröger, Matthias Benker vom Maschinenring, Sandra Dörnhöfer, Geschäftsführer Andreas Hager, Vorsitzender Martin Goldschald, der stellvertretende Kreisobmann Stephan Regnet, Gerhard Fritsch und Harald Schwarz vom Brandschadenshilfeverein.
Personalmangel beim Maschinenring / Minus im Haushalt macht satte Beitragserhöhung notwendig – Alexander Hollweg wird neuer Geschäftsführer
Kulmbach.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach sucht
Nachwuchs. Sowohl bei der sozialen, als auch bei
der wirtschaftlichen Betriebshilfe waren die Zahlen
im zurückliegenden Jahr rückläufig. „Da müssen und
wollen wir gegensteuern“, sagte Geschäftsführer
Horst Dupke bei der Jahresversammlung.
Waren es im Jahr zuvor noch 17836 Stunden soziale Betriebshilfe, so kommen die Verantwortlichen für 2023 nur mehr auf 16508 Stunden. Soziale Betriebshilfe wird immer dann notwendig, wenn beispielsweise ein Landwirt erkrankt, einen Unfall hat, zu einer Reha-Maßnahme oder zur Kur muss. In der wirtschaftlichen Betriebshilfe, also zur Abdeckung von Arbeitsspitzen sank die Zahl der erbrachten Stundn von 6290 auf 4328.
Ähnlich ist die Situation bei den Klauenpflegern, eine Dienstleistung, die der Maschinenring über seine gewerbliche Tochterfirma, der MR Oberfranken Mitte in Zusammenarbeit mit den Nachbarringen Bayreuth und Fränkische Schweiz anbietet. „Wir haben zu wenig Klauenpfleger und zu viele Anfragen“, sagte Geschäftsführer Dupke. Aktuell müsse man sämtliche Anfragen absagen, weil die beiden Klauenpfleger komplett ausgelastet sind. Ähnlich problematisch gestaltet sich die Situation beim Winterdienst oder bei der Grünflächenpflege. „Wir suchen ständig Leute“, so der Geschäftsführer. Bezahlt werde pauschal, wer Lust und Zeit hat sollte sich umgehend beim Maschinenring melden.
Ein umstrittener Punkt war bei der Jahresversammlung die Beitragserhöhung. Demnach wird der Grundbetrag von 50 auf 75 Euro pro Jahr erhöht. Unangetastet bleibt der Beitrag von einem Euro Hektar bewirtschafteter Fläche und die Aufnahmegebühr von 12,50 Euro. Die letzte Erhöhung des Grundbetrages liege 20 Jahre zurück, gab Dupke zu bedenken. Das zurückliegende Jahr schloss der Maschinenring vor allem wegen der Kosten für den hohen Personalaufwand mit einem Minus von über 30.000 Euro ab. Ohne Beutragserhöhung stünde im Haushaltsvoranschlag für das laufende Jahrmit ein Minus in ähnlicher Höhe.
Die beiden Mitglieder, die sich gegen die Beitragsanpassung aussprachen, nannten es „fies“ , dass mit der Erhöhung kleine Bauern benachteiligt und große bevorzugt würden. Ein ordentlicher Kompromiss wäre es nach den Worten der beiden Gegner gewesen, den Hektar Beitrag zu erhöhen und den Grundbetragn nur maßvoll anzupassen. Geschäftsführer Dupke bezeichnete die Erhöhung trotzdem als moderat, zumal das Minus von 30.000 auf 300 Euro gesenkt werden könne.
„Unser
gemeinsames Ziel ist es, die Betriebshilfe im
Landkreis Kulmbach auch künftig zu organisieren und
sicherzustellen“, sagte der Vorsitzende Andreas
Textores. Den Verrechnungswert aller erbrachten
Leistungen bezifferte er auf 4,4 Millionen Euro, im
Vorjahr waren es 3,96 Millionen Euro. Der
Maschinenring Kulmbach hat aktuell 825 Mitglieder,
neun weniger als im Jahr zuvor.
Wenn der Verrechnungswertt trotz der Rückgänge bei der Betriebshilfe trotzdem angestiegen ist, so lag das am zweiter wesentlichen Aufgabenbereich des Rings, der Vermittlung von Maschinen. Hier schlugen im Wesentlichen die Futter- und Strohernte, das weite Feld der Landschaftspflege sowie der Verleih von Schleppern zu Buche. Darüber hinaus sieht sich der Maschinenring als verlässlicher Partner, wenn es um die Mehrfachanträge, um Gasölanträge oder um Düngedokumentationen geht.
Eine wichtige personelle Veränderung steht beim Kulmbacher Maschinenring in den kommenden Wochen an. Geschäftsführer Dupke wird in den Ruhestand verabschiedet, der bisherige Assistent Alexabder Hollweg wird zum 1. Mai die Nachfolge übernehmen. Bei der Jahresversammlung wurden drei betriebshelfer geehrt, die im zurückliegenden Jahr jeweils mehr als 1.000 Einsatzstunden absolviert hatten: Astrid Masel aus Großenhüll, Elfriede Winkler aus Lanzenreuth und Thomas Kraß aus Guttenberg.
Bilder:
1. Ehrung
für die Betriebshelfer mit den meisten
Einsatzstunden (von links): Landrat Klaus Peter
Söllner, Thomas Kraß, Dekan Friedrich Hohenberger,
Geschäftsführer Horst Dupke, Elfriede Winkler und
Vorsitzender Andreas Textores.
2. Obwohl
er noch bis Ende April hauptamtlich für den
Maschinenring Kulmbach tätig sein wird,
verabschiedete der Vorsitzende Andreas Textores
(Mitte) bei der Jahresversammlung den bisherigen
Geschäftsführer Horst Dupke (links) und stellte
Alexander Hollweg als Nachfolger vor.
Steigende Zahlen in allen Bereichen / Maschinen- und Betriebshilfsring Fränkische Schweiz setzt verstärkt auf Bioenergie
Aufseß.
Maschinenverleih, Betriebshilfe und
Beratungsleistungen, das sind drei wesentliche
Säulen, auf denen sich die Arbeit der Maschinenringe
aufbaut. Eine weitere immer stärker werdende Säule
ist beim Maschinen- und Betriebshilfsring Fränkische
Schweiz der Bereich Energie. Zusammen mit den
Nachbarringen Bayreuth und Kulmbach hat man deshalb
die „MR Oberfranken Mitte Bioenergie GmbH“
gegründet. Gemeinsames Ziel sei die Förderung von
Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien“,
sagte Geschäftsführer Manuel Appel (Bild) bei der
Jahresversammlung des Maschinenrings Fränkische
Schweiz in Aufseß.
Konkret soll es darum gehen, Verträge mit Abnehmern zu schließen und potentiellen Lieferanten, etwa von Hackschnitzeln, eine regelmäßige Absatzmöglichkeit zu vermitteln. Ein Beispiel dafür ist die Biomasse Heizwerk Gößweinstein. Hier hat der MR nicht nur Lieferrechte für seine Mitglieder ausgehandelt, der Ring ist auch einer der Gesellschafter. Weitere 60 Landwirte beliefern die Stadtwerke Ebermannstadt mit zusammen 2500 Tonnen Hackschnitzel pro Jahr. Unter anderem werden damitz das Schulzentrum, das Krankenhaus und zahlreiche Privathäuser beheizt. Ähnliche Heizwerke sollen auch in Pretzfeld und Waischenfeld entstehen.
„In diesem Bereich ist ordentlich Musik drin“, sagte Geschäftsführer Manuel Appel. Ganz neu ist das Thema Energie für den MR Fränkische Schweiz allerdings nicht. Schon seit Jahren gehören die Übernahme der Geschäftsführung für das Biomasseheizwerk Hollfeld und für die Bioenergie Hollfeld zum Aufgaben bereich des Rings. In Hollfeld sollen auch heuer wieder mehrere Häuser am zentralen Marienplatz an das Biomasseheizwerk angeschlossen werden.
Was die klassischen Aufgabenbereiche des Maschinenrings Fränkische Schweiz angeht waren die Zahlen sowohl bei der sozialen, als auch bei der wirtschaftlichen Betriebshilfe angestiegen. Knapp 15274 Einsatzstunden wurden der Bilanz zufolge im zurückliegenden Jahr geleistet, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent gleichkommt. Gut zwei Drittel entfallen auf die soziale Betriebshilfe, also in Notsituationen, bei Krankheit, Kur oder Reha. Ein Drittel der Stunden sind wirtschaftliche Betriebshilfe, etwa zur Abdeckung von Arbeitsspitzen.
Das wichtigste Geschäftsfeld des Rings ist noch immer der Maschineneinsatz. Fast alle Bereiche seien dabei gestiegen, besonders die Sparten Schlepper und Transport sowie Futterbau und Strohernte ragen zahlenmäßig heraus. Insgesamt, also zusammen mit der Betriebshilfe, kommt der Maschinenring Fränkische Schweiz für 2023 auf einen Verrechnungswert von knapp 3,3 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es knapp 3,2 Millionen Euro.
Immer stärker in Anspruch genommen werde der Maschinenring auch, wenn es um das Thema Beratung geht. Egal ob Düngeberatung, Mehrfachantrag oder Dieselanträge, der Maschinenring ist immer ein wichtiger Adressat für alle Ratsuchenden. Für die Beratung ist Mitarbeiter Patrick Munzert von der Geschäftsstelle in Aufseß zuständig.
Seine gewerblichen Aktivitäten hat der MR Fränkische Schweiz zusammen mit den Nachbarringen Bayreuth und Kulmbach in der Maschinenring Oberfranken Mitte (OMI) GmbH gebündelt. Dazu gehört nach den Worten von Rüdiger Haase beispielsweise die Klauenpflege mit zwei eigenen Ständen, die biologischer Maiszünslerbekämpfung mit Schlupfwespen oder die Unkrautbekämpfung mit Heißwasserthermie.
Welche Wirtschaftskraft hinter der MR Oberfranken Mitte steht, machte Rüdiger Haase an den folgenden Zahlen deutlich: So habe die OMI 30 festangestellte Mitarbeiter, davon allein 15 Betriebshelfer. Die Klauenpfleger hätten im zurückliegenden Jahr rund 18500 Tiere versorgt, so dass sie komplett ausgelastet sind und keine weiteren Aufträge mehr annehmen könnten.
Der
MR Fränkische Schweiz stellt ein besonderes
Konstrukt dar, weil sich sein Tätigkeitsgebiet auf
drei Landkreise erstreckt. Neben zwei Gemeinden aus
dem Landkreis Bamberg gehören vier Gemeinden aus dem
Landkreis Bayreuth dazu, der Rest gehört zum
Landkreis Forchheim. Der Ring hat 741 Mitglieder,
fünf weniger als im Jahr zuvor.
Vorsitzender Bernhard Hack (Bild) aus Weilersbach hatte zuvor deutlich gemacht, dass der Maschinenring voll und ganz hinterr den Protestaktionen der Landwirte steht. Das gelte uneingeschränkt, auch wenn der Ring selbst als unpolitischer Zusammenschluss keine Aktionen organisiert, plant oder durchführt. Die Aktionen weckten Hoffnung, sagte der Vorsitzende. Als positiv bezeichnete er den Zusammenhalt innerhalb der Landwirtschaft. Er drückte auch seine Hoffnung aus, dass wieder ein Umdenken erfolgt und die Gemeinschaft wieder als wichtiger gesellschaftlicher Wert wahrgenommen werde,
Betriebshilfe gefragter denn je zuvor / Rekordergebnisse beim Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg und Umgebung
Dörnthal. Die landwirtschaftliche Betriebshilfe ist gefragter denn je zuv or. Um fast ein Viertel ist die Zahl der geleisteten Stunden beim Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg und Umgebung im vergangenen Jahr angestiegen. Waren es 2022 noch 24744 Stunden kommen die Verantwortlichen für 2023 auf exakt 30598 Stunden. „In Spitzenzeiten, wie der Erntezeit, haten wir 37 Einsätze parallel“, sagte Geschäftsführer Patrick Heerdegen bei der Jahresversammlung in Dörnthal bei Selbitz.
Die Stunden wurden in der Regel von selbstständigen, eigenangestellten oder nebenberuflichen Betriebshelfern geleistet. „Da ist Solidarität gefragt“, sagte Heerdegen, Man könne aber auch feststellen, dass sich der Berufsstand gegenseitig unterstützt. Überwiegend war es dabei um wirtschaftliche Einsätze, also zur Abdeckung von Arbeitsspitzen oder zur Urlaubsvertretung, gegangen. Eine nicht weniger wichtigere Rolle spielten aber auch die sozialen Einsätze, beispielsweise wenn eine Arbeitskraft wegen eines Krankenhausaufenthalts, einer Kur- oder Rehamaßnahme ausfällt.
Die gestiegenen Zahlen haben aber auch irhe Schattenseiten. Wie der Vorsitzende Jürgen Becher ausführt könnten beispielsweise aktuell vier Einsätze nicht abgedeckt werden. „Da sieht man eigentlich erst einmal so richtig, wie wertvoll unsere Arbeit ist“, sagte Becher. Geschäftsführer Heerdegen nutzte denn auch die Gunst der Stunde, bei den Mitgliedern einmal mehr für die Tätigkeit als Betriebshelfer zu werben. Bei einem Stundenlohn von 22,20 Euro vor Steuern könne das eine hervorragende Zuverdienstmöglichkeit sein. „Das kann sich doch sehen lassen“, sagte der Geschäftsführer. Auch eine Festanstellung sei denkbar. Derzeit hat der MR Münchberg drei hauptberufliche Betriebshelfer.
Insgesamt kommt der Münchberger Ring für das zurückliegende Jahr auf einen Verrechnungswert von 5,3 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von 26,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neben der Betriebshilfe fleißt mit der Maschinenvermittlung dabei vor allem das Kerngeschäft des Rings mit ein. Schwerpunkte waren dabei die Bereiche Schlepper und Transporte, Futtervermittlung, Futterbau und Strohernte. Ein weiteres immr stärker werdendes Geschäftsfeld sei dioe Beratungstätigkeit. Da gehe es beispielsweise um die Düngeverordnung, den Dieselantrag, um Merfachanträge oder um Anträge für das Kulturlandschaftsprogramm.
Die gewerblichen Tätigkeiten hat der Ring in die MR Münchberg GmbH ausgelagert. Dessen Geschäftsführer Daniel Seuß sprach von einer konstanten und meist sogar steigenden Nachfrage in allen drei Bereichen, im gewerblichen, kommunalen und privaten Bereich. Deshalb habe man mit der gelernten Gärtnerin, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Christine Jakob aus Rodesgrün auch zum 1. Februar eine weitere Neueinstellung vorgenommen.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg hat aktuell 917 Mitglieder, genauso viele, wie im cvergangenen Jahr. Sie bewirtschaften zusammen eine Fläche von 41425 Hektar. Das sind 98 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche im Landkreis Hof. Der Ring kann in diesem Jahr auch sein 60-jähriges Bestehen feiern. Dazu gratulierten bei der Jahresversammlung Landrat Oliver Bär, der Landtagsabgeordnete Kristan von Waldenfels und BBV-Kreisobmann Ralph Browa.
Die Aufgaben würden in Zukunft wohl nicht weniger, sondern eher mehr, sagte Landrat Bär. Vor allem das Thema Waldumbau werde den Landkreis Hof in den kommenden Jahren sehr beschäftigen. Ohne den Maschinenring gäbe es die Landwirtschaft in dieser Form nicht, ohne den Maschinenring wäre Landwirtschaft in Bayern undenkbar, so Kristan von Waldenfels. Kreisobmann Browa bedankte sich für die Unterstützung der Mitglieder bei den Bauernprotesten und kündigte weitere Aktionen an, unter anderem ein Mahnfeuer zusammen mit den Berufskollegen aus Sachsen und Thüringen.
Wissen um die Dinge des Alltags / Landfrauen fordern eigenes Schulfach „Alltagskompetenz und Lebensökonomie“
Kulmbach.
Wo kommt eigentlich das Fleisch auf dem Burger her?
Wie ist das mit der Milch? Wie wasche ich die Wäsche
richtig und wie nähe ich einen Knopf an? Seitdem es
an den meisten allgemeinbildenden Schulen keine
Fächer wie Hauswirtschaft, Handarbeit, Kochen oder
Werken mehr gibt, weisen viele Schüler Defizite beim
Wissen um die Dinge des Alltags auf. Eine
Berufsgruppe gibt es, die auf all diese Fragen und
noch viele weitere Antworten geben könnte: Landwirte
und Landfrauen.
Deshalb wollen sie sich verstärkt einbringen, wenn es gilt, Schülern Alltagskompetenzen zu vermitteln. Die Umsetzung des Projektes „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“ ist deshalb meist in Form einer eigenen Woche an allen staatlichen Schulen verpflichtend. So richtig funktioniert das allerdings noch nicht. Zum einen gibt es zu wenige landwirtschaftliche Betriebe, die dabei mitmachen. Zum anderen scheuen viele Schulen den Besuch auf einem Bauernhof, aus welchen Gründen auch immer.
Nun steht die Einführung eines Schulfaches, das beispielsweise Alltagskompetenzen und Lebensökonomie“ heißen könnte im Koalitionsvertrag der bayerischen Staatsregierung. Die Umsetzung lässt allerdings noch auf sich warten. Dabei fordern es die Landfrauen schon seit Jahren.
Eine Bäuerin, die den Kindern und Jugendlichen an der Grund- und Mittelschule Mainleus schon seit Jahren vermittelt, wo das Brot herkommt ist Gudrun Passing, die stellvertretende Kulmbacher Kreisbäuerin aus Oberdornlach. Jeweils vier bis fünf Stunden erklärt sie Fünf- und Sechsklässer, wie aus Getreide Mehl wird, wie ein Teig ensteht und wie lange es dauert, bis man eine Scheibe frisches Brot gernießen kann. Sie setzt mit den Schülern einen Sauerteig an, erläutert, welche Getreidesorten es gibt. „Im ländlichen Raum wüßten die meisten schon noch, wo das brot eigentlich herkommt“, sagt Gudrun Passing.
Ganz im Gegensatz zu manchen Schülern hauptsächlich in den Großstädten, weiß die Kulmbacher Kreisbäuerin und oberfränkische Bezirksbäuerin Beate Opel. Da gebe es schon Schüler, die nur Cola und Chips kennen und die Landwirte mit Massentierhaltern und Giftspritzern gleichsetzten. Das zu ändern, stehe schon lange auf der Agenda der Landfrauen. Doch das eigene Schulfach lasse leider auf sich warten. Immerhin gebe es die Projektwochen, bei denen entweder Landwirte und Landfrauen in die Schulen kommen, oder Schulklassen auf die Höfe. „Alle Schulen sind informiert, es gibt viele Möglichkeiten, allerdings müssen die Schulen von sich aus aktiv werden“. Die Forderung nach einem regulären Schulfach für alle Jahrgangsstufen und Schularten bleibt aber weiterhin bestehen, stellt Beate Opel klar.
„Wir müssen den Kindern einfach wieder Werte vermitteln, die ganz normal sind“, sagt die Kreis- und Bezirksbäuerin. „Wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen später mit beiden Beinen im Leben stehen.“ Vielfach sei das verloren gegangen. Dabei seien Ernährung und Gesundheit doch Megathemen. Viele Kinder würden keine Früchte mehr bestimmen können, wüssten nicht, was es mit der Kulturlandschaft auf sich hat und dass Wälder für den Klimaschutz wichtig sind. Dabei gehen die Landfrsauen noch weiter: Früher sei es selbstverständlich gewesen, wie man einen Haushalt führt, das Geld einteilt, die Wäsche macht, bügelt und zusammenlegt oder eben den berühmten Knopf annäht.
Auch Diana Wende, Kulmbacher Kreisvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) weiß, dass die Umsetzung des Themas „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“ noch in den Kinderschuhen steckt. Bereits in den vergangenen zwei Schuljahren sollte ein größeres Augenmerk mittels eigenständiger Projekte auf Alltagskompetenzen gelegt werden. Dazu haben „Ernährung-und-Soziales-Gruppen“ von Mittelschulen zum Beispiel das Gewürzmuseum in Kulmbach besucht und die neu gewonnenen Erkenntnisse in den Unterricht eingebunden. Ein weiteres Beispiel: im Grundschulbereich konnte ein Schwerpunkt „Gesundes Frühstück“ gesetzt werden. Hier könnten Experten – also nicht schulisches Personal wie etwas auch Ernährungsberater – mit eingebunden werden.
Grundsätzlich sollte die Projektwoche den fünf Themenschwerpunkten Ernährung, Gesundheit, Haushaltsführung, Umweltverhalten und selbstbestimmtes Verbraucherverhalten zuzuordnen sein. Viele Aspekte daraus würden bereits im regulären Unterricht behandelt, da sie Teil des „LehrplansPLUS“ sind.
Eine Verallgemeinerung der Defizite der Schüler in diesem Bereich sei aber nicht möglich. Die Schulen würden neben dem Elternhaus einen Bildungs- und Erziehungsauftrag wahrnehmen und seien daher bemüht, den Kindern „Handwerkszeug“ mitzugeben. Doch würden sicherlich nicht alle Bereiche im Laufe des Schullebens allein durch die Schule abgedeckt werden können. Wie so oft, kann dieser Auftrag nur gemeinsam von Elternhaus und Schule umgesetzt werden und nicht allein der Schule zugeschrieben werden“, so BLLV-Sprecherin Diana Wende.
Bild: Machen sich für die Einführing eines Schulfaches „Alltagskompetenz und Lebensökonomie“ stark: Gudrun Passing (links) und Beate Opel.
Weniger Tiere, weniger Bauern, weniger Umsatz / Rinderzuchtverband Oberfranken konnte sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen noch immer gut positionieren – Gesamtumsatz über 15 Millionen Euro
Bayreuth.
Trotzweltweiter Krisen und Sopannungen und trotz
denkbar ungünstiger Rahmenbedingungen für die
Landwirtschaft in Deutschland hat der
Rinderzuchtverband Oberfranken sein Ergebnis in etwa
halten können. Das geht aus dem Geschäftsbericht
hervor, den der Vorsitzende Georg Hollfelder
(Litzendorf) und Zuchtleiter Markus Schricker
(Bayreuth) bei der Jahresversammlung in der
Tierzuchtklause vorgelegt haben. Demnach war der
Gesamtumsatz von 15,4 auf 15,2 Millionen Euro
zurückgegangen. Auch die Vermarktungszahlen waren
rückläufig. Waren es im vorigen Geschäftsjahr noch
knapp 28329 Tiere, kommt die Bilanz aktuell auf
27955 Tiere aller Kategorien (Nutzkälber,
Zuchtkälber, Jungrinder, Jungkühe und Bullen). Das
Geschäftsjahr des Rinderzuchtverbandes ist nicht
identisch mit dem Kalenderjahr. Es beginnt immer am
1. Oktober und endet am 30. September.
Der Rinderzuchtverband Oberfranken hatte im zurückliegenden Zuchtjahr noch 924 Mitgliedsbetriebe. Im Geschäftsjahr zuvor waren es noch 968 Mitgliedsbetriebe. Die Zahl der Herdbuchkühe ist dem Jahresbericht zufolge ebenfalls gesunken, und zwar um 767 Kühe auf nun 63085. Die Durchschnittsgröße der Betriebe wird mit gut 68 Kühen angegeben (Vorjahr 66).
Während diese Statistik nur die Kreiszuchtgenossenschaften und die Mitgliedsbetriebe des Rinderzuchtverbandes betrifft, listet der Jahresbericht von Zuchtleiter Schricker traditionell auch die gesamte Milchviehhaltung in Oberfranken auf. Hier sank die Zahl der Milchkühe um 1511 auf 78212. Die Zahl der Betriebe ging um 86 auf 1492 zurück. Vor zehn Jahren waren es noch oppekt so viele Betriebe. Die meisten Milchkühe werden in den Landkreisen Bayreuth und Hof gehalten, die wenigsten in den Landkreisen Forchheim, Kronach und Lichtenfels.Insgesamt habe Oberfranken einen Rückgang bei den Milchkühen zu verkraften der über dem bayerischen Durchschnitt liegt.
Von einem übermäßig hohen Strukturwandel sprach der Vorsitzende Georg Hollfelder, der auch Landesvorsitzender der bayerischen Rinderzüchter ist. Ursache dafür sei in erster Linie die gewaltige Bürokratie, die den Betrieben mittlerweile aufgebürdet werde und die immer noch zunehme. „Es geht bei den Bauernprotesten nicht nur um den Agrardiesel, es gibt so vieles, was uns das Wirtschaften immer schwerer macht“, sagte Georg Hollfelder. Er sprach offen von der „schlechtesten Regierung, soweit ich mich zurückerinnern kann“. So könne man nicht mit den Bauern und auch nicht mit den Bürgern umgehen.
Die gleiche Auffassung vertrat auch Peter Köninger, mittelfränkischer BBV-Präsident und in dieser Funktion für die Milcherzeuger zuständig. Er rief die Landwirte dazu auf, auch weiterhin für die Anliegen des Berufsstandes einzutreten. In den zurückliegenden Wochen und Monaten hätten die Bauern ein deutliches Zeichen gesetzt. Der Blick auf das neue Tierschutzgesetz zeige aber auch: „Die haben es noch immer bnicht begriffen.“ Auf keinen einzigen Vorschlag aus den Reihern der Landwirtschaft sei eingegangen worden, das zeige, dass der Druck aufrechterhalten werden muss. In vielen Dingen hätte er sich einen pragmatischen Ansatz erwartet. Zum Beispiel in Sachen anbindehaltung. Sie wird auslaufen, das sei jedem klar. Doch kann es wirklich sein, dass so viele kleine Familienbetriebe jetzt mit Gewalt dicht gemacht werden?“
„In der Landwirtschaft ist die Basis noch in Ordnung“, das wusste auch Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). Er stellte sich hinter die Proteste der Bauern: „Wenn das Fass übergelaufen ist, muss man etwas unternehmen.“ Einen schwereren Stand hatte Stephan Unglaub (SPD), der in Vertretung des Landrates sprach. Doch auch er beklagte, dass der Weitblick und das Gespür für die landwirtschaft häufig fehlten. Immerhin habe seit Corona ein Umdenken stattgefunden. Viele Menschen wüßten regional produzierte Produkte wieder zu schätzen, ihnen sei klar geworden, dass die Landwirtschaft einen unverzichtbarebn Beitrag zur Ernährungssicherheit leistet.
Für herausragende Leistungen wurden die Betriebe der Familen Böhm (Neuhaus), Schmidt (Hainbronn), Lauterbach (Tressau), Raab (Lessau) und Engelbrecht (Lankendorf) ausgezeichnet.
Bild: Ehrung für herausragende Verdienste um die Rinderzucht in Oberfranken (von links): Zuchtleiter Markus Schricker, Vorsitzender Georg Hollfelder, Gerhard Schmidt (Hainbronn), Christiane Böhm (Neuhaus) der stellvertretende Vorsitzende Thomas Erlmann, Christian Engelbrecht (Lankendorf), Jürgen Raab (Lessau) und Kathrin Lauterbach (Tressau).
Einmalige Erinnerungen der Ehemaligen / Buchveröffentlichung zum 100jährigen Jubiläum der Bayreuther Landwirtschaftsschule vorgestellt
Bayreuth.
Es ist viel mehr als eine Festschrift, es ist ein
stattliches Kompendium, dass auf fast 160 Seiten
eindrucksvoll die gemeinsame 100-jährige Geschichte
der Landwirtschaftsschule in Bayreuth und der
„Gärtner Johann Popp´schen Stiftung“ dokumentiert.
Bei einer Feierstunde in der Tierzuchtklause in
Bayreuth hat Stiftungsgeschäftsführer Helmut
Schelhorn, langjähriger Amtschef und Leiter der
Landwirtschaftsschule, das neue Buch mit dem Titel
„Landwirtschaftsschule – und dann?“ mit dem
Untertitel „Erinnerungen an eine prägende Zeit“
zusammen mit Vertretern der Stiftung und der Schule
vorgestellt.
In der Publikation haben fast 50 ehemalige Schüler der Fachschulen in Bayreuth und Pegnitz mit persönlichen Beiträgen 75 Jahre zur Schulgeschichte und zu ihren beruflichen Lebenswegen beschrieben. Helmut Schelhorn zeigte sich bei der Buchvorstellung begeistert von den „einmaligen, lebendigen, anschaulichen und spannenden Erinnerungen der Ehemaligen“. Sie alle seien in den Fachschulen als Persönlichkeiten geformt worden, überwiegend in der fachlichen Qualifikation, aber auch als Menschen, die Verantwortung zu übernehmen hatten. So seien danach Berufswege entstanden, die ganz unterschiedlich verlaufen sind: Vom Verbleib in der Landwirtschaft im Haupterwerb bis zum Ausstieg aus dem erlernten Beruf und einem Neuanfang in ganz anderem Wirkungsbereich, im Anstellungsverhältnis oder in der Gründung eines Unternehmens.
Auch die deutlichen Veränderungen im Schulbesuch zeigte Helmut Schelhorn auf. Sie seien seiner Meinung nach ein Spiegelbild der Entwicklungen im ländlichen Raum. Klare Fakten hätten zu einer Minderung der Schulstandorte geführt. Bayreuth sei heute mit Münchberg ein gemeinsamer Schulstandort. Eine Auswertung der letzten Jahre habe ergeben, dass in Bayreuth nur noch rund die Hälfte der Studenten direkt aus dem eigenen Landkreis kommen. Die andere Hälfte kam aus zehn weiteren Landkreisen sowie aus drei Regierungsbezirken. Teilweise müssen sie täglich sehr weite Fahrstrecken zurücklegen, weil Schulinternate, so wie früher, leider nicht mehr bestünden.
Zur „Gärtner Johann Popp´schen Stiftung“, von der heute die Landwirtschaftsschule und das Grüne Zentrum in Bayreuth profitieren, sagte Helmut Schelhorn: „Bestimmt gibt es viele Stiftungen, die auf eine ältere Vergangenheit und auf einen größeren Finanzgrundstock aufbauen können, doch die Popp`sche Stiftung hat sich von Beginn an in Bescheidenheit entwickelt und daher den Stiftungszweck konstant auf Bildung am Standort Bayreuth ausgerichtet.“ So habe sie heute ein Vermögen erreicht, das ihr eine gute Perspektive für das nächste Jahrhundert im Grünen Zentrum in der Adolf-Wächter-Straße in Bayreuth bietet. Zu Zeiten ihrer Gründung war es das Ziel der Stiftung, bedürftige Junglandwirte bei ihrer Ausbildung zu unterstützen.
Beim Festakt in der Tierzuchtklause bestätigten die Grußworte des stellvertretenden Regierungspräsidenten Thomas Engel und des Bezirkstagspräsidenten Henry Schramm die wertvollen Leistungen der Stiftung für die Fachschulen sowie für die Schüler und Studenten am Standort Bayreuth. Beide Redner bezogen dabei auch Stellung zu den Bauernprotesten der zurückliegenden Wochen. Sie zeigten Verständnis dafür, dass die verursachenden politischen Entscheidungen eine Gegenreaktion in dieser Art verlangten. Diese Entscheidungen waren wohl der letzte Tropfen, die das Fass zum Überlaufen brachten. Daher sei es richtig, dass vieles im Miteinander mit der Landwirtschaft nun gründlichst hinterfragt wird und auch korrigiert oder angepasst werden muss.
Das Buch, bei dem Helmut Schelhorn als verantwortlicher Schriftleiter fungierte, wird kostenfrei an Interessierte abgegeben. Erhältlich ist es in vielen Gemeinden des Bayreuther Landkreises, im Landratsamt, beim Bezirk Oberfranken und in den Fachstellen im Grünen Zentrum, die auch als Sponsoren bei der Herausgabe geholfen haben.
Tumulte beim Scheßlitzer Bauerntag / Pfiffe und Buh-Rufe für SPD-Abgeordneten – Präsident Felßner ging mit der Bundesregierung scharf ins Gericht
Scheßlitz.
Tumulte und ein riesengroßer Andrang haben in diesem
Jahr den Scheßlitzer Bauerntag geprägt. Im Zentrum
der lautstarken Kritikstand der Bamberger
SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz. Erst im
zweiten Anlauf war es ihm gelungen, ein paar Worte
an die Landwirte in der Halle des TSV Scheßlitz zu
richten. Mit Pfiffen, Buh-Rufen und lärmenden
Instrumenten war ihm zuvor das Wort versagt worden.
Erst als Kreisobmann Tobias Kemmer seine
Berufskollegen aufforderte, Schwarz wenigstens
kurzzeitig zuzuhören, hatte sich die Situation für
einige Minuten beruhigt. Doch schnell wurde der
Abgeordnete wieder übertönt. „Die Ampel muss weg“,
skandierte die Halle.
Schon lange vor dem Beginn des Bauerntages waren an die hundert Traktoren mit Transparenten vorgefahren und hatten in Scheßlitz für Aufsehen gesorgt. In der Halle ging es dann drei Stunden lang hoch her. Die Zuhörer standen teilweise bis ins Freie und harrten bis zuletzt aus.
Er
sei sprachlos, so viele Leute habe er hier noch nie
gesehen, sagte der Bamberger Landrat Johann Kalb
(CSU). Er nannte es einen „riesengroßen Quatsch“,
wenn immer wieder erzählt werde, dass die
Bauerndemos unterwandert würden. „Die Bauern äußern
ihre Sorgen und das tun sie mit Recht“, so Johann
Kalb. Deutliche Worte fand auch der örtliche
CSU-Landtagsabgeordnete Holger Dremel. „Die Ampel
hätte können, doch sie wollte nicht“, sagte er unter
dem Jubel der Zuhörer.
Als dann Andreas Schwarz das Mikrophon ergriff, konnte er sich zunächst überhaupt nicht durchsetzen und trat frustriert den Rückzug zu seinem Sitzplatz an. Schwarz hatte mit seiner Partei für den Haushalt und damit auch für die Abschaffung der Agrardieselrückerstattung gestimmt. Schwarz nannte es dann im zweiten Anlauf es einen Erfolg, dass die grünen Nummernschilder bleiben. Damit hätten die Proteste doch Erfolg gehabt. Weiter sagte er: „Was sich hier aufstaut, ist die über Jahrzehnte verfehlte Landwirtschaftspolitik und nicht die Politik von zwei Jahren Ampel“. Bei den Zuhörern kam er damit nicht an, der Unmut wurde nur noch größer.
Ganz
im Gegensatz zu Florian Köhler, dem Bamberger
Landtagsabgeordneten der AfD. Er wurde mit großem
Beifall begrüßt und bekam sogar Zwischenapplaus.
Köhler ist von Beruf Hufschmid und gehört dem
Bauernverband als Mitglied an. „Ich ziehe meinen Hut
vor ihnen, denn sie halten dieses Land am Laufen“,
sagte er zu den Landwirten. Arbeit müsse sich wieder
lohnen und der Fleißige dürfe am Ende nicht der
Gelackmeierte sein.
Mit ungewöhnlich scharfen Worten ging schließlich Präsident Günther Felßner mit den Politikern der Ampel ins Gericht. „Wir Bauern haben schon vor 30 Jahren Photovoltaik auf die Dächer geschraubt, da hat der Kinderbuchautor noch gar nicht gewusst, was das ist“, sagte er mit Blick auf Wirtschaftsminister Habeck. Direkt zum SPD-Abgeordneten gerichtet sagte Felßner: „Sie haben absichtlich gegen uns gestimmt, da wäre mir jetzt eine ehrliche Aussage lieber.“ Die Abrechnung aber werde folgen, kündigte der Präsident an: „Wer uns nicht hilft, der wird auch nicht gewählt.“ Felßner kündigte auch an, die Proteste fortzusetzen: „Wir werden keinen Millimeter zurückweichen in Sachen Agrardiesel, bis wir entweder am Ziel sind oder die Verantwortlichen in die Wüste geschickt haben.“ Was die Bundesregierung macht, sei ein einziger Skandal, das würden sich die Bauern nicht gefallen lassen. Auf Bundeskanzler Scholz gemünzt sagte Günther Felßner schließlich: „Bei Versteckspiel war er der Beste, beim Memory der Schlechteste.“
Deutliche
Worte gab es im Anschluss auch aus der
Zuhörerschaft. Von einem Schlag ins Gesicht der
Landwirte war immer wieder die Rede. Noch einmal
musste Andreas Schwarz das Mikrofon ergreifen, als
er von einem jungen Landwirt gefragt wurde, warum er
gegen die Bauern gestimmt habe. Er könne nicht den
kompletten 467-Milliarden-Haushalt ablehnen, „da
stecken ja auch sehr viele gute Dinge drin“, sagte
der Parlamentarier und wieder machte sich der Unmut
der Zuhörerschaft lautstark Luft. Am Ende gab es
aber auch zaghaften Applaus für den SPD-Politiker,
als er bekannte: „Ich wusste was mich heute hier
erwartet, ich bin trotzdem gekommen.“ Vertreter der
anderen beiden Ampel-Parteien FDP und Grüne waren
nicht zum Scheßlitzer Bauerntag erschienen.
Bilder:
1. „Die
Ampel muss weg“ skandierten die Zuhörer lautstark
und taten ihren Unmut mit Plakaten kund.
2. Schwerer
Stand für den SPD-Bundestagsabgeordneten Andreas
Schwarz (am Mikrophon). Ihm lauschen (von links) die
Verbandsvertreter: Geschäftsführer Werner Nützel,
Bezirkspräsident Hermann Greif, Kreisbäuerin Marion
Link und Kreisobmann Tobias Kemmer.
3. Riesenandrang
beim Bauerntag in der Halle des TSV Scheßlitz.
4. Der
oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif,
Kreisbäuerin Marion Link, Geschäftsführer Werner
Nützel und der Bamberger Kreisobmann Tobias Kemmer
(von links) beim Scheßlitzer Bauerntag.
Fischotter bedroht Teichwirtschaft / Weniger Mitglieder, mehr Beutegreifer: Teichwirte fordern Schutzstatusveränderung
Himmelkron.
Die oberfränkischen Teichwirte bangen um ihre
Existenz. Hintergrund sind die massiven Vorkommnisse
des Fischotters in weiten Teilen des
Regierungsbezirks. „Wenn es so weitergeht ist
Oberfranken bald trocken und es wird keine
Teichwirtschaft mehr geben“, sagte Peter Thoma,
Vorsitzender der Teichgenossenschaft bei der
Mitgliederversammlung in Himmelkron.
Om östlichen Teil des Regierungsbezirks trete der Fischotter bereits flächendeckend in Erscheinung und fresse die Teiche leer, im westlichen Oberfranken sei er bereits weit verbreitet. „Der vollständige Zusammenbruch der Karpfenteichwirtschaft droht, sagte Peter Thoma. Wenn nicht sofort etwas passiert, dann sei es mit der Teichwirtschaft zu Ende.
Hintergrund ist, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof Ende November eine entsprechende Otterverordnung gekippt hatte. Damit gibt es auch keine Ausnahmegenehmigung mehr für die begrenzte „Entnahme“ des Fischotters in besonders betroffenen Gebieten. „Wir arbeiten derzeit an einer neuen Verordnung“, kündigte der örtliche Landtagsabgeordnete und Staatssekretär im Finanz- und Heimatministerium Martin Schöffel (CSU) an.
Schöffel forderte eine dringende Änderung, was den Schutzstatus des Fischotters betrifft. „Es kann nicht sein, dass der Otter eine heilige Kuh ist“, schimpfte Martin Schöffel. Auch er sprach von einer „katastrophalen Gefahr für die Teichwirtschaft. „Hoffentlich ist es noch nicht zu spät“, so der Staatssekretär, denn zu viele Teichwirte hätten bereits aufgegeben. Schließlich könne keiner vom Draufzahlen leben. Wenn Naturschützer allen Eernstes fordern, dass Teiche leer bleiben sollen, dann sei das Ende der heimischen Teichwirtschaft nicht mehr weit. Dann bleibe nur noch der Pangasius aus Fernost.
Tatsächlich haben schon viele Teichwirte aufgegeben. Das werde schon allein in der Tatsache deutlich, dass die Teichgenossenschaft mittlerweile nur mehr knapp 700 Mitglieder hat. Vor zehn Jahren seien es noch rund 1000 gewesen. „Der Verfall wird weitergehen, das können wir nicht aufhalten“, sagte Vorsitzender Peter Thoma. Freilich spiele dabei auch der demographische Wandel eine große Rolle. Junge Teichwirte kämen kaum nach. In Oberfranken werden fast alle Teiche im Nebenerwerb bewirtschaftet, die meisten Mitglieder sind Landwirte. Weitere Gründe für den Mitgliederschwund sind, dass es keine Zwangsmitgliedschaft gibt und dass für Förderanträge keine Mitgliedschaft mehr notwendig ist.
Es könne nicht sein, dass man die Schäden durch den Fischotter entstehen lässt und dann glaubt, man könne mit Schadensersatzzahlungen alles gut machen, sagte Peter Meyer, Leiter der Bezirksverwaltung. Zum einen werde ohnehin nur ein Teilschaden wirklich entschädigt, zum anderen würden viele Teichwirte ihre Schäden aufgrund der hohen bürokratischen Hürden gar nicht erst melden. In der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß versuche der Bezirk Oberfranken gerade, den Fischotter durch einen neuern Zaun fern zu halten. Bei der Größe des Geländes in Aufseß koste der Zaun rund 70000 Euro. Den Fischotter könne man dadurch vielleicht fernhalten, nicht aber Beutegreifer aus der Luft.
Auch sie spielten noch eine Roller, sagte Vorsitzender Peter Thoma. Insbesondere der vollständig geschützte Silberreiher halte momentan überall Einzug und habe etwa im Fichtelgebirge den Graureiher längst abgelöst. Ganz vom Tisch sei der Kormoran auch noch nicht. Zwar sei die Lager im östlichen Oberfranken relativ entspannt, doch im westlichen Regierungsbezirk gebe es noch immer entsprechende Vorkommnisse. Für Walter Jacob, dem Vorsitzenden der benachbarten Teichgenossenschaft Aischgrund, steht die gesamte Teichwirtschaft gerade zur Disposition. Genauso wenig, wie die Bundesregierung den Wert der Landwirtschaft kennt, kenne sie den Wert der Teichwirtschaft
Trotz aller Ärgernisse: Fisch liegt noch immer im Trend, so der Vorsitzende der oberpfälzischen ARGE Fisch Thomas Berr aus Tirschenreuth. Der Zusammenschluss wurde auf der Grünen Woche in Berlin gerade mit dem Deutschen Kulturlandschaftspreis ausgezeichnet. Thomas Berr gab zu bedenken, dass die Teichwirte für den Rückhalt des Wassers in der Fläche sorgen. Genau das werde vor dem Hintergrund der Klimaveränderungen und der niederschlagsarmen Sommermonate immer wichtiger.
Bild: Bald wid es keine Fische mehr aus heimischer Produktion geben: Die oberfränkischen Teichwirte befürchten, dass die Teichwirtschaft dem Fischotter weichen muss.
Digitalisierung und „Dorfbänkla“ / Landesbäuerin Christine Singer beim Bayreuther Landfrauentag: Plädoyer für mehr Miteinander
Bayreuth.
Der mangelnde Zusammenhalt in der Gesellschaft und
Lösungsansätze aus dem ländlichen Raum, damit
beschäftigen sich die Landfrauen im Bauernverband in
diesen Tagen. Beim gemeinsamen Bayreuther und
Pegnitzer Landfrauentag am Freitagnachmittag in der
Tierzuchtklause rief die bayerische Landesbäuerin
Christine Singer aus der Nähe von
Garmisch-Partenkirchen ihre Berufskolleginnen dazu
auf, wieder für mehr Abwechslung im Dorfleben zu
sorgen. „Raus aus der Eigenbrötlerei und wieder mehr
Miteinander“, das gab Christine Singer allen
Bäuerinnen mit auf den Weg.
Die Landesbäuerin verteidigte dabei auch die aktuellen Protestaktionen der Bauern und kündigte an, dass die Demonstrationen wohl weitergehen werden. „Wir versorgen die Gesellschaft mit Lebensmitteln und Energie, wir sorgen für Artenvielfalt, Lebens- und Erholungsräume“, so Christine Singer. Trotzdem fühlten sich die Bauern der aktuellen Bundesregierung nicht wertgeschätzt. „Deswegen sind wir draußen unterwegs“, sagte sie. So wie jetzt, könne es doch nicht weitergehen. Erzeugerkosten explodierten, die gesetzlichen Auflagen würden immer mehr, doch die Unterstützung für die Landwirte werde scheibchenweise zurückgefahren.
Dabei gehe es schon längst nicht mehr nur um den Agrardiesel. Es müsse stattdessen darum gehen, den Abbau von Bürokratie auf allen Ebenen zurückzufahren. Der Mittelstand, das Handwerk, die Gastronomen, eigentlich alle Steuerzahler stünden hinter den Landwirten. „Diesen Rückhalt und diese Akzeptanz dürfen wir nicht verlieren“, sagte Christine Singer und ermahnt ihre Berufskollegen, Kritik stets in angemessener Art und Weise vorzubringen.
Die Landesbäuerin bedauerte, dass die Ereignisse der zurückliegenden Jahre dazu beigetragen hätten, den Zusammenhalt unter den Menschen geringer werden zu lassen. Corona habe die sozialen Kontakte eingeschränkt, die Konflikte in der Ukraine und in Israel sorgten für Verunsicherung und die Inflation treibe die Angst vor wachsender Armut voran. Da habe man sich mit der Jogginghose auf dem heimischen Sofa eingerichtet, so Christine Singer. Der Wert den menschlichen Leben liege allerdings im Miteinander und gerade da könne der ländliche Raum mit seiner Vielfalt an Angeboten punkten.
Zuvor hatte die Bayreuther Kreisbäuerin Angelika Seyferth an alle Zuhörer appelliert, wieder mehr auf menschliches Miteinander, auf Beziehungen und auf gute Nachbarschaft zu setzen. Globale Wirtschaft und Digitalisierung prägen mittlerweile unser Zusammenleben, der Plausch beim „Dorfbänkla“ sei dabei auf der Strecke geblieben. Doch noch immer sei es der ländliche Raum, in dem das gemeinsame Leben hochgehalten werde, etwa in den Schulen, in der Kirche oder bei Dorffesten. Angelikas Seyferth rief dazu auf, immer auch an die Neubürger zu denken, sie einzubinden und sie über die Zusammenhänge in der Landwirtschaft aufzuklären. „Diese Wertschätzung und diese Anerkennung brauchen wir“, sagte die Kreisbäuerin.
Neben
zahlreichen Grußworten gehörte auch der Auftritt des
Bayreuther Landfrauenchors zu der
Traditionsveranstaltung, die immer an Maria
Lichtmess, einem in der Landwirtschaft bedeutendem
Datum stattfindet. Zuvor hatten Pfarrerin Stefanie
Kraus aus Glashütten und der katholische Dekan
Heinrich Hohl den Landfrauentag mit einer
ökumenischen Andacht eröffnet. Die beiden
Geistlichen hatten dabei den Psalm vom guten Hirten
in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen gestellt.
Bilder:
1. Der
Bayreuther Landfrauenchor umrahmte den Landfrauentag
in der Tierzuchtklause.
2. Kreisbäuerin
Angelika Seyferth (rechts) und ihre Stellvertreterin
Doris Schmidt (links) bedankten sich bei der
bayerischen Landesbäuerin Christine Singer für ihre
Teilnahme am Bayreuther Landfrauentag.
Bauernproteste: Behinderungen an der A9
Marktschorgast.
Die Landwirte machen ernst, auch in Kulmbach. Am
Mittwoch wurden bundesweit Autobahnanschlussstellen
blockiert. Der Landkreis Kulmbach kam dabei noch gut
weg. Zwischen 10 und 12 Uhr wurden jeweils beide
Autobahnauffahrten der Anschlussstellen
Marktschorgast und Thurnau-West blockiert. In
Nachbarlandkreisen, wie etwa in Bamberg Bayreuth
oder Hof, waren deutlich mehr Auffahrten betroffen.
In und um Marktschorgast gab es keinerlei Stauungen oder Zwischenfälle. Die meisten Autofahrer waren wohl informiert und hatten die Auffahrten von vornherein gemieden. Nur vereinzelt mussten Bauern und Polizisten Autofahrer, meist Pkw-Lenker, aufklären. Dabei zeigten die Betroffenen durchwegs Verständnis. „Die Bauern haben doch recht“, sagte einer, schließlich demonstrieren sie ja auch für uns. Es könne ja nicht angehen, dass alles noch teurer werde.
Allerdings
waren nach Marktschorgast nicht so viele Traktoren
gekommen, wie zunächst erhofft. Kurz nach 10 Uhr
waren dann aber doch 25 Schlepper, einige
Kleintransporter und Firmen-Pkw von Handwerkern und
sogar ein mit einem Transparent ausgestattetes Mofa
vor Ort. „Wir wollen doch nicht die Autofahrer
ärgern, sondern unsere Botschaft an den Mann
bringen“, stellte Martin Baumgärtner, einer der
beiden stellvertretenden Kreisobmänner des BBV
Kulmbach von Anfang an klar. Die Botschaft
formulierte er so: „Der Bundeshaushalt soll mit Geld
aus der Landwirtschaft gestopft werden und wir
Bauern werden mit den zusätzlichen Belastungen
alleingelassen.“ Martin Baumgärtner hatte allerdings
schon im Vorfeld geäußert, dass er wenig Hoffnung
auf ein Umdenken in Berlin habe.
Hintergrund
der Aktionen ist, dass am Mittwoch im Bundestag die
Generaldebatte zum Haushalt 2024 und damit auch die
Entscheidung zur Agrardiesel-Regelung stattfand.
Geht es nach der Bundesregierung, soll die
Rückvergütung beim Agrardiesel abgeschafft werden.
Bislang bekommen landwirtschaftliche Betriebe einen
Teil der Mineralölsteuer zurück, da Traktoren und
Maschinen überwiegend auf den Feldern und nicht auf
öffentlichen Straßen bewegt werden.
Während ein Großteil der Bevölkerung und viele andere Wirtschaftsbereiche wie Spediteure, Handwerker oder Gastronomen die Bauernproteste unterstützen und mit den Landwirten gemeinsam auf die Straße gehen, habe die Ampel auf stur geschaltet. Martin Baumgärtner stellte klar: „Unsere Aktionen sind ein Hilferuf: Diese Regierung setzt die Zukunft der heimischen Landwirtschaft aufs Spiel." Man hoffe, mit den Aktionen, den einen oder anderen Abgeordneten noch zu bewegen, um gegen den Haushalt zu stimmen, so Baumgärtner.
Um
Haushaltslöcher zu stopfen, wollte die
Ampel-Koalition ursprünglich neben der
Agrardiesel-Rückvergütung auch die
Kfz-Steuerbefreiung für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe abschaffen. Nach einer
ersten Protestwelle soll nun die Kfz-Steuerbefreiung
erhalten bleiben, der Agrardiesel jedoch
schrittweise bis 2026 abgeschafft werden. „Doch dann
sind wir ja genauso wieder bei Null“, erklärte einer
der Demonstranten in Marktschorgast. Deshalb müsse
der Agrardiesel bleiben. Der Bauernverband fordert
zudem, dass regionale Biokraftstoffe steuerbefreit
werden.
Martin Baumgärtner brachte auch noch einen anderen Aspekt ins Gespräch: Die Bundesregierung habe sich ja 30 Prozent Biolandwirtschaft in Deutschland auf ihre Fahnen geschrieben. Mit der Abschaffung des Agrardiesels erziele sie aber genau das Gegenteil, weil man als Biolandwirt mehr Diesel benötige als ein konventioneller Landwirt. Hintergrund ist, dass die biologische Bewirtschaftung auf Chemie verzichte, dafür aber die Bodenbearbeitung viel mehr mechanisch durchführen muss. „Das beginnt mit dem Pflügen und geht weiter mit Striegeln und Hacken. Dazu brauch ich den Schlepper, für den es keine alternative Treibstoffquelle gibt“, so Martin Baumgärtner, der selbst Biolandwirt ist.
Unweit
von Marktschorgast war auch die im Landkreis
Bayreuth gelegene Anschlussstelle Gefrees betroffen.
Der BBV-Kreisverband Bayreuth hatte neben den
Auffahrten Trockau, Pegnitz, Weidensees und Plech
auch Gefrees blockiert. Allerdings wurden dort kurze
Zeitfenster geschaffen, in denen die sich stauenden
Fahrzeuge auf die Autobahn auffahren konnten. Für
Auffahrten und nicht für Ausfahrten habe man sich
deshalb entschieden, um keinen Rückstau auf der
Autobahn zu riskieren. Im Landkreis Kulmbach habe
man bewusst einen Standort im Osten und einen im
Westen gewählt. Eigentlich habe man ursprünglich
Himmelkron dicht machen wollen, doch dort gebe es
einfach zu viel Verkehr. Das hätte so nicht
funktioniert, sagte Baumgärtner.
Wer es nicht auf die A70 geschafft hatte, der dürfte aber auch andernorts wenig Glück gehabt haben. Der BBV-Kreisverband Bamberg richtete zwischen 9.30 und 11 Uhr eine Vollsperrung der Auffahrten bei Roßdorf am Berg, sowie bei den Auffahrten Bamberg Hafen ein. Weitere Sperrungen gab es auf der A73 zwischen Breitengüßbach und Forchheim. Auch auf der A9 in Richtung Hof waren zahlreiche Auffahrten, unter anderem Münchberg-Süd, Naila und Rudolfstein zeitweise gesperrt.
Wichtig
war es für die Veranstalter festzuhalten, dass die
Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehren und
andere Hilfsorganisationen jederzeit möglich war und
dass die Polizei die Blockadeaktionen vor Ort
begleitet hat. Sämtliche Proteste waren von den
jeweiligen Landratsämtern genehmigt worden. Auf
gesamtbayerische Ebene wurde auch das
Innenministerium einbezogen.
Nun hoffen die Landwirte, dass zumindest der Bundesrat dagegen stimmt und die Entscheidung in den Vermittlungsausschuss muss. Dann müsse erneut der Bundestag über das Vermittlungsergebnis entscheiden. „Weitere Protestaktionen würde ich nicht ausschließen“, sagte Martin Baumgärtner.
Bilder: Blockadeaktion der Landwirte an der Anschlussstelle Marktschorgast.
Bauernproteste gehen weiter / Heute werden zwei Autobahnauffahrten im Landkreis blockiert
Kulmbach. Die Bauernproteste gehen weiter. Martin Baumgärtner, einer der beiden stellvertretenden BBV-Kreisobmänner kündigte am Dienstag an, dass er und seine Berufskollegen am Mittwoch für zwei Stunden die Aufobahnauffahrten Marktschorgast an der A9 und Thurnau-West an der A 70 blockieren werden, um ein Zeichen zu setzen. Hintergrund ist, dass am Mittwoch die entscheidende Abstimmung über die Zukunft es Agrardiesels im Bundestag und am Freitag im Bundesrat stattfinden werden. Zu den beiden Demonstrationen in Marktschorgast und Thurnau werden an die 100 Traktoren erwartet.
Viel Hoffnung hat Martin Baumgärtner nicht, dass sich noch etwas ändern werde, schließlich herrscht im Bundestag Fraktionszwang. Aufgeben kommt für die Bauern aber nicht in Frage. Der Protest gegen die Pläne der Bundesregierung, die Agrardiesel-Rückerstattung für landwirtschaftliche Fahrzeuge schrittweise zu streichen, ist Teil einer bayernweiten Aktion mit dem der Bauernverband seine Ankündigung wahrmacht, das angekündigte Aus für den Agrardiesel nicht auf sich beruhen zu lassen. Bayernweit sollen dazu Autobahnauffahrten außerhalb von Ballungsräumen blockiert werden. Die Aktionen finden im Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr statt, die beiden Auffahrten auf die Autobahnen, nicht die Ausfahrten) im Landkreis Kulmbach sollen aber nur zwischen 10 und 12 Uhr blockiert werden. Den Bauern ist es ganz wichtigh, klarzustellen, dass auf keinen Fall irgendwelche Rettungswege behindert werden. „Wir müssen die Menschen hinter uns behalten“, hatte der bayerische Bauernverbandspräsident Günter Felßner bereits am Montag erklärt.
Died Aktion ist mit dem Landratsamt und mit der Polizei abgesprochen, erklärte Martin Baumgärtner. Auf gesamtbayerische Ebene wurde auch das Innenministerium einbezogen. Auch er stellte klar, dass Rettungswege selbstverständlich frei bleiben werden. Die Schlepper würden dabei auch auf keinen Fall auf die Autobahn fahren. „Am blauen Schild ist Schluss“, so Martin Baumgärtner. Kommen tatsächlich 100 Schlepper, so würden sie im Umfeld der Auffahrten abgestellt. Für die direkte Blockade seien zehn bis 15 Schlepper notwendig. Ursprünglich hätte die Mittwochsaktion in Himmelkron stattfinde sollen. Martin Baumgärtner geht allerdings davon aus, dass dies nicht genehmigt worden wäre, da hochfrequentierte Auffahrten ausgespart werden sollen und im Falle eines Rückstaus auf der Bundesstraße B303 gefährliche Situation befürchtet wurden.
Wie berichtet war es am Samstagvormittag im Vorfeld der Großdemo in Bayreuth zu einer kurzzeitigen Blockade der A9 gekommen. Julia Küfner von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberfranken hatte von einer „äußerst gefährlichen Aktion, die weder genehmigt noch mit den Behörden abgesprochen war“ berichtet. Einer Pressemitteilung zufolge sei der Verkehr ab Gefrees in Richtung München mit insgesamt etwa 100 Fahrzeugen lahmgelegt worden. Mehrere Polizeistreifen hätten dieses Fahrmanöver bei Himmelkron beendet und die Personalien der verantwortlichen Lenker festgestellt.
„Das Wichtigste ist, dass wir unsere Botschaft vermitteln und nicht die Autofahrer ärgern wollen“, sagte Martin Baumgärtner. Neben dem eigentlichen Protest ist auch eine kurze Kundgebung direkt auf der Auffahrt geplant. In Marktschorgast wird Martin Baumgärtner sprechen, in Thurnau der Harald Unger, ebenfalls stellvertretender Kreisobmann.
Nur die Anpel fehlte: Bauernproteste auf zahlreiche weitere Branchen ausgeweitet / Zentrale oberfränkische Demonstration in Bayreuth – Politiker der Ampelparteien hatten ihre Teilnahme geschlossen verweigert
Bayreuth. Die
bisher größte oberfränkische Demonstration gegen die
Pläne der Bundesregierung, die Erstattung beim
Agrardiesel zu streichen, hat am Wochenende in
Bayreuth stattgefunden. 1500 Fahrzeuge nahmen nach
Angaben des Organisationsteams daran teil. Mehr als
3000 Menschen dürfte dier Demo auf die Straße
gelockt haben.
Der
unerwartet große Zuspruch hatte mehrere Gründe. Zum
einen nahem daran nicht nur Landwirte teil, sondern
auch Handwerker und Dienstleister, Verantwortliche
und Mitarbeiter aus dem Transportgewerbe sowie
zahlreiche Gastronomen. Selbst Privatleute hatten
sich in großen Scharen den Bauern angeschlossen.
Zweiter Grund war, dass es längst nicht mehr nur um
den Agrardiesel ging. Der Landesverband Bayerischer
Transport- und Logistikunternehmen hatte sich
beispielsweise unter anderem die Rücknahme der
LWK-Mauterhöhung auf die Fahnen geschrieben.
Gastronomen warben für die Wiedereinführung der
siebenprozentigen Mehrwertsteuer. Insgesamt mahnten
die Teilnehmer einen verantwortungsvollen Umgang mit
Steuergeldern an und äußerten ihre Sorge um die
Zukunft der deutschen Wettbewerbsfähigkeit.
Bürokratieabbau und mittelstandsfreundliche
Wirtschaftspolitik waren weitere Schlagworte, die
immer wieder zu hören waren. Viele Demonstranten
wurden direkter: „Die Ampel muss weg“. Mit diesen
vier Worten lassen sich die Aussagen der
allermeisten Teilnehmer zusammenfassen.
Bei
den Fahrzeugen dominierten freilich die Traktoren.
Sie alle waren im Rahmen einer Sternfahrt aus allen
Landkreisen Oberfrankens auf den Bayreuther
Volksfestplatz gekommen. Von dort aus machten sich
die Teilnehmer auf den rund eineinhalb Kilometer
langen Fußweg zum Marktplatz. Im Ehrenhof des Alten
Schlosses gab es dann eine über 90 Minuten dauernde
Kundgebung.
Lautstarke Pfiffe und Buhrufe gab es als Hauptorganisator Max Raimund bekannt gab, dass er von allen drei Ampelparteien Absagen erhalten hatte. Aus ganz Oberfranken sei kein einziger Politiker von SPD, FDP und Grünen bereit gewesen, zu den Demonstranten zu sprechen. Max Raimund war früher Bezirksvorsitzender der oberfränkischen Landjugend, kommt aus Creußen und ist mittlerweile selbst im Speditionsgewerbe tätig.
Neben
dem Bayreuther Kreisobmann Karl Lappe sprachen die
Bundestagsabgeordneten Silke Launert (CSU) und
Tobias Peterka (AfD), die Landtagsabgeordneten Franc
Dierl (CSU) und Stefan Frühbeißer (Freie Wähler),
der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (Freie
Wähler) und Christian Söllner, Geschäftsführender
Gesellschafter von Logistik Söllner aus Kleintettau
im Landkreis Kronach und Sprecher des
Landesverbandes der Transportunternehmer. Sie alle
erklärten sich solidarisch mit den Bauern und den
übrigen Unternehmern. „Es reicht“, war einer der
Sätze, die oft zu hören waren und weiter: „Die Ampel
fährt dieses Land an die Wand“.
„Nahrungsmittel
und Dienstleistungen braucht jeder, wir sind die
Leistungsträger, die dieses Land zusammenhalten“,
sagte Kreisobmann Karl Lappe. Er sprach sich dafür
aus, dass endlich wider Fachleute und Praktiker in
die Ministerien einziehen sollen. Die beabsichtigte
Tierwohlabgabe nannte er einen „Schmarrn“, weitere
Zertifizierungen seien nichts anderes als
Zusatzschikanen. Lappe: „Es kann doch nicht sein,
dass wir Bauern unsere Gummistiefel an den Nagel
hängen und die Spediteure ihre Lkw abmelden müssen.“
Ähnlich
argumentierten alle anderen Redner. Sie habe die
Hoffnung noch nicht aufgegeben, vielleicht gibt es
ja doch noch Neuwahlen, so MdB Silke Launert. Noch
eineinhalb Jahre könne man sich dier derzeitige
Politik, nicht mehr leisten, da gehe einfach zu viel
kaputt.An die Bauern richtete sie die dringende
Bitte: „Demonstriert weiter!“ In alle möglichen
Richtungen werde Geld ausgegeben, bemängelte MdL
Franc Dierl. „Doch wie es den Menschen vor Ort geht,
darauf schaut keiner.“ Dabei bemängelte er auch das
Bürgergeld: „Das ist der falsche Ansatz, wenn es
fürs Nichtstun staatliche Leistungen gibt.“
Durch
Verteuerungen erreiche man gar nichts, mache aber
alles kaputt, sagte MdL Stefan Frühbeißer. „Jeder
Politiker müsste in seinem Leben erst einmal etwas
ordentliches gearbeitet haben, bevor er in die
Politik geht, so Landrat Florian Wiedemann. „Das ist
der Anfang vom Ende des Mittelstandes“, rief
Christian Söllner von den Spediteuren ins Mikrofon
und auch MdB Tobias Peterka sprach ganz am Schluss
von einer wirtschafts- und bürgerfeindlichen Politik
der Ampelregierung. Zahlreiche Betriebe fürchten um
ihre Existenz, Arbeitnehmer um ihren Arbeitsplatz.
Bilder: Bauernprotest in Bayreuth: Nach einer Sternfahrt trafen sich Landwirte, Spediteure, Gastronomen, Handwerker, Diestleister zur zentralen oberfränkischen Großdemo in der Wagnerstadt.
Fragen – Antworten: Vorurteile über Bauern – und was dahintersteckt
Kulmbach. Kaum eine Branche polarisiert mehr als die Landwirtschaft. Am Stammtisch wird der Berufsstand für Gift im Trinkwasser ebenso verantwortlich gemacht wie für das Leid der Tiere oder die „Vermaisung“ der Landschaft. Stimmt das alles so wirklich? Wir fragten nach bei Martin Baumgärtner, Landwirt aus Unterzaubach
Landwirte
versuchen stets, ihre Felder auszudehnen. Mitunter
kommt es vor, dass im Laufe der Jahre sogar Wege
weggepflügt werden und verschwinden.
Wege werden nicht einfach umgepflügt. Da die Rechtslage von Wegen nicht immer einfach ist, wie zum Beispiel bei Anliegerwegen, kann es dazu führen, dass nicht mehr gebrauchte Wege wegen Grundstückszusammenführungen oder wegen Flurbereinigungen aufgelöst werden. Grundsätzlich wird versucht die Grundstücke optimal zu nutzen. Der Landwirt wird auch zum Teil durch das Fördersystem der EU dazu gezwungen. Zudem müssen die nicht bewirtschafteten Feldränder, besonders in der ökologischen Landbewirtschaftung, wegen dem Unkrautdruck, gepflegt werden. Dies bedeutet wiederum höhere Betriebsausgaben, die in den meisten Fällen der Landwirt selbst bezahlen muss. Gleichzeitig werden durch freiwillige Maßnahmen immer mehr großzügige Abstände zu den Grenzen eingehalten. Das funktioniert aber auch nur mit öffentlichen Geldern, vorwiegen von der EU und dem Freistaat Bayern. Die Aussage ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, gehört aber schon lange der Vergangenheit an.
Die Qualität des Grundwassers wird immer schlechter. Mitschuld daran haben die Landwirte, die zu viel Gülle ausbringen. Deshalb steigt der Nitratgehalt im Grundwasser.
Diese Hypothese ist nicht korrekt. Zum Ersten wird die Qualität des Grundwassers grundsätzlich nicht schlechter und zum Zweiten ist, falls eine Tiefenmessstelle schlechtere Zahlen aufweist, aktuell nicht die Landwirtschaft primär dafür verantwortlich. Es gibt eine Reihe an Verursachern, auch natürlicher Art wie zum Beispiel Stilllegungsflächen, die von einer Minderheit der Gesellschaft gefordert werden und politisch gewollt sind. Einen erheblichen Anteil haben auch die Kläranlagen. Hierbei muss man auch zunächst zwischen Oberflächenwasser und Grundwasserkörper unterscheiden. Bis das Oberflächenwasser mit Nitratgehalt im Grundwasserspiegel ankommt, kann es sehr lange, bis zum Teil Jahrzehnte dauern. In Regionen mit hohem Viehbesatz und gleichzeitig geringen Niederschlag hatte die Landwirtschaft in der Vergangenheit einen Anteil am gestiegenen Nitratgehalt. Das ist aber schon vor Jahrzehnten passiert. Allein aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird kein Landwirt den wertvollen Dünger ziellos auf den Flächen ausbringen, sondern maximal nur so viel, wie die Pflanzen zum Wachsen benötigen. Zum Teil wird die Landwirtschaft sogar gezwungen weniger Nährstoffe den Pflanzen zur Verfügung zu stellen, als sie benötigt.
Draußen in der Flur sieht man vor allem Maisplantagen und aufgeräumt wirkende Felder. Wo bleibt die Natur?
Ganz einfach, gehen Sie in die Gemarkung Zaubach mit einem der größten zusammenhängenden Heckengebiete Bayerns. Ohne Flurbereinigung und mit immer noch sehr kleinen Flächenstrukturen. Die Frage ist, wie lange noch? Die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen machen es der Landwirtschaft und besonders den kleinen Familienbetrieben sehr schwierig, diese Struktur noch zu erhalten. Besonders die aktuelle Bundesregierung und insbesondere die Grünen arbeiten mit aller Kraft daran, diese kleinen Strukturen mit den Familienbetrieben zu zerstören. Diese Kulturlandschaft, die von der Gesellschaft so geschätzt wird, muss auch gepflegt werden. Die Hecken sind im letzten Jahrhundert entstanden, weil die Landwirte durch die Bewirtschaftung der Ackerflächen ihre Steine auf dem Feldrand ablagerten. Dadurch ist die Heckenlandschaft überhaupt entstanden. Zum anderen gibt es bayernweit eine Vielzahl an Blühflächen mit Sonnenblumen, dazu viele freiwillige Maßnahmen. Weiterhin hat sich der Anteil an Maisflächen in Oberfranken während der letzten Jahrzenten nicht groß verändert. Gleichzeitig benötigen wir den Mais für den Klimaschutz. Der Mais ist eine sogenannte C4-Pflanze und produziert in der Nacht Sauerstoff. Wir müssten viel mehr Mais anbauen, um den Klimawandel entgegenzuwirken.
Landwirte
spritzen, was das Zeug hält: Pestizide, Herbizide
und Fungizide. Dies führt zum Insektensterben. Die
Artenvielfalt nimmt immer weiter ab.
Da kann ich nur lachen! Erstmal zur Hypothese und dessen Begrifflichkeiten. Pestizide ist nur ein anderes Wort für chemischen Pflanzenschutz. Inbegriffen sind die Herbizide, gegen Bei- und Unkräuter, dessen Ausbringen keinen nennenswerten Einfluss auf das Insektensterben haben kann. Fungizide sind gegen krankheitsübertragende und zerstörende Parasiten, aber auch Insekten. Ja, diese können einen Einfluss darauf haben. Wird aber auch nur dann angewendet, wenn die Pflanzen krank sind. Die Landwirtschaft schützt nur Ihre Pflanzen. Dass es dabei zu Zielkonflikten kommt, ist ganz normal. Bei fach- und sachgerechter Ausbringung werden weder die Artenvielfalt noch die gewünschten Insekten stark beeinflusst. Zum anderen sind die Wirkstoffe und auch die Vielzahl an Wirkstoffen stark zurückgegangen. Zudem haben die gestiegenen Preise dazu geführt, dass nur noch das Allernötigste ausgebracht wird. Die Landwirtschaft hat sich auch seit Jahrhunderten der Entwicklung angepasst. Nicht nur im biologischen Anbau wird jetzt immer mehr der mechanische Pflanzenschutz mit Striegel oder Hacke in den landwirtschaftlichen Betrieben angewandt. Und auch natürliche Feinde wie Marienkäfer oder Larven werden zum Schutz der Kulturpflanzen verwendet.
Landwirte jammern häufig über sinkende Preise. Auf der anderen Seite erhält kaum eine Branche derart hohe Subventionen aus Brüssel. Ist angesichts dessen, Jammern gerechtfertigt?
Jammern ist nie gut. Und ich würde diese Aussage auch nicht als Jammern bezeichnen, sondern als Warnruf und Hinweis, dass sich die landwirtschaftlichen Strukturen mit unseren Dörfern und Vereine weiterhin negativ verändern wird. Der hochgeschätzte und nach den Weltkriegen gewünschte Selbstversorgungsgrad der Ernährung beginnt schon lange zu wackeln. Einige Grundnahrungsmittel konnten wir noch nie hundertprozentig erzeugen, aber jetzt geht es um die Substanz. Deutschland wird bei der Ernährung in naher Zukunft so abhängig sein, wie wir aktuell bei Kinderhustensaft und Medikamenten, Halbleitern oder dem Strom. Mit der Förderung geht jeder Landwirt auch Bedingungen und Einschränkungen mit ein, an den er sich zusätzlich auch halten muss. Ohne diese Zahlungen würde nur noch eine sehr intensivierte landwirtschaftliche Produktion in den besten Standorten Deutschlands durchgeführt. Der andere Teil würde nicht mehr bewirtschaftet werden. Die Produktivität, der Umsatz und der Gewinn sind auch abhängig von der Lage der Böden und den Rahmenbedingungen vor Ort. Um eine flächendeckende Landbewirtschaftung mit der Pflege der Kulturlandschaft und dem verbundenen Tourismus in allen Gebieten von Bayern und Deutschland zu erhalten, sind öffentlichen Gelder notwendig.
Bauern verbringen heute fast mehr Zeit am Schreibtisch als am Traktor.
Das stimmt, zumindest hat man das Gefühl. Die Zeiten im Büro sind auf jeden Fall wesentlich länger geworden. Zum einen nimmt die Bürokratie, mit der verbundenen Dokumentation- und Aufzeichnungspflicht, immer mehr zu. Zum anderen braucht jeder landwirtschaftlicher Unternehmer auch die Zeit Betriebsabläufe zu planen, den Ein- und Verkauf zu steuern und Entscheidungen zu treffen.
Landwirte
ruinieren mit ihren immer größer werdenden
Fahrzeugen Straßen und Wege.
Kann man so auch nicht stehenlassen. Dass die Fahrzeuge sich gegenüber den Pferdegespanne und den Anfängen der Mechanisierung Anfang des 19. Jahrhunderts verändert haben, ist offensichtlich. Die maximalen Breiten, der landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte sind schon lange in Gesetzen definiert. Nur die dazugehörigen land- und forstwirtschaftlichen Feldwege haben sich zum Teil nicht mitentwickelt. Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass durch breitere und luftdrucksenkende Reifen der Bodendruck auf den Flächen erheblich reduziert werden kann und somit auch Erosion entgegengewirkt wird.
Landwirte rasen mit den Traktoren wie wild durch die Landschaft. Außerdem werden die Fahrzeuge immer größer.
Die Aussage ich viel zu pauschal formuliert. Nicht jeder der einen Autoführerschein hat ist gleichzeitig auch ein Raser. So wird es sicherlich auch Fahrzeugführer geben, die mit keiner angemessenen Geschwindigkeit Ihren Schlepper fahren. Dies ist die kleine Minderheit und wird auch immer mehr zur Ausnahme. Jeder der einen Führerschein hat muss mit seinem entsprechenden Fahrzeug, je nach Wetterlage und Situation seine Geschwindigkeit anpassen, unabhängig was gesetzlich vorgeschrieben ist. Besonders die jungen Fahrer werden von den landwirtschaftlichen Betriebsleitern immer wieder daran erinnert und gleichermaßen ermahnt, ihre Geschwindigkeiten anzupassen.
Landwirte und Tierwohl ist eine schwierige Beziehung, die der Staat regeln muss.
Völliger Blödsinn. Landwirte würden nie etwas tun, was ihren Tieren schaden würde. Ganz im Gegenteil. Erst werden die Tiere versorgt und sich darum gekümmert, erst dann kommt der Mensch dran. Jeder Landwirt leidet mit, wenn es einem seiner Tiere durch Krankheit einmal nicht gut geht. Neben der emotionalen Verbundenheit haben alle Landwirte eine hoch qualifizierte Ausbildung, bis zum Studium. Über Tierhaltung, Tierernährung und Tierwohl sind alle Landwirte am besten qualifiziert. Bevor der Staat die Beziehung zwischen Landwirt und seinen Tieren regelt, sollte er viel besser auf Haustierbesitzer achten. Teilweise unerträgliche Haltungsbedingungen von Hunden und Katzen, auf engsten Raum, sind vermehrt in den großen Städten zu finden. Jeder der ein Haustier besitzt, sollte davor eine ausführliche Schulung mit Prüfung ablegen. Ein letzter Punkt ist noch das Thema Tierwohl und der „Wolf“. Der Wolf zerfleischt die Schafe und Kälber ohne Betäubung erbarmungslos und qualvoll. Dies sollte der Staat unterbinden, wo bleibt hier das Tierwohl?
Zur Person:
2016 hatte Martin Baumgärtner den Bauernhof am Ortsrand von Unterzaubach von seinen Eltern übernommen. Damals mit 30 Kühen mit Nachzucht in Anbindehaltung. Seitdem ist viel geschehen. Er baute einen neuen Stall, stellte auf ökologische Bewirtschaftung um und betreibt heute Mutterkuhhaltung mit rund 70 Tieren. Martin Baumgärtner studierte in Triesdorf Landwirtschaft und war mehrere Jahre lang beim Bayerischen Bauernverband tätig. Anschließend war er Lehrer an den Landwirtschaftsschulen in Bayreuth und Münchberg. Martin Baumgärtner ist außerdem einer von zwei stellvertretenden Kreisobmännern im BBV-Kreisverband Kulmbach.
Proteste der Bauern gehen weiter – Am Sonntag: Mahnfeuer im gesamten Landkreis - Kulmbacher Bauern fahren nach Berlin
Kulmbach. Die Proteste der Bauern vom Montag gegen die Pläne der Bundesregierung, die Agrardiesel-Rückerstattung und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen, werten die Veranstalter als vollen Erfolg. Nach Angaben der Polizei haben daran oberfrankenweit rund 5600 Fahrzeuge mit zusammen über 7000 Menschen teilgenommen. Rund 1000 Personen haben sich allein an der „Landkreisrundfahrt“ in Kulmbach beteiligt.
Harald Köppel, der für Kulmbach zuständige Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes zog am Tag danach ein positives Fazit. Er kündigte bereits weitere Protestaktionen an, mit denen die Bauern in den kommenden Tagen an die Öffentlichkeit treten werden. So ist am kommenden Sonntag, 14. Januar, eine große Mahnfeueraktion geplant. Das heißt, dass die Bauern in vielen Orten des Landkreises Feuer entzünden werden, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. „Wir warten gerade noch auf entsprechende Rückmeldungen, gehen aber davon aus, dass im gesamten Landkreis flächendeckend Feuer geschürt werden“, so Harald Köppel.
Mit den Mahnfeuern sollen die Proteste weiterhin aufrechterhalten werden, um die Forderungen der Bauern gegenüber der Bundesregierung zu unterstreichen. Der BBV-Kreisverband Kulmbach hat die Mahnfeuer-Aktion entsprechend beim Landratsamt angemeldet, damit diese Versammlungen unter freien Himmel stattfinden können. Allerdings muss jeder Ortsverband, beziehungsweise jeder Landwirt, der ein Feuer entzündet, dieses Feuer noch bei der zuständigen Gemeinde anmelden.
Bereits zuvor beteiligen sich Landwirte aus Kulmbach und auch allen anderen oberfränkischen Landkreisen an der zentralen Großdemonstration am Freitag, 12. Januar, in Nürnberg. Auch von Kulmbach aus werden Schlepper zum Nürnberger Volksfestplatz fahren, kündigt der Geschäftsführer an. Die Kundgebung in Nürnberg startet um 11 Uhr, Anfahrt ist von 9 bis 10.30 Uhr. Die Veranstaltung soll laut Bauernverband rund zwei Stunden dauern. Die Landwirte werden dabei mit ihren Traktoren von mehreren Sammelpunkten aus zur Demo fahren. Mit der Polizei seien insgesamt sieben Anfahrtswege besprochen worden. Erwartet werden dem Bauernverband zufolge am Freitag in Nürnberg bis zu 10000 Besucher mit bis zu 5000 Fahrzeugen.
„Am Montag geht es dann nach Berlin“, sagt Harald Köppel. Die endgültigen Beschlüsse zur Zukunft der Agrardiesel-Rückerstattung und zur Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge erfolgen erst nach dem 15. Januar im Bundestag und Bundesrat. Deshalb wird es am 15. Januar die zweite deutschlandweite Großkundgebung der Bauern am Brandenburger Tor geben.
Eine erste derartige Großdemo hatte bereits kurz vor Weihnachten am 18. Dezember mit 10000 Bauern und 3000 Traktoren aus allen Regionen Deutschlands stattgefunden. Für die Aktion am 15. Januar seien von Oberfranken aus drei Reisebusse bereits ausgebucht. „Wenn mehr Anmeldungen kommen werden wir noch aufstocken.“ Mit dabei werden ebenfalls wieder viele Landwirte aus Kulmbach und der Region sein. Gemeinsames Ziel sei die vollständige Rücknahme aller Streichungspläne.
Proteste in Kulmbach Ein ganzer Landkreis im Zeichen der Landwirte / Bauern gehen auf die Barrikaden: „Was zu viel ist, ist zu viel“
Kulmbach.
Es war eine der größten Demonstrationen, die das
Kulmbacher Land je gesehen hat. Darin waren sich
Zaungäste wie Beteiligte einig. Die Proteste der
Bauern gegen die Pläne der Bundesregierung, die
Agrardiesel-Rückerstattung und die Steuerbefreiung
für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen,
haben am Montag fast 1000 Teilnehmer mit zusammen
400 Fahrzeugen auf die Straßen gebracht.
500 Teilnehmer mit rund 200 Fahrzeugen waren angekündigt worden, die doppelte Zahl dürfte leicht erreicht worden sein. „Was zu viel ist, ist zu viel! Jetzt ist Schluss“, lautete das Motto, mit dem der Bauernverband nach den Worten von Kreisobmann Harald Peetz die Berufskollegen zu der spektakulären Aktion aufgerufen hatte. Neben dem BBV hatte auch der Zusammenschluss Land schafft Verbindung (LsV) an die Bauern appelliert, sich an der Aktion zu beteiligen. Vertreter des Handwerks, der Gastronomie und von Speditionen beteiligten sich ebenfalls, denn auch sie sind von der Politik der Ampelregierung in Berlin in besonderer Weise negativ betroffen.
Die
Landwirte hatten sich an den drei Standorten
Himmelkron, Kasendorf und Zaubach getroffen und
waren dann zu der mehrstündigen Rundfahrt mit einer
Länge von exakt 96 Kilometern kreuz und quer durch
den Landkreis aufgebrochen. Nach einer kurzen
Unterweisung durch Kreisobmann Harald Peetz in
Himmelkron und spontanen Ansprachen der
Landtagsabgeordneten Rainer Ludwig (Freie Wähler)
und Martin Schöffel (CSU), der Himmelkroner
Bürgermeisters Gerhard Schneider, der Kreisbäuerin
Beate Opel und des Innungsmeisters der Bäcker Ralf
Groß startete dort der Konvoi mit einer
Geschwindigkeit von 15 bis 20 Stundenkilometern auf
die folgende Routen: Von Himmelkron aus über die
Bundesstraße B303 über Ludwigschorgast, Kupferberg,
Marktleugast, Guttenberg, Stadtsteinach, über die
Bundesstraße B85 nach Kulmbach in Richtung Mainleus
über Melkendorf bis Kasendorf und dann über Thurnau,
Hutschdorf wieder auf die B85 in Richtung
Neudrossenfeld und über Pechgraben, Harsdorf und
Trebgast zurück nach Himmelkron.
Die
Auflagen von Seiten des Landratsamtes waren streng:
Es durfte keine Kolonnenfahrt durchgeführt werden,
Überholen und Nebeneinanderfahren war auf
zweispurigen Abschnitten nicht erlaubt, das
vorsätzliche Herbeiführen von Blockaden war
verboten.
Wie sehr die Streichungspläne der Bundesregierung bei Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung die Bauern umtreiben machte Kreisobmann Peetz beim Start in Himmelkron deutlich: „Der Druck auf den Kessel ist groß“, sagte er. Peetz und seine Berufskollegen forderten die Ampel-Koalition auf, die Streichungspläne bei der Steuervergünstigung für Agrardiesel und bei der Kfz-Steuer-Befreiung von landwirtschaftlichen Maschinen zurückzunehmen. Außerdem sollten regionale Biokraftstoffe steuerbefreit werden, denn diese Kraftstoffe sind Teil der Lösung auf dem Weg zur Klimaneutralität.
„Die
Pläne der Bundesregierung müssen schleunigst vom
Tisch“, so der Kreisobmann. Peetz und seine
Berufskollegen appellierten an die
Bundestagsabgeordneten, vor allem der
Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen, sich
für Korrekturen bei den Beratungen ab Mitte Januar
einzusetzen. Ansonsten würden die Möglichkeiten der
heimischen Landwirtschaft als Teil der Lösung für
Ernährungssicherung, Klimaschutz, Bioökonomie und
Ressourcenschutz tiefgreifend beschädigt.
Nachdem die Ampel vor einigen Tagen ein wenig mit ihren Plänen zurückgerudert war, halten die Bauern allerdings weiterhin an ihren Protesten fest. „Kürzungen bei Landwirten müssen komplett vom Tisch“, lautete das Motto. So war am Donnerstagabend bekannt geworden, dass auf die Abschaffung der Begünstigung bei der Kraftfahrzeugsteuer für Forst- und Landwirtschaft verzichtet werden und die Rückvergütung der Energiesteuer für Agrardiesel schrittweise abgeschafft werden soll. Diese Korrekturen sind aus unserer Sicht nicht ausreichend, sagte Harald Peetz.
In
Himmelkron vor Ort war auch der Landtagsabgeordnete
Rainer Ludwig (Freie Wähler). Er unterstütze
vollumfänglich die friedlichen Demos und zeige sich
solidarisch mit den Landwirten, so Ludwig. Die
Subventionskürzungen beim Agrardiesel nannte er
alarmierend. Derartige Maßnahmen aus rein
dogmatischen Gründen seien in unserem
systemrelevanten Agrarbereich realitätsfremd, weder
praxistauglich noch verhältnismäßig, sondern völlig
überzogen und unverantwortlich. Rainer Ludwig: „Es
geht hier um die blanke Existenz einer ganzen
Berufsgruppe.“
Es
sei schlimm, dass es in Deutschland so weit kommen
musste, sagte Finanzstaatssekretär Martin Schöffel.
Dabei gehe es längst nicht mehr nur um die
Landwirtschaft. Deshalb seien auch Gastronomie,
Transport und Handwerk mit unterwegs. Sie alle
würden von der Bundesregierung unter Druck gesetzt.
An die Adresse der Bundesregierung gerichtet sagte
Schöffel, dass sie sich mehr darum kümmern sollte,
was für unser Land wichtig ist. „Wer arbeitet muss
auch mehr haben als der, der nicht arbeitet.“ Wer in
unser Land komme, der müsse auch arbeiten und dürfe
sich nicht auf ein immer weiter steigendes
Bürgergeld verlassen.
An den Protesten hatten sich auch Teile des Handwerks beteiligt. So bekundeten beispielsweise Bäcker und Metzger ihre Solidarität mit den Landwirten. Der Innungsmeister der Bäcker, Ralf Groß, sorgte mit seinem knallgelben Lieferwagen zwischen den Traktoren für Aufsehen. Er machte vor allem darauf aufmerksam, wie die Preise für Rohstoffe gestiegen seien und kritisierter Billigimporte aus dem Ausland. Der Protest der Lebensmittelhandwerker richtet sich in erster Linie gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent im Café- und Gastro-Bereich sowie gegen den Wegfall der Strom- und Gaspreisbremsen, gegen die Erhöhung der CO2-Abgabe. Spediteure protestierten gegen die neue LKW-Maut.
Am
meisten Applaus gab es bei der spontanen Kundgebung
für den Himmelkroner Bürgermeister Gerhard
Schneider. „Das Land steht auf und lässt sich nicht
mehr alles gefallen“, rief er mit lauter Stimme ins
Mikrofon. Das sei auch das Signal, das von
Himmelkron ausgehen müsse.
Zeitgleich zu den Protestaktionen in vielen Städten und Landkreisen Bayerns gab es zum Auftakt auch eine Großdemonstration in München. Weitere Demos sollen am Mittwoch in Augsburg und am Freitag in Nürnberg folgen. Am kommenden Montag wird dann zum Start der Bundestagsberatungen wieder in Berlin demonstriert.
Keine Krawalle und Blockaden: Sternrundfahrt der Bauern am Montagnachmittag / Agrardiesel-Rückerstattung und Kfz-Steuerbefreiung: Landwirte protestieren gegen Streichung
Kulmbach. Der kommende Montag, 8. Januar, steht im Landkreis Kulmbach ganz im Zeichen der Bauernproteste. Um gegen die Pläne der Bundesregierung, die Agrardiesel-Rückerstattung und die Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen, zu demonstrieren, veranstaltet der Bauernverband eine Sternfahrt kreuz und quer durch den gesamten Landkreis.
„Wir rechnen mit mindestens 100, eher mit 200 Schleppern und anderen landwirtschaftlichen Fahrzeugen“, sagt der stellvertretender Kreisobmann Martin Baumgärtner. Kreisobmann Harald Peetz stellt klar: „Nicht die Bevölkerung ist unser Gegner, sondern die Politik in Berlin.“ Trotzdem könne es zwischen 13 und 18 Uhr durchaus zu Behinderungen kommen.
Start und Ziel ist an drei Punkten: Am Sportplatz beim Landjugendheim in Zaubach, auf einem Feldweg in Heubsch bei Kasendorf und am Parkplatz der ehemaligen Diskothek Halifax in Himmelkron. Von den drei Punkten aus geht es über einen ausgeklügelten Rundkurs mehrere Stunden lang kreuz und quer durch den gesamten Landkreis, auch über die Bundesstraßen B85 und B303, die Nordumgehung wird tangiert und auch ein Schlenkerer durch die Stadt Kulmbach ist eingeplant.
Großen Wert legen die Verantwortlichen darauf, dass es eine friedliche Demo wird. „Wir wollen nichts blockieren“, stellt Kreisobmann Peetz klar. Kreisbäuerin Beate Opel ergänzt: „Wir wollen keine Krawalle machen, sondern das Ganze mit Niveau durchführen“. Blockaden vor Firmen oder Einkaufsmärkten oder gar der Autobahn werde es nicht geben. Das hat auch innerhalb des Berufsstandes schon zu Kritik geführt. Den Vorwurf einer „weichgespülten Aktion“ weist der Bauernverband aber klar von sich. Der Druck auf dem Kessel sei groß, Resignation mache sich breit. Den Rückhalt in der Bevölkerung möchte man deshalb auf keinen Fall verlieren. „Es ist wichtig, dass wir durchhalten“, sagt Kreisbäuerin Beate Opel.
Rückhalt haben die Bauern Auch bei Teilen des Handwerks, der Spediteure und anderen Berufsgruppen. Der Bauernverband geht davon aus, dass sich auch der eine oder andere Metzger, Bäcker oder Spediteur beteiligt. Auch der Maschinenring zeigt sich nach den Worten von Alexander Hollweg solidarisch und stellt seinen Mitgliedern frei, bei den Aktionen mitzumachen. „Wir sind voll auf Seiten der Landwirtschaft“, so Alexander Hollweg. Schließlich seien die meisten Mitglieder Bauern.
Schon jetzt habe der Berufsstand eine nahezu unglaubliche Stärke bewiesen. Schon einen Tag nach der Großdemo in Berlin habe es eine spektakuläre Sternfahrt in Kulmbach gegeben. „Zwischen den Jahren“ habe man mit Gummistiefeln an allen Ortsschildern den „stillen Protest“ geübt. Am dem kommenden Montag soll es dann ernst werden. Neben den Aktionen vor Ort wird es gleich vier Großdemos geben: am Montag in München, Mittwoch in Augsburg, Freitag in Nürnberg und am Montag, 15. Januar, erneut in Berlin. auch vor Ort werde es weitere Aktionen geben. Kündigte Harald Peetz an. Am Sonntag, 14. Januar, beispielsweise sollen mehrere Mahnfeuer im Landkreis veranstaltet werden.
Der Kreisobmann machte auch noch einmal den Unterschied zu den Demonstrationen anderer Berufsgruppen klar. „Uns geht es nicht um mehr Geld oder um eine Vier-Tage-Woche, uns geht es um unsere blanke Existenz.“ So befürchtet der Bauernverband zum einen, dass noch wesentlich mehr Betriebe aufhören werden als bisher. Zum anderen werden die Preise für regional erzeugte Lebensmitte drastisch teurer. Die Folge wäre noch mehr Importe von Lebensmitteln aus dem Ausland, wo es keinerlei Einfluss auf Produktionsbedingungen gebe.
„Wir werden nichtklein beigeben“, so Harald Peetz. Bislang habe sich die Politik keinen Millimeter bewegt. Peetz stellte aber auch klar, dass sämtliche Aktionen mit den Behörden abgesprochen seien und die Polizei die Rundfahrt begleiten werde. Das vorsätzliche Herbeiführen von Blockaden sei ausdrücklich verboten, heißt es in einem Schreiben, dass allen Teilnehmern der Demo vorliegt.
Entlastungen statt Steuererhöhungen / Handwerk und Gastronomie zeigen sich mit den Bauern solidarisch
Kulmbach. Zahlreiche Branchen beteiligen sich an der bundesweiten Aktionswoche der Landwirte vom 8. bis 15. Januar gegen die Pläne der Bundesregierung, den Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft zu streichen. So wollen sich auch Teile des Handwerks und der Gastronomie solidarisch mit den Bauern zeigen. Umfragen zufolge solidarisieren sich auch große Teile der Bevölkerung mit dem Anliegen der Landwirte. Aufgerufen zur Aktionswoche haben der Deutsche Bauernverband gemeinsam mit den Landesbauernverbänden und dem LsV-Deutschland (Land schafft Verbindung). In Bayern wird es zum Auftakt eine Großdemonstration in München geben. Weitere Demos gibt es in Augsburg und Nürnberg. Am 15. Januar, zum Start der Bundestagsberatungen, ist eine weitere Großdemonstration in Berlin geplant. Was sagen Handwerk und Gastronomie vor Ort?
„Offiziell geben wir keine Empfehlung, weil wir als Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Neutralität verpflichtet sind“, sagt Danny Dobmeier, Geschäftsführer der neu gegründeten und neben Bayreuth, Coburg und Lichtenfels auch für Kulmbach zuständigen Kreishandwerkerschaft Oberfranken Mitte. „Wir rufen nicht auf, haben aber vollstes Verständnis für die Demonstranten. Wir begleiten das wohlwollend“, so Dobmeier weiter. Es gebe auch einige Handwerker, die mit demonstrieren werden, sofern es ihnen die ohnehin knappe Zeit erlaubt. Man stehe in Kontakt mit dem jeweiligen Bauernverband vor Ort. Es stehe jedem frei, sich an den Aktionen zu beteiligen, schließlich seien viele Handwerker mit der aktuellen Politik „nicht ganz so zufrieden“.
Das große Problem sei vor allem die Unberechenbarkeit der Politik. So habe die aktuelle Politik unter anderem dazu geführt, dass der Neubau komplett erloschen sei. Dazu kämen die ganzen Unwägbarkeiten zum Thema Heizung. Während beispielsweise bis Ende 2022 noch Hackschnitzelanlagen gefördert worden seien, sollten Hackschnitzel zwischenzeitlich sogar mal verboten werden. „Die Planbarkeit ist komplett weg, alles wirkt diffus.“ Deshalb würden auch viele Betriebe geplante Investitionen erst einmal zurückhalten, weil sie einfach nicht wissen, was passieren soll.
Deutlicher wird Alexander Schütz, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes. Angesichts der Proteste der Landwirte erkläre sich der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband mit den Bauern solidarisch. „Wir können die Verzweiflung der Landwirte mehr als verstehen, denn auch bei ihnen geht es um eine Verteuerung ihrer Produktionsbedingungen“, so Alexander Schütz. „Schließlich sind auch wir im November in Berlin auf die Straße gegangen, um gegen die Mehrwertsteuererhöhung auf Speisen in Restaurants zu demonstrieren.“ Die Entscheidungen der Bundesregierung würden zu einer weiteren Preisexplosion im Alltag der Menschen führen. Alles werde mehr kosten. Zudem könne es doch nicht die Lösung sein, auf billige Importe von Nahrungsmitteln zu setzen, statt heimische Spezialitäten zu fördern, auch im Sinne der Nachhaltigkeit.
Die Leidtragenden der Steuererhöhungspolitik seien vor allem die Verbraucher, denn Lebensmittelproduzenten, wie die Bauern oder die Gastronomie, müssten die vom Staat produzierten Mehrkosten weitergeben, um überleben zu können. Das sei eine massive Verschlechterung der Lebensqualität von Millionen Menschen. „Regionalität ist pure Nachhaltigkeit. Warum zerstören SPD, FDP und Grüne durch massive Verteuerungen die regionalen Wertschöpfungsketten? Bauern, Wirte, Bäcker und Metzger sind die Gesichter unserer Dörfer und Städte. Der gesellschaftliche Schaden ist immens, wenn diese Strukturen wegfallen. Denn sie kommen nicht wieder. Wir brauchen Entlastungen statt Steuererhöhungen“, sagt Alexander Schütz
„Mein Vertrauen in die Bundesregierung ist erschüttert“, so der Vorsitzende, denn Olaf Scholz habe dem Gastgewerbe versprochen, dass es beim reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Speisen bleibe, Christian Lindner habe seine Unterstützung zugesichert. So gehandelt hat jedoch keiner der beiden.“ Genauso habe es geheißen, dass es keine Steuererhöhungen geben werde, nun würden bei den Landwirten, die unsere Lebensmittel produzieren, Subventionen gestrichen und neue Steuern eingeführt, was zum einen eine höhere Steuerlast bedeute, zum anderen auch eine Verteuerung in allen nachgelagerten Bereichen, so auch im Gastgewerbe, mit sich bringen werde. „Deswegen werden wir nach wie vor auf allen Ebenen weiter für die Mehrwertsteuerreduzierung kämpfen. Und anders als die Bauern, die auf öffentliche Aktionen angewiesen sind, um auf ihre Notlage aufmerksam zu machen, haben wir die Bevölkerung, und damit die Wähler, direkt an unseren Tischen.“
Mit Streiks haben die Gastwirte allerdings weniger am Hut: In den Sozialen Medien werde immer wieder zu einem „Generalstreik“ aufgerufen. Neben der Tatsache, dass die Gastwirte in der Pandemie für die Öffnung ihrer Betriebe gekämpft hätten und sie nun nicht wieder schließen sollten, würden solche Aktionen die Gäste eher abschrecken. „Wir verprellen damit doch unsere Gäste und nicht die Politik.“ Gerne könnten allerdings die Kollegen jederzeit vor Ort mit den lokalen Vertretern des Streiks Kontakt suchen oder Aktionen planen und umsetzen. Aus Sicht des Hotel- und Gaststättenverbandes wäre es natürlich auch wichtig, dass die Forderungen prominent von allen unterstützt werden.
Voller Steuersäckel, aber leere Teller / Kulmbacher Bauern protestierten gegen Bundesregierung – Keine Streichung des Agrardieselzuschusses und der Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Maschinen
Kulmbach.
Mit einer spektakulären Aktion haben Kulmbacher und
einige Kronacher Landwirte am Nachmittag gegen die
Pläne der Bundesregierung protestiert, den
Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für
landwirtschaftliche Fahrzeuge abzuschaffen. Sie
fuhren in kleinen Gruppen kreuz und quer durch die
Innenstadt. Zusätzlich stellten Vertreter der
Kreisvorstandschaft, darunter Kreisobmann Harald
Peetz, seine beiden Stellvertreter Harald Unger und
Martin Baumgärtner sowie die stellvertretende
Kreisbäuerin Gudrun Passing vor dem SPD-Parteibüro
sowie vor den Privatwohnungen von Magdalena Pröbstl
(Die Grünen) und Thomas Nagel (FDP) symbolisch alte
Gummistiefel ab und warfen drei gleichlautende
Schreiben mit den Forderungen des Bauernverbandes in
die Briefkästen.
Landwirte wären von der Einigung der Ampelkoalition im Streit über den Bundeshaushalt 2024 besonders und einseitig betroffen. Geht es nach den Spitzenvertretern von SPD, FDP und Grüne soll die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel und auch die Vergünstigung auf die Kraftfahrzeugsteuer für die Land- und Forstwirtschaft abgeschafft werden. Am 11. Januar soll eine Expertenanhörung stattfinden, ab 15. Januar sollen die Haushaltsberatungen im Bundestag beginnen. Wenn die Bundestagsabgeordneten von SPD, FDP und Grünen den Vorschlägen zustimmen, wären Zusatzbelastungen von 440 Millionen Euro beim Diesel und rund 480 Millionen Euro bei der Kfz-Steuer für deutschen Bauern die Folge.
„Unsere Abgeordneten dürfen der Abschaffung des Agrardiesels und der Einführung der Kfz-Steuer für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge keinesfalls zustimmen“, machte Kreisobmann Harald Peetz deutlich „Denn massive Kostensteigerungen für Landwirte sowie höhere Preise für Verbraucher wären die Folge. Klima- und umweltschädliche Billigimporte aus anderen Teilen der Welt drohen dann die regionale Ware zu verdrängen und die regionale Landwirtschaft zu zerstören. Dann ist zwar der Steuersäckel prall gefüllt, aber unsere Teller bleiben dann vielleicht irgendwann leer. Dazu kann und darf es nicht kommen“
„Die Not und die Betroffenheit bei sämtlichen Berufskollegen sind groß“, sagte Harald Peetz. Der Bauernverband sei gut aufgestellt und durchaus auch kampagnenfähig, so Peetz weiter. Das zeige schon allein die Tatsache, dass es innerhalb weniger Tage möglich gewesen sei, so viele Protestaktionen bis hin zur Großdemo am Montag in Berlin auf die Bein e zu stellen. Die Beschlüsse der letzten Tage haben das Fass zum Überlaufen gebracht“, so der Kreisobmann. ER bat die Basis der Ampelparteien inständig um Unterstützung, auf die Angeordneten einzuwirken, diese Beschlüsse nicht mitzutragen. Harald Peetz: „Ich kann mit nicht vorstellen, dass die Basis das Ende der bäuerlichen Landwirtschaft möchte.“
„Die Bundesregierung muss in Sachen Agrardiesel und Kfz-Steuer dringend zurückrudern und der Bund muss zudem Biokraftstoffe sofort von der Mineralölsteuer befreien“, hieß es von Seiten der Bauern. Die Landwirte hoffen nun, dass die Abgeordneten von SPD, FDP und Grünen für die nötigen Korrekturen sorgen – und die notwendigen Entlastungen für die Landwirtschaft in Deutschland so erhalten und im Sinne des Klimaschutzes weiterentwickelt werden können. Der Bayerische und der Deutsche Bauernverband hat bereits weitere Proteste und Aktionen angekündigt. „Wenn die Ampel die Beschlüsse nicht zurücknimmt, wird mehr Druck kommen“, sagte Harald Peetz. ER sagte aber auch, dass die Bauern jetzt erst einmal den Weihnachtsfrieden einhalten werden. „Im Januar geht es dann weiter.“
Von
einem „schweren Schlag für die Landwirte in Bayern“
sprach der örtliche Landtagsabgeordnete und
bayerische Finanzstaatssekretär Martin Schöffel.
Landwirte benötigten ihre Maschinen zur
Bewirtschaftung ihrer Felder und Wiesen. Diese
Tätigkeit sei aufwändig und werde durch die
Verkaufserlöse oft nicht vollständig gedeckt. „Eine
Steuervergünstigung bei der Mineralölsteuer ist
genauso gerechtfertigt wie bei der KFZ-Steuer für
Landwirte“, so Martin Schöffel.
Als inakzeptabel bezeichnete die Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner das Vorhaben der Ampel-Koalition Während der Staat Rekordsteuereinnahmen verbucht, belastet die Ampel die Bürger, aber auch die Wirtschaft mit neuen Steuern und hohen Energiepreisen. Der ländliche Raum leidet dabei besonders. Die Agrardiesel-Rückvergütung von aktuell 21,48 Cent pro Liter und die Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge schaffe die Ampel ab 2024 ab, um ihr Haushaltsloch aufzupolieren. Emmi Zeulner: „Das ist ein Schlag ins Gesicht für unsere Landwirte. Ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die tagtäglich, 24/7, bei Wind und Wetter dafür sorgen, dass bei uns etwas auf den Teller kommt, und die das Herzstück und Gesicht des ländlichen Raums sind.“
Von einem „erneuten Versagen der Ampel“ sprach der Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig (Freie Wähler). Die Kürzungen bei den Agrarsubventionen brächten viele Landwirte in Existenznot und belastetet die Verbraucher. Rainer Ludwig kritisiert in seiner Funktion als Mitglied des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag die jüngsten Entscheidungen der Bundesregierung scharf, insbesondere die Kürzungen bei den Agrarsubventionen im Rahmen der aktuellen Haushaltsverhandlungen. „Das dilettantische Vorgehen der Ampelkoalition hat nun einen neuen, traurigen Höhepunkt erreicht.“
Unterdessen meldete sich auch das oberfränkische Handwerk zu Wort und zeigte sich mit den Landwirten solidarisch. Die Bundesregierung konterkariere mit ihren einseitigen Sparplänen jahrelange Bemühungen um eine Stärkung der Regionalität und Nachhaltigkeit in der Lebensmittelversorgung, sagte der Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, Matthias Graßmann. „Die Belastungen der Betriebe und der Menschen steigt weiter. Allerdings ohne, dass es für den Haushalt 2024 wenigstens ein durchgängiges Konzept gäbe, das auch den Reformstau angehen würde, dessen Auflösung für die Wirtschaft und das Handwerk so wichtig wäre.“
Bilder:
1. In kleinen Gruppen fuhren Kulmbacher Landwirte
aus Protest gegen die Bundesregierung während der
Berufsverkehrszeit durch die Kulmbacher Innenstadt,
um die Bevölkerung auf die zusätzlichen Belastungen
für die Bauern aufmerksam zu machen.
2. Vor der Geschäftsstelle der SPD stellten
Kreisobmann Harald Peetz und
seine beiden Stellvertreter Harald Unger und Martin
Baumgärtner (von links) einige alte Gummistiefel
ab und warfen ein Schreiben mit den Forderungen des
Bauernverbandes in den Briefkasten.
Von Abba bis zum Kiem-Pauli / Weihnachts-CD des Hofer Landfrauenchor

Hof. Seit zwei Jahren ist sie schon auf dem Markt und hat sich seitdem zum wahren Renner entwickelt: die Weihnachts-CD des Hofer Landfrauenchors mit dem Titel „Es klingt vom Himmelszelt“. Zusammen mit der Instrumentalgruppe „SaitenKlar“ interpretieren die 32 Sängerinnen unter der Leitung von Helmut Lottes nicht nur traditionelle Weihnachtslieder, sondern auch echte Klassiker wie Luigi Cherubinis „Dona Pacem, Domine“ oder Cesar Francks „Panis Angelicus“, volkstümliches Liedgut wie „Jetzt kimt die heilig´ Weihnachtszeit“ aus der Sammlung des Kiem-Pauli oder Volksweisen aus Bolivien, Tschechien und Russland. Mit Leonard Cohens „Halleluja“ ist sogar ein moderner Ohrwurm dabei.
Beim Hofer Landfrauenchor handelt es sich um einen reinen Frauenchor, der seit vielen Jahren immer wieder bei eigenen Konzerten und Liederabenden aber auch bei Hochzeiten und Hoffesten auftritt. Zum Repertoire gehören moderne Chorsätze, Schlager und Operetten-Melodien sowie Volkslieder. Immer wieder wirkt der Zusammenschluss auch bei Kirchenkonzerten und Gottesdiensten mit.
2019 feierte der Hofer Landfrauenchor sein 30-jähriges Bestehen. Die Mitwirkenden, die zu den wöchentlichen Singstunden nach Konradsreuth kommen, stammen aus allen Teilen des Hofer Landkreises. Auch die frühere Hofer Kreisbäuerin Karin Wolfrum gehört dazu. Der Altersdurchschnitt liegt um die 50 Jahre, die jüngste Sängerin ist 30 Lenze jung. Markenzeichen des Chores ist die erneuerte bayrisch-vogtländische Tracht. Der Chor ist Mitglied im BBV aber auch im Sängerkreis Bayreuth.
Nach dem Erfolg der Weihnachts-CD haben sich der Hofer Landfrauenchor und die Instrumentalgruppe „SaitenKlar“ ein weiteres Projekt einfallen lassen. Eine weitere CD, die den Namen „Unsere Lieblingslieder“ trägt. Die Idee dazu ist während der Pandemie entstanden. Der Landfrauenchor probte zumindest außerhalb des Lockdowns jeden Mittwoch in der St.-Johannes-Kirche in Hof. Auftritte fehlten, und so kam man auf die Idee, das Einstudierte aufzunehmen.
Die Auswahl der Lieder sollte das gesamte Spektrum des Chores wiedergeben von Operette über Musical, Traditionelles und Schlager. Entsprechend fiel die Auswahl der 23 Lieblingslieder aus, um zu zeigen in wie vielen Genres sich die Sängerinnen zuhause fühlen. Da gibt es dann internationale Titel wie „Dancing Queen“ von Abba oder Andrew Lloyd Webbers „Memory“ aus dem Musical „Cats“. Auch deutschsprachiges ist dabei, etwa aus Peter Maffays „Tabaluga“ und sogar eine ganz eigene Version von Helene Fischers „Atemlos“ ist zu hören.
Die Stücke der Instrumentalgruppe, die die Liedfolge abrunden, sind fränkisch instrumentiert und traditionell im Klang. Nach den Aufnahmen in der Rehauer Apostelkirche war die CD unter den Händen des Musikproduzenten Heiner Wolf entstanden und mit Unterstützung der Stadt und des Landkreises Hof, des Bezirks Oberfranken, des Bauernverbandes und der VR Bak Bayreuth-Hof bereits vor gut einem Jahr veröffentlicht worden.
Vor Weihnachten haben der Chor und die Instrumentalgruppe „SaitenKlar“ noch mehrere Auftritte:
16. 12., 16 Uhr, Lippertsgrün, Kirche, Fränkische Weihnacht (Landfrauenchor),
17. 12. 19 Uhr, Döbra, Kirche (Landfrauenchor).
19.12., 19.30 Uhr, Weißenstadt, Kurzentrum, Musik, Lieder und Geschichten zur Adventszeit bei freiem Eintritt (Landfrauenchor und „SaitenKlar“),
Die CDs können bei Karin Wolfrum (09281/42769) bestellt werden, sie sind auch in der BBV-Geschäftsstelle im Grünen Zentrum in Münchberg.
Weitere Informationen: www.hofer-landfrauenchor.de.
Bild:Der Hofer Landfrauenchor tritt traditionell in der erneuerten bayerisch-vogtländischen Tracht auf. Foto: Hofer Landfrauenchor
Schlachthof steht weiter auf der Kippe / Im Sommer soll über die Zukunft des Traditionsbetriebes entschieden werden – Infoveranstaltung in Hallstadt
Hallstadt.
Am Ende der Informationsveranstaltung zur Zukunft
des Bamberger Schlachthofes brachte es Landwirt
Klaus Schneider auf den Punkt: „Da werden uns immer
irgendwelche Tierwohlgeschichten um die Ohren
gehauen. Jetzt, wo man wirklich mal etwas in Sachen
Tierschutz machen könnte, wird nur übers Geld
geredet“. Hintergrund ist, dass die Bauern ihr
Schlachtvieh bei einer Schließung des Schlachthofes
in der Domstadt im ungünstigsten Fall zu
Großschlachthöfen bis nach Ingolstadt, Crailsheim,
Altenburg in Thüringen oder Weißenfels in
Sachsen-Anhalt transportieren müssten. „Da stoßen
wir an unsere Grenzen“, sagte Dieter Heberlein von
der Hauptgeschäftsstelle des Bauernverbandes. Die
erlaubten Tiertransportzeiten könnten dann nur noch
schwer eingehalten werden.
Dieter Heberlein ist auch 2. Vorsitzender der eigens gegründeten Interessensgemeinschaft Schlachthof Bamberg. Sie hat nur ein Ziel: den über 120 Jahre alten Traditionsbetrieb in der Stadt zu erhalten. Dabei zeigte sich Heberlein durchaus optimistisch. Signale seien seitens des Bayerischen Wirtschaftsministeriums da, abseits der regulären Fördermittel. Die regulären Fördertöpfe greifen nicht, weil der Schlachthof seit 2020 als GmbH geführt wird, von der die Stadt 100 Prozent hält.
Investitionen in Höhe von mindestens rund fünf Millionen Euro wären notwendig, rechnete Schlachthof-Geschäftsführer Julian Müller vor. Unter anderem stünden die Erneuerung de Abwassertechnik, der Schlachttechnik, der Anlieferlogistik, der Betäubungsanlagen und vor allem die Schaffung eines erweiterten Emmissionsschutzes an. Auf die Stadt Bamberg könne man dabei nicht zählen, denn dort sei die Haushaltslage sehr schwierig, wie Wirtschaftsreferent Stefan Goller ausführte. „Wir machen uns das sicher nicht leicht“, sagte er. Doch allein im laufenden Jahr stünden Kreditaufnahmen in Höhe von 14 Millionen Euro an.
Aus den Reihen der Teilnehmer an der Infoveranstaltung wurde deshalb mehrfach der Ruf laut, den Landkreis Bamberg mit ins Boot zu holen. Schließlich sei doch auch der Landkreis der große Nutznießer des Schlachthofes. Im Stadtgebiet selbst gebe es keinen einzigen Rinder- oder Schweinehalter mehr.
Die drohende Schließung des Bamberger Schlachthofes konnte zuletzt mehrfach hinausgezögert werden. Unter anderem hatte die Interessensgemeinschaft 12000 Unterschriften gesammelt und an Oberbürgermeister Andreas Starke übergeben. „Das war ein klares Zeichen“, so Dieter Heberlein. Nun soll im Sommer 2024 eine endgültige Entscheidung fallen. In Schieflage geraten war der Schlachthof trotz guter Auslastung ab 2020/2021 aufgrund Corona und der damit verbundenen hohen Auflagen, wegen des Ukraine-Krieges, der explodierenden Energiekosten und der gestiegenen Löhne. Seit einigen Monaten laufe der Betrieb wieder stabil, sagte Wirtschaftsreferent Goller. „Allerdings ist der Schlachthof bei weitem nicht in der Lage, die notwendigen Investitionen zu stemmen. Da sind wir unweigerlich auf die Hilfe Dritter angewiesen.“
In der Diskussion wurde auch die Gründung eines Zweckverbandes angeregt, was aber nicht auf einhellige Zustimmung stieß. „Für alles ist Geld da, nur für de Ernährungssicherheit nicht“, schimpfte einer der Bauern und weiter: „Man sieht tatenlos zu, wie das Ding an die Wand gefahren wird“. Das ließen Wirtschaftsreferent Goller und Geschäftsführer Müller allerdings so nicht stehen. Allein in den Jahren 2013 bis 2021 seien rund zehn Millionen in den Schlachthof investiert worden.
Im Bamberger Schlachthof wird nur geschlachtet, nicht zerlegt. Nach den Worten von Geschäftsführer Müller werden derzeit zwischen 4500 und 6000 Schweine pro Woche und zwischen 800 und 1200 Rinder pro Woche geschlachtet.
Bild: Dieter Heberlein vom Bauernverband, Geschäftsführer Julian Müller und Wirtschaftsreferent Stefan Goller (von links) informierten über die Zukunft des Bamberger Schlachthofes.
Lichter der Hoffnung: Rekordbeteiligungen bei weihnachtlichen Traktorrundfahrten in Oberfranken
Bayreuth. Während die weihnachtliche Traktorparade in Bamberg aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde, verzeichneten die Landwirte in Kulmbach und Bayreuth diesmal jeweils Rekordbeteiligungen, sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Zuschauern. Über 40 aufwändig geschmückte Schlepper waren es in Kulmbach, über 60 in Bayreuth. Die Veranstalter sprachen jeweils von einem Publikumszuspruch, wie sie sich ihn nicht in den kühnsten Träumen hätten ausmalen können. Speziell in Bayreuth stand die halbe Stadt Kopf, die Zahl der Schaulustigen links und rechts der rund sechs Kilometer langen Strecke wurde von offizieller Seite auf über 1000 geschätzt.
Mit glitzerndem Weihnachtsschmuck und tausenden Lichter waren die Fahrzeuge ausgestattet. Neben den Traktoren waren auch einige Unimogs darunter. Viele transportierten Christbäume, bunte Sterne oder beleuchtete Schneemänner, die Fahrer hatten funkelnde Nikolausmützen auf, der Fantasie waren praktisch keine Grenzen gesetzt.
„Wir
wollen mit der Aktion Lichter der Hoffnung setzen“,
sagten die beiden Kulmbacher Hauptorganisatoren
Kathrin Erhardt aus Motschenbach und Stefan Seidel
aus Wacholder vom Zusammenschluss „Eure Kulmbacher
Landwirte“. Landwirtin Stefanie Will aus der Nähe
von Bindlach, die für die Fahrt in Bayreuth
zuständig war hatte 60 bis 70 Stunden gebraucht, um
ihrem John Deere zum Leuchten zu bringen. Allein an
ihrem Schlepper hatten die Lichterketten eine
Gesamtlänge von fast 100 Metern.
Nach der noch immer nachwirkenden Corona-Pandemie und den vielen schlechten Nachrichten über die Kriege in der Ukraine und in Nahost sowie die Inflation sei das auch bitter nötig. Für die Landwirtschaft war die Aktion aber auch wieder eine überaus gelungene Imagewerbung. „Wir wollten ein Stückweit die Landwirtschaft in die Stadt bringen und dabei eine weihnachtliche Atmosphäre schaffen“, so einer der Fahrer. „Wenn es uns dabei gelingt, dass der eine oder andere etwas intensiver über die heimischen Bauern nachdenkt, dann haben wir unser Ziel schon erreicht“, sagte sein Berufskollege.
Die
Landwirte brachten dabei nicht nur Kinderaugen zum
Funkeln. Obwohl kaum Werbung für die Rundfahrt
gemacht wurde und die nasskalte Witterung nicht
gerade einladend war, säumten die vielen
Schaulustigen sowohl in Bayreuth als auch in
Kulmbach schon lange vor dem Start die Straßen und
ließen sich von der außergewöhnlichen Aktion
verzaubern. Bis aus Nürnberg oder Neustadt an der
Waldnaab waren die Zuschauer angereist. Politische
Banner gab es nicht. Bei den Fahrten wurde aber Geld
für karitative Zwecke gesammelt.
In Kulmbach war der Traktorkorso am Milchviehbetrieb von Hermann Grampp in Melkendorf gestartet. In Bayreuth ging es im Vorort Heinersreuth los, Polizei und Feuerwehr sicherten dabei jeweils den Konvoi ab. Nach den Fahrten kreuz und quer durch die Innenstädte, machten die Schlepper in Kulmbach auf dem Parkplatz des Schwimmbades, in Bayreuth auf dem Volksfestplatz halt. Dort gab es die Gelegenheit, die Fahrzeuge zu fotografieren, mit den Bauern ins Gespräch zu kommen und den Nikolaus höchstpersönlich zu treffen. Außerdem gab es Glühwein, Früchtepunsch, Tee, Küchla, selbstgebackene Plätzchen und Bratwürste für einen guten Zweck. Für Stimmung sorgte eine Samba-Formation mit ihren Trommeln. Die Spenden sollen demnächst überreicht werden, in Kulmbach an das Kinderhaus der Geschwister-Gummi-Stiftung, in Bayreuth an das Hospizmobil „Herzenswunsch“ des Bayerischen Roten Kreuzes.
Während
in Bayreuth und Kulmbach die Zusammenarbeit mit
Stadt, beziehungsweise Landratsamt, mit Polizei und
den Feuerwehren hervorragend funktioniert hat, gab
es in Bamberg Probleme. Aufgrund zu hoher
Sicherheitsauflagen sagten die Veranstalter schon
einige Tage zuvor komplett ab. Unter anderem hätten
die Landwirte 100 Sicherheitskräfte stellen sollen.
Für Ärger sorgte in Bayreuth auch ein Leserbrief in der lokalen Zeitung. Darin versuchte eine Leserin aus dem Fichtelgebirge Stimmung gegen die Aktion zu machen. Sie schrieb von einem „Monster-Traktoren-Theater“, prangerte die angebliche Umweltbelastung an, fand den Plastikschmuck grässlich und vermutete eine Verschwendung von Steuergeldern. Die über 1000 Schaulustigen ließen sich davon aber nicht beirren.
Bilder: Einen vorweihnachtlichen Glanzpunkt setzten zahlreiche Landwirte mit ihren Traktorrundfahrten am zweiten Adventssamstag in Bayreuth. Sämtliche Schlepper waren dabei fantasievoll geschmückt und festlich beleuchtet.
Freund oder Feind: Der Biber im Kulmbacher Land / Pro und Contra Biber im Landkreis Kulmbach
 Kulmbach.
Der Biber macht den oberfränkischen Teichwirten seit
Jahren zu schaffen. Mancherorts sind die
Biberschäden auch für den Laien deutlich zu sehen.
Etwa, wenn der Biber an einem Uferstreifen Bäume
gefällt hat, die dann im Wasser liegen. Von den
Stämmen unter der Wasseroberfläche nagt der Biber
dann die Rinde ab.
Kulmbach.
Der Biber macht den oberfränkischen Teichwirten seit
Jahren zu schaffen. Mancherorts sind die
Biberschäden auch für den Laien deutlich zu sehen.
Etwa, wenn der Biber an einem Uferstreifen Bäume
gefällt hat, die dann im Wasser liegen. Von den
Stämmen unter der Wasseroberfläche nagt der Biber
dann die Rinde ab.
Den Teichwirten geht es allerdings nicht um die Schäden an den Gehölzen, sondern um die Dämme, die der Biber aufstaut und um die unterirdischen Ausbuchtungen, die ringsum Wege untergraben und die immer wieder große Schäden anrichten. In der Haftung ist der Teichwirt, denn er hat eine Sicherungspflicht für den gesamten Uferbereich. Doch wovon soll er teure Reparaturen bezahlen, etwas dann, wenn aufwändige Baggerarbeiten notwendig werden?
Ein weiteres Problem ist, dass der Biber die Karpfen aus der Winterruhe treibt. Die Fische leiden dann unter einem Energiemangelsyndrom. Das bedeute, dass der Fisch dann im Frühjahr keine Energie mehr besitzt und im weiteren Verlauf daran zu Grunde gehen kann.
Insgesamt polarisiert der Biber durch seine Bautätigkeiten, die schnell mal einem Landwirt zum Verhängnis werden können. So könne beispielsweise ein Erdbau gefährlich werden, wenn der Bauer mit dem Schlepper drüber fährt und einbricht. Ähnliche Konflikte treten seit Mitte der 1980er Jahre auch im Bereich der Forst- und der Wasserwirtschaft auf. Dazu gehört, dass der Biber als strenger Vegetarier sämtliche Feldfrüchte vom Getreide über Mais bis zu Zuckerrüben frisst,.
„Der Biber ist nach wie vor da und macht seine Schäden“, sagt Harald Köppel, Geschäftsführer des Bauernverbandes in Kulmbach. Die geschädigten Landwirte seien mittlerweile aber sehr frustriert, weil bei gemeldeten Biberschäden fast nichts herauskommt. Viele Landwirte seien mittlerweile schon so weit, dass sie gar keinen Schaden mehr anmelden, weil der Zeitaufwand in kaum einenm Verhältnis zum Ergebnis steht. So sei es kein Wunder, dass die Biberschäden in den Statistiken weniger werden, obwohl sie unverändert da sind.
Ein
großes Problem sei es auch, dass der geschädigte
Landwirt aus dem Biberfonds des Freistaates im
besten Fall nur 70 Prozent des Schadens ersetzt
bekommt. Dazu müsse man wissen, dass der Biberfonds
gedeckelt ist, werden mehr Schäden bei der Unteren
Naturschutzbehörde angemeldet, gibt es sogar noch
weniger als 70 Prozent. „Das ganze behördliche
Verfahren hat die Leute so mürbe gemacht, dass kaum
noch Biberschäden gemeldet werden, obwohl es sie
nach wie vor gibt und bestimmt auch nicht weniger
werden.“
Mittlerweile sei jedes Rinnsal von einem Biber besetzt. In der Fränkischen Schweiz beispielsweise gebe es bereits Rangkämpfe unter den Bibern um die Reviere. Weil es so viele Biber gibt, seien die guten Lebensräume weg. Jeder Biber habe sein Gebiet. Dazu müsse man auch wissen, dass der Biber keine natürlichen Feinde hat, „vom Wolf einmal abgesehen“. Dort wo der Wolf unterwegs sei, gebe es auch keine Biberprobleme.
Gegen den Biber könne man nichts unternehmen, denn er ist nach wie vor streng geschützt. Harald Köppel rechnet auch nicht damit, dass sich am Schutzstatus etwas ändert. Die „Entnahme“ bei konkreten Schäden sei zwar möglich, werde in der Praxis aber eher weniger angewandt. Erst wenn der Biber mal wieder einen Strommasten fällt und eine ganze Gemeinde ohne Strom ist, werde die Biberproblematik wohl wieder akut, so der BBV-Geschäftsführer.
Es gibt Schäden, sagt auch Hans-Joachim Küfner, einer der ehrenamtlichen Biberberater im Landkreis Kulmbach. Nachdem allerdings die Teichwirtschaft im Landkreis unterdimensioniert sei, spiele der Biber, was relevante Schäden bei Teichwirten betrifft, kaum eine Rolle. Schäden gebe es immer wieder mal bei Privatleuten, wo beispielsweise ein Apfelbaum angenagt, eine Thuja-Hecke angeknabbert oder eine Uferböschung unterhöhlt wird. Im Verhältnis zu anderen Landkreisen wie etwa Bayreuth oder gar in Unterfranken komme Kulmbach gut weg. Über die Zahl de Biberreviere gebe es keine Erhebungen. Hans-Joachim Küfner gibt auch zu bedenken, dass nicht jeder Bau zu sehen ist.
Das Bibermanagement habe sich auf jeden Fall bewährt. Es sei schon gelungen, einen Konsens zwischen Natur und Bevölkerung zu schaffen. Hans-Joachim Küfner geht sogar so weit, zu sagen, dass es in Stadt und Landkreis Kulmbach eine gewisse Lobby für den Biber gibt. “Die Leute sind eigentlich pro Biber eingestellt.“ Eine gekappte Stromleitung durch einen vom Biber gefällten Baum sei zwar unangenehm und ärgerlich, könne aber genauso gut auch durch einen Sturm verursacht werden. Man mache kein Feindbild aus dem Biber. Der Biberberater sagt aber auch: „Die Schäden, die da sind, die werden auch weiterhin da sein.“ Der Biber werde vielleicht mehr sichtbar, beispielsweise durch angeknabberte Weiden, aber das seien keine Schäden im klassischen Sinn.
Bilder:
1. Diesen Biber hat Hans Joachim Küfner vor wenigen
Tagen bei Melkendorf selbst fotografiert.
Foto: Hans Joachim Küfner
2. So sehen Biberburgen aus. Das Bild entstand im
zurückliegenden Winter im Nachbarlandkreis Kronach.
„Dann ist der Ärger auf Jahre festgeschrieben“ / Ohne Entnahmen würde sich die Biberpopulation jährlich nahezu verdoppeln - Interview mit Edwin Hartmann aus Waldau
Waldau. Autofahrer, die auf der A70 kurz nach der Auffahrt Kulmbach/Neudrossenfeld in Richtung Bayreuth unterwegs sind, haben die Teichanlagen von Edwin Hartmann mit Sicherheit schon einmal gesehen. Sie befinden sich unmittelbar neben der Autobahn. Kaum zu glauben, dass auch dort der Biber schon einmal immense Schäden angerichtet hat. Wir haben mit dem Teichwirt gesprochen:
.jpg) Herr
Hartmann, Sie hatten selbst schon mal einen
Biberschaden?
Herr
Hartmann, Sie hatten selbst schon mal einen
Biberschaden?
Ja, ich hatte selbst auch schon Biberschäden in meiner Teichanlage. Mit achtzehn bis zu sechs Meter langen Biberröhren und mehreren Biberhöhlen war 2018 der Damm eines Teiches vollständig zerstört. Mit dem Bagger wurde der Damm wieder instandgesetzt. Der entstandene Kostenaufwand wurde mit etwa siebzig Prozent entschädigt. Vom Landratsamt Kulmbach erhielt der Jagdpächter daraufhin eine Genehmigung zur Biberentnahme. Außerdem wurde meine Teichanlage als biberfreier Bereich definiert.
Welche Rolle spielt der Biber im Landkreis Kulmbach?
Im Landkreis Kulmbach, ebenso wie in ganz Oberfranken, verursacht der Biber flächendeckend Schäden. Aufgestaute Bäche, gefällte Bäume, überflutete Wiesen und beschädigte Teichanlagen findet man vielerorts.
Wo siedelt er sich hauptsächlich an, am Roten Main, am Weißen Main oder eher in den Seitengewässer?
Bleibt der Biber weitgehend ungestört, dann siedelt er sich an allen Gewässern mit vorhandenem Bewuchs an.
Hat sich das Bibermanagement Ihrer Meinung nach bewährt?
Das Bibermanagement hat sich insoweit bewährt, dass jetzt die Entnahme von Bibern, mit entsprechendem Nachdruck, genehmigt wird. Die anfänglich nur beschwichtigenden Reden der Biberberater haben sich der Realität angepasst. Vom Landratsamt Bayreuth wurden diesbezüglich auch Pauschalgenehmigungen für fünf Jahre erteilt. Das Landratsamt Kulmbach erteilt Abschussgenehmigungen nur fallbezogen.
.jpg) Werden
Biberschäden ihrer Meinung nach eher noch zunehmen?
Werden
Biberschäden ihrer Meinung nach eher noch zunehmen?
Ohne bestandsregulierende Faktoren würde sich die Biberpopulation jährlich nahezu verdoppeln. Nur durch den Straßenverkehr und durch gezielte Entnahmen wird dies verhindert. Der Biber besiedelt bereits jetzt eher ungeeignete Bereiche wie kleine Bäuche und überschaubare Teichanlagen. Auch Teichkläranlagen werden in Mitleidenschaft gezogen und es entstehen hohe Instandsetzungskosten.
Der Biber fällt unter das Naturschutzrecht, was kann der betroffene Landwirt, beziehungsweise der Teichwirt machen?
Bedingt durch den stringenten Schutzstatus sind betroffene Landwirte und Teichwirte auf die Nachsicht der unteren Naturschutzbehörden angewiesen. Schäden sind frühzeitig zu melden und Maßnahmen müssen mit Nachdruck eingefordert werden.
Gibt es Schadensausgleich?
Es gibt die Möglichkeit Schadensausgleich zu beantragen. Entschädigt werden aber nur Schäden, welche betriebswirtschaftliche Auswirkungen haben. Freizeit angeln und Hobbyteichwirtschaft fallen nicht darunter. Auch Bäume werden nur entschädigt, wenn ein forstwirtschaftlicher Schaden vorliegt. Aufgrund der begrenzten Finanzmittel wird die Schadensregulierung dem Schadensaufkommen entsprechend gekürzt.
Was passiert, wenn der grundsätzliche Schutzstatus des Bibers nicht geändert wird?
Dann ist der aktuelle Ärger auf Jahre festgeschrieben. Hier zwei Beispiele: Bei der Zoltmühle, nahe Pechgraben konnten nach genehmigter Entnahme sechs Biber geschossen werden. Jetzt nach zwei Jahren haben sich schon wieder Biber angesiedelt und mit den einhergehenden Schäden wird ein erneutes Eingreifen erforderlich. In der Trebgast bei Fohlenhof wurden Anfang des Jahres Biberdämme entfernt und aktuell sind die angrenzenden Wiesen schon wieder überflutet. Es zeigt sich, Schadensbeseitigung ohne einhergehende Biberentnahme sind hinausgeworfenes Geld.
Zur Person:
Edwin Hartmann (67) aus Waldau betreibt Land-, Forst-, und Teichwirtschaft im Nebenerwerb zusammen mit seiner Familie. Sein Lebensmittel sind die Karpfen, die in den vier eigenen Teichen am Ortsrand des Neudrossenfelder Gemeindeteils Waldau heranreifen. Vermarktet werden sie im Wesentlichen über die für ihre Fischspezialitäten weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannte und bereits mehrfach ausgezeichnete Gaststätte Fuchs direkt in der Nachbarschaft der Familie Hartmann. Noch kürzer können Transportwege kaum ausfallen, liegen doch zwischen Teich und Wirtshaus nicht einmal 500 Meter Luftlinie. Hauptamtlich war Edwin Hartmann bei der Telekom in Bayreuth tätig. Die eigene Teichanlage besteht aus vier Karpfenweihern mit einer Gesamtwasserfläche eines Hektars. Der erste Teich wurde bereits 1982 gebaut und bereits mehrfach erweitert. 1990 und in den Jahren 2019 und 2020 entstanden die weiteren drei Weiher.
Bilder:
1. Einen seiner
kleineren Teiche hat Edwin Hartmann im Herbst
abgelassen.
2. Das ist der größte der vier Teiche, die Edwin
Hartmann am Ortsrand von Waldau bewirtschaftet.
Traktorkorso für den guten Zweck / Weihnachtlich geschmückte Schlepper werden am 8. Dezember wieder durch die Stadt rollen
Kulmbach.
Die Lichterketten liegen bereit, die Tannenzweige
werden gerade hergerichtet und die LEDs werden noch
einmal überprüft: Nachdem die weihnachtlichen
Traktorkorsos in den vergangenen Jahren auf
unerwartet großen Anklang gestoßen waren, haben sich
auch in diesem Jahr Landwirte aus Kulmbach und
Umgebung zusammengetan, um am Freitag vor dem 2.
Advent eine spektakuläre Rundfahrt durch Kulmbach zu
starten.
„Wir waren im zurückliegenden Jahr vom riesigen Zuspruch der Bevölkerung völlig überwältigt“, sind sich die beiden Organisatoren Kathrin Erhardt (30) aus Motschenbach und Stefan Seidel (32) aus Wacholder einig. Mit bis zu 25 Berufskollegen haben die beiden den Zusammenschluss mit dem Namen „Eure Kulmbacher Landwirte“ gegründet. „Es ist einfach eine schöne Sache“, so Kathrin Erhardt. Ihre kleine Tochter könne es schon jetzt kaum mehr erwarten, dass es endlich losgeht.
Der Traktorkorso durch die Stadt hat natürlich auch ernste Gründe. Zum einen möchten die Landwirte ihr völlig zu Unrecht bestehendes Image ein wenig aufpolieren und Werbung für die Bauern vor Ort machen. „Wir suchen den Dialog zum Verbraucher, wollen mit den Menschen auf Augenhöhe kommunizieren und uns für den Zuspruch bedanken“, sagt Stefan Seidel. Zum anderen sollen Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Das Geld aus dem Verkauf von Glühwein, den selbstgebackenen Plätzchen und den Süßigkeiten, die zum einen vom Ring junger Landfrauen und zum andern vom REWE-Markt Hollweg großzügig zur Verfügung gestellt wurden, wird komplett für das Kinderhaus „Sternstunden“ der Geschwister-Gummi-Stiftung gespendet.
Der Aufwand sei schon enorm, so Kathrin Erhardt. Feuerwehr, Polizei und Sicherheitswacht seien mit im Boot, damit alles wie am Schnürchen klappt. Seit September laufen bereits die Planungen. Doch nun sei alles unter Dach und Fach, die Genehmigung aus dem Landratsamt liegt vor und es kann losgehen mit dem Schmücken der Schlepper, die dann so viele Kinderaugen zum Funkeln bringen werden.
Konkret rechnen Kathrin Erhardt und Stefan Seidel mit bis zu 35 geschmückten Traktoren. Sie werden am Freitag, 8. Dezember um 18 Uhr auf dem Betrieb Grampp in Melkendorf starten und durch die Innenstadt, diesmal auch wieder über die Obere Stadt, bis zum Parkplatz des Freibades fahren. Dort wird ein Weihnachtsbaum aufgestellt, es gibt mehrere Feuerschalen sowie Glühwein, Plätzchen und die Gelegenheit, mit den Bauern ins Gespräch zu kommen.
Zwei dringende organisatorische Bitten haben die Veranstalter: Besucher sollten möglichst am Großparkplatz Schwedensteg parken. Parkplätze am Schwimmbad werden nur in sehr begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Außerdem soll so jegliches Chaos bei der An- und Abfahrt vermieden werden. Die zweite Bitte betrifft den Glühweinausschank. „Am besten wäre es, wenn möglichst viele Besucher ihre eigenen Tassen mitbringen könnten“, sagt Kathrin Erhardt. Das schont die Umwelt und erleichtert die Organisation.
Bilder: Die weihnachtlich geschmückten Traktoren lockten im zurückliegenden Jahr mehrere tausend Besucher an.
Unbelastet, aber nicht unerfahren / Jürgen Becher folgt auf Siegfried Hüttner als Vorsitzender des Maschinenrings – Betriebshelfer gesucht
Selbitz-Dörnthal.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg und
Umgebung hat einen neuen Vorsitzenden. Mit 125 von
128 möglichen Stimmen wählten die Mitglieder bei der
Jahresversammlung in Selbitz-Dörnthal
Jürgen Becher aus
Tennersreuth bei Stammbach zum Nachfolger von
Siegfried Hüttner.
Jürgen Becher ist 50 Jahre alt und bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb mit Ackerbau. Er ist auch Kreisvorsitzender des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf), sowie Aufsichtsratsmitglied der Käserei Bayreuth. Im Maschinenring hatte er bislang keine Funktion. „Ich bin also unbelastet, aber nicht unerfahren“, sagte er bei seiner Vorstellung. Sein Vorgänger Siegfried Hüttner war nach 17 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl angetreten. Zum neuen 2. Vorsitzenden wählten die Mitglieder Stefan Heinold aus Höhlmühle bei Stammbach. Der 51-Jährige, der einen Mischbetrieb führt, erhielt 124 von 128 möglichen Stimmen.
Corona-bedingt fand die Mitgliederversammlung nicht wie gewohnt im Februar, sondern erst jetzt statt. Die vorgelegten Zahlen betreffen deshalb auch nicht das aktuelle Jahr, sondern 2022. Geschäftsführer Patrick Heerdegen konnte dafür einmal mehr Zahlen vorlegen, die deutlich machen, wie wichtig die Arbeit der bäuerlichen Selbsthilfeorganisation für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum im Landkreis ist. Beispielsweise wurden weit über 21000 Stunden soziale Betriebshilfe geleistet, fast 2000 mehr als noch im Jahr zuvor. Soziale Betriebshilfe wird immer dann erforderlich, wenn der Betriebsleiter oder eine andere wichtige Kraft auf dem Hof ausfällt, etwa wegen Krankheit, Reha-Aufenthalten oder bei Todesfällen. Wenn das klassische Feld des Maschinenrings, der Mietpark mit Schlepper, Pflug und Scheibenegge etwas zurückgegangen war, so liegt das an der Trockenheit. Trotzdem erreichte der Maschinenring einen Verrechnungswert, also die Summe aller erbrachten Leistungen, von knapp 4,2 Millionen Euro (Vorjahr 4,7 Millionen Euro).
In der Nachfrage immens zugenommen hatten nach den Worten des Geschäftsführers allerdings die anderen Standbeine der Ringarbeit. Die Beratungen zu Düngeverordnung, Mehrfachanträgen oder Kulap-Anträgen gehören dazu, genauso wie der Dieselankauf. Allein 1,4 Millionen Liter Diesel seien im Jahr 2022 für die Landwirte der Region über den Maschinenring bestellt worden.
Das zeige auch, wie sehr sich die Arbeit des Rings während seiner Amtszeit verändert hat, sagte der bisherige Vorsitzende Siegfried Hüttner. Während es vor 17 Jahren noch weitgehend um die klassische Maschinenvermittlung und um die Betriebshilfe gegangen sei, hätten die Beratungs- und Dienstleistungen immer mehr Raum beansprucht. Hintergrund sei, dass die Behörden nach und nach aus der einzelbetrieblichen Beratung ausgestiegen sind.
Größtes Problem für den Ring sei es aktuell, Nachwuchs in der Betriebshilfe zu generieren. „Es wird immer schwieriger, jeden Einsatz zu garantieren“, bedauerte Hüttner. Ältere Mitarbeiter scheiden nach und nach aus, jüngere kämen kaum nach. Dabei sei der Maschinenring mit einem Stundenlohn von 21,50 Euro vor Steuer ein interessanter Arbeitgeber.
Auch bei der gewerblichen Tochter, der Maschinenring Münchberg GmbH, laufen die Geschäfte gut, sagte deren Geschäftsführer Daniel Seuß. Die GmbH ist unter anderem für die Stromtrassenpflege des Bayernwerks auch über die Grenzen des Landkreises Hof hinaus zuständig, sie erledigt im Auftrag von Kommunen den Winterdienst, erstellt Baumkataster und hat sogar Großunternehmen als auch Privatleute als Auftraggeber. Neu ist das Angebot der Grenzsteinsuche per GPS. Dadurch wird die Grenzsteinsuche ohne Vermessungsamt möglich, was zwar nicht amtlich anerkannt wird, aber für viele Landwirte eine hilfreiche Dienstleistung sein kann.
Bei den Neuwahlen wurden die folgenden Persönlichkeiten in den Vorstand gewählt: Georg Bergmann (Rieglersreuth), Oliver Mehringer (Markersreuth), Jörg Müller (Martinsreuth), Marina Müller (Baiergrün), Wilfried Schaller (Jehsen), Reinhardt Seifferth (Poppenreuth), Johannes Vogel (Selbitz), Markus Wolfrum (Osseck) und Hans Zeeh (Tiefengrün).
Bild: Jürgen Becher (rechts) ist neuer Vorsitzender des Maschinen- und Betriebshilfsrings Münchberg und Umgebung. Er löst Siegfried Hüttner ab, der 17 Jahre lang an der Spitze der Selbsthilfeorganisation stand.
Vorwurf der Tierquälerei: „Schlag ins Gesicht aller Bauern“ / Interview mit BBV-Kreisobmann Harald Peetz zur Anbindehaltung beim Milchvieh
Kulmbach.
Die Milchviehhaltung in Bayern ist geprägt von
vielen kleineren und mittleren bäuerlichen
Familienbetrieben. Viele dieser Milchviehbetriebe
halten ihre Rinder in Anbindehaltung, auch wenn die
Zahl dieser Betriebe stetig abnimmt. Nun möchte die
Politik diese Anbindehaltung schnellstmöglich
komplett verbieten. Dagegen wendet sich der
Bayerische Bauernverband (BBV). Er kämpft gegen ein
Verbot der Anbindehaltung, wirbt aber zugleich für
Weiterentwicklung und Alternativen zur ganzjährigen
Anbindehaltung. Eine Fristsetzung lehnt der Verband
dagegen entschieden ab. Wir sprachen mit Kreisobmann
Harald Peetz aus Himmelkron über die Anbindehaltung:
Herr Peetz, ist die Anbindehaltung in unserer Region überhaupt noch ein Thema?
Die Anbindehaltung ist auch in unserer Region wie überall in Bayern eine von selbst auslaufende Haltungsform. Aber nicht, weil es den Tieren da besonders schlecht geht, sondern weil die Haltungsform besonders arbeitsintensiv ist und so kein zum Überleben nötiger Viehbestand gehalten werden kann.
Gibt es Zahlen zur Anbindehaltung?
Auch ohne ein Verbot sind die Betriebe mit Anbindehaltung in Bayern von 37000 Betrieben im Jahr 2001 auf 13000 Betriebe im Jahr 2020 gesunken und sinken weiter, von den 13000 Betrieben sind circa 9000 reine Anbindehalter und circa 4000 Betriebe mit Kombihaltung. Das gleiche Bild zeigt sich im Landkreis Kulmbach da gab es 2022 nur noch 160 Milchviehbetriebe und ich schätze höchsten 25 Prozent davon hatten noch Anbindehaltung.
Warum ist die Anbindehaltung trotzdem noch wichtig?
Die Anbindehaltung ist trotzdem wichtig, weil es sich bei den Betrieben meistens um solche ohne Hofnachfolger, also auslaufende Betriebe handelt, die es sich für ihre paar Jahre die sie noch Tiere halten wollen, einfach nicht leisten können einen neuen Stall zu bauen und das Auskommen der Bauernfamilie ohne tierische Veredelung bei unseren kleinen flächenarmen Betrieben nicht möglich ist.
Was sind das genau für Betriebe, die noch Anbindehaltung betreiben?
Das sind Betriebe, die eng mit ihren Tieren verbunden sind wo die Gesundheit und das Wohl der Tiere an erster Stelle steht und danach erst die Bauernfamilie kommt und der Bauer oder die Bäuerin meist mehr leidet als das Tier, wenn es krank ist.
Tierschutzorganisationen sprechen offen von Tierquälerei, was entgegnen sie?
Diese Haltungsform als Tierquälerei und so die Bauernfamilien als Tierquäler hinzustellen ist ein Schlag ins Gesicht all derer die sich 365 Tage im Jahr wenn es sein muss, 24 Stunden am Tag um das wohl der Tiere kümmern und mit ihrer harten Arbeit die Lebensmittel für die Gesellschaft produzieren. Solch selbst ernannte Tierschützer und ihre Organisationen, die meist selbst nicht in der Lage sind, ihnen anvertraute Tiere artgerecht zu halten, aber über die Medien einen ganzen Berufsstand in Deutschland verunglimpfen, meist mit dem Ziel, das sich ihre Konten mit Spendengeldern füllen, sollten einmal ins Ausland schauen und sich dort um das Tierwohl kümmern denn wenn wir in Deutschland unsere Tierhalter gar kaputt gemacht haben, sind wir auf solche Lieferungen angewiesen.
Warum wäre eine Umstellung auf eine andere Haltungsform so schwierig?
Das Umstellen von Anbindehaltung auf Laufstallhaltung ist so schwierig, weil es ein kompletter Systemwechsel ist. In der Anbindehaltung kommt alles vom Futter, Wasser bis zur Melktechnik zum Tier in der Laufstallhaltung muss das Tier zum Futter und zum Melken gehen was einen komplett anderen Stall erfordert. Deswegen wäre die Kombihaltung die Weiterentwicklung und so wichtig für diese kleinen bäuerlichen Familienbetriebe.
Was versteht man genau unter Kombihaltung und lässt sie sich in unserer Gegend überhaupt praktikabel umsetzen?
In der Kombihaltung wird der vorhandene Stall so umgebaut oder erweitert das sich die Tiere zu bestimmten Tageszeiten oder zu bestimmten Jahreszeiten in Sammelboxen oder in Laufhöfen frei bewegen können und früh und abends zum Melken auf ihren Platz angebunden sind. Solche Umbauten sind in letzter Zeit schon verwirklicht worden und sind bei guten Willen aller Beteiligten auch in unseren Dorflagen möglich.
Was würde ein Verbot für die betroffenen Bauern konkret bedeuten?
Das Verbot der Anbindehaltung auch in der eben geschilderten Kombihaltung wäre das Ende all dieser Betriebe und die Tiere würden keiner besseren Zukunft entgegen gehen, sondern würden alle im Schlachthof ein jähes Ende finden. Vor allem, auch weil in dem Gesetz eine Übergangszeit von nur fünf Jahren für aktive Betriebsleiter zugesagt ist aber eine Übergabe eines solchen Betriebes auch während der fünf Jahre an die nächste Generation vollkommen ausgeschlossen ist was einem Berufsverbot gleichkommt.
Ihre Forderung an die Politik:
An die Politik gewandt kann ich nur immer wieder fordern von der ideologisch voreingenommenen Herangehensweise zu einer praktikablen, realistischen und für kleine Betriebe umsetzbaren Lösung zu kommen. Die Bauern erwarten eine Politik, die an ihrer Seite steht, die ihre Arbeit für die Gesellschaft würdigt und anerkennt und nicht immer wieder unerfüllbare Forderungen und Auflagen bringt. Die Landwirtschaft ist ein Berufszweig, der in Generationen und nicht in Wahlperioden denkt, sie braucht von der Politik Verlässlichkeit und Zusagen, auf die sich eine Betriebsentscheidung für 20 oder 25 Jahre aufbauen lässt, ansonsten ist eine Investition in die Tierhaltung, egal welcher Haltungsform nicht möglich und jeder Betrieb, der einmal aufgegeben hat, fängt nicht mehr an. Und neben den Bauernfamilien sind auch das dörfliche Leben und unsere Umwelt und Kulturlandschaft die Leittragenden einer solchen Politik. Wer meint mit einer solchen Politik zum Erhalt einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft und zu mehr Tierwohl und Umweltschutz beizutragen ist auf dem Holzweg. Damit sind wir auf dem besten Weg das zu zerstören, was wir fördern und erhalten sollten.
Bild: Nur rund 25 Prozent der noch verbliebenen 160 Milchviehbetriebe im Landkreis Kulmbach halten ihre Tiere in der Anbindehaltung.
Braugerstenanbau geht weiter zurück / Braugerstenschau in Oberfranken: Landwirte zogen negative Bilanz
Kulmbach.
Späte Aussaat, extreme Trockenheit, weniger Fläche
und unterdurchschnittliche Erträge: für die
Braugerstenanbauer war 2023 ein schwieriges Jahr.
Bei der oberfränkischen Braugerstenschau im
Kulmbacher Mönchshof berichtete Fritz Ernst vom Amt
für Landwirtschaft von deutlich höheren
Eiweißwerten, schwachen Vollgerstengehalten und
einer höheren Auswuchsgefahr.
Das Dilemma fängt schon bei der Anbaufläche an. Hier lag der Wert bei der Sommergerste bei 23160 Hektar. Das sind über 5000 Hektar oder 17 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. „Damit lag der Anbau auf dem niedrigsten Wert seit Jahrzehnten“, sagte Fritz Ernst. Für das kommende Jahr ging er sogar noch von einem stärkeren Rückgang auf rund 20000 Hektar aus. Als Gründe dafür nannte er die schlechten Erträge 2022 und 2023, sowie die Fläche, die für den Bedarf an Futter und Biogassubstrat verloren geht.
Dabei sollte man nach den Worten des Fachberaters allerdings nicht übersehen, dass Oberfranken nach wie vor gute Voraussetzungen für den Sommergerstenanbau bietet. Die Böden seien geeignet, die klimatischen Bedingungen passten trotz allem noch und die Landwirte seien leistungsfähig und hätten den Anbau im Griff. „Mälzereien und Brauereien sind vor Ort und de Landhandel ist auf Braugerste eingestellt.“ Damit werde in Oberfranken die von der Politik vielfach propagierte Aussage “farm to fork“ (vom Feld auf den Tisch“) durch kurze Verarbeitungswege direkt umgesetzt. Durch Vertragsanbau könne das Risiko zudem für alle Beteiligten begrenzt werden, wenn auch die Preisfindung ein schwieriges Kapitel bleibt.
Auch der Vorsitzende des in Kulmbach ansässigen Braugerstenvereins Oberfranken Hans Pezold zog ein gemischtes Fazit. Die Witterung habe den Anbau für die meisten Regionen erst viel zu spät zugelassen und die Saatbedingungen seien nicht optimal gewesen, so der Vorsitzende. Durch die Mitte Mai einsetzende Trockenheit mit einhergehend hohen Temperaturen seien die Triebe der ohnehin schwach bestockten Bestände noch einmal stark reduziert worden. „In die Abreife kamen dann die lang ersehnten Niederschläge, aber viel zu spät und zur Unzeit.“
Der
Frust sei sehr groß, da es in manchen Gegenden die
dritte schlechte Ernte in Folge war, sagte Hans
Pezold. Dabei sei die Landwirtschaft durchaus in
Vorleistung gegangen. Der Vorsitzende sprach von
einer Verdreifachung der Düngekosten, von
exorbitanten Diesel- und Maschinenkosten und auf der
anderen Seite von ganz schwachen Naturalerträgen
gepaart mit überschaubaren Qualitäten, die dann im
schlimmsten Fall zu Futterpreisen abgerechnet worden
seien. Hans Pezold: „Für die Landwirtschaft mehr
oder weniger ein Totalschaden auf diesen Flächen.“
Noch schlimmer als das Wetter sei allerdings de ideologisch geprägte Politik, unter der die Bauern zu leiden haben. „Berlin richtet noch mehr Schaden an als das Wetter“, sagte der BBV-Kreisobmann Harald Peetz. Während er beim Wetter allerdings noch Hoffnung auf Besserung habe, gebe er die Hoffnung bei der Politik auf. Nach den Worten des stellvertretenden Kulmbacher Landrats Dieter Schaar leisteten die Braugerstenanbauer einen wertvollen Beitrag zur oberfränkischen Lebenskultur. „Ohne Braugerste kein Malz, ohne Malz kein Bier und ohne Bier keine Brauereien im Bierland Oberfranken.“
Aus den knapp 80 eingereichten Mustern wurden anhand verschiedenster Kriterien wie Eiweißgehalt oder Kornausbildung drei Bezirkssieger gekürt: Platz 1 erreichte die Gutsverwaltung Reitzenstein in Issigau (Landkreis Hof), Platz 2 Alexander Stöhr aus Röslau (Landkreis Wunsiedel) und auf Platz 3 landete Thomas Kraus aus Stadelhofen (Landkreis Bamberg).
Bilder:
1. 80
Muster wurden diesmal zur Braugerstenschau von
oberfränkischen Landwirten eingereicht, 50 kamen in
die Wertung und wurden bei der Braugerstenschau
ausgestellt.
2. „Die
Braugerstenernte 2023 ist in Ertrag und Qualität
bezogen auf den Vollgerstenanteil sehr schwach
ausgefallen“: Fritz Ernst vom Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg.
Raus aus der fossilen Nutzung / Präsident Felßner bei der öffentlichen BBV-Kreisversammlung in Hof
Dörnthal.
Der Landkreis Hof hat in jeder Hinsicht eine
hervorragende Ausgangsposition. Das hat Präsident
Günther Felßner bei der öffentlichen
Kreisverssammlung des BBV Hof in Dörnthal
festgestellt. „Hier sind die Menschen überaus
kreativ, erbringen außergewöhnliche Leistungen und
schaffen die besten Voraussetzungen für die
Zukunft“, sagte Felßner. Einzigartig sei Hof aber
auch noch aus einem anderen Grund. Bayernweit
einmalig stehe hier mit Elke und Ralph Browa aus
Hirschberglein bei Geroldsgrün ein Ehepaar als
Kreisbäuerin und Kreisobmann an der Spitze.
Rote und Gelbe Gebiete, Erosionskataster, Tierarzneimittelgesetz, der Borkenkäfer, Süd-Ost-Link, die FAL-BY-App: die Auflistung der aktuellen Probleme durch Kreisobmann Ralph Browa wollte scheinbar gar kein Ende nehmen. „Wir machen eine Baustelle zu und drei neue auf“, sagte er. Die Rahmenbedingungen passten nicht mehr, so die Bezirksbäuerin Beate Opel aus dem Nachbarlandkreis Kulmbach. Immer wieder neue Auflagen, immer mehr Bürokratie und ständig wachsende Herausforderungen: „Da verlieren viele die Lust.“ Aus der Berufung, Bäuerin und Bauer zu sein werde für viele einfach nur mehr eine Belastung. Als Beispiel führte sie das drohende Ende der Anbindehaltung an, gegen das der Bauernverband mit der Aktion „Rettet Berta vor dem Schlachthoff und Kleinbauern vor dem Aus“ ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt habe.
Auch BBV-Präsident Felßner nahm sich des Themas an. Er nannte die geplante Nutztierverhaltung einen “Generalangriff auf alle Tierhalter“. Seit 30 Jahren sei jeder neue Stall ein Laufstall. Damit sei klar, dass die Anbindehaltung von selbst ausläuft. Auch zu den Roten und Gelben Gebieten fand der Präsident klare Worte: „Das ist absoluter Schwachsinn“, sagte er. „Wir spüren doch alle, wie schräg und daneben das ist“. Auch ihm gehe es darum, das Grundwasser zu schützen, doch müsse dies Verursachergerecht geschehen. Landwirte dürften nicht in Sippenhaft genommen werden.
Felßner zählte in seiner Rede vier Eckpunkte auf, die er als Zukunftsfelder der Landwirtschaft bezeichnete: die Sicherstellung der Ernährung, die Produktion von Energie, die Dekarbonisierung und damit der Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien sowie der Erhalt der Lebensgrundlagen und der Schutz des Bodens. „Das sind die Funktionen, die wir als Landwirte künftig bedienen müssen“, sagte er.
Die Lösungen dafür lägen vor, sie müssten aber auch dringend umgesetzt werden, denn die Bevölkerung nehme weltweit gewaltig zu, die landwirtschaftliche Nutzfläche werde im Gegenzug weniger und 80 Prozent der Emissionen würden von 15 Prozent der Menschen erzeugt. Zu den 15 Prozent gehörten die Menschen der Industrienationen, also wir alle. „Unser Wohlstand beruht auf die Nutzung fossiler Energien, sagte Felßner und forderte ein „Raus aus der fossilen Nutzung“ und ein „Rein in eine grüne Zukunft“.
Zuvor hatte Landrat Oliver Bär ein Plädoyer für die Landwirtschaft in der Region gehalten. „Die Landwirtschaft hat Zukunft, weil sie auch Zukunft schafft“, sagte er. Die Kulturlandschaft werde sich verändern, so Bär. Land- und Forstwirte seien dabei unabdingbar. Gerade was den Waldumbau aufgrund der immensen Schäden im Frankenwald betrifft, müssten alle an einem Strang ziehen. Ganz wichtig sei es aber auch, dass die Bevölkerung dauerhaft den Wert der Landwirtschaft erkennt. Landrat Bär: „Wir würfen das Feld nicht anderen überlassen.“
Bild: Öffentliche Kreisversammlung des BBV Hof in Dörnthal (von links): Geschäftsführer Thomas Lippert, Kreisobmann Ralph Browa, Präsident Günther Felßner und Kreisbäuerin Elke Browa.
Drei Jahrzehnte Engagement und Leidenschaft für den ländlichen Raum / Schule der Dorf- und Flurentwicklung Klosterlangheim feierte 30. Geburtstag
Lichtenfels.
Vom Flaggschiff der Dorferneuerung war die Rede, von
einem Impulsgeber für den ländlichen Raum, von einer
beispiellosen Erfolgsgeschichte und von 30 Jahren
andauernder erfolgreicher Entwicklung: Die Schule
der Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim bei
Lichtenfels hat in einer Feierstunde ihren 30.
Geburtstag gefeiert.
Dabei ist sie keine Schule im herkömmlichen Sinn. Die Einrichtung begleitet in Seminaren und Workshops Dörfer und Landschaften auf ihren Weg in die Zukunft, und zwar in allen Fragen der Dorferneuerung, in der Flurneuordnung, in der Integrierten Ländlichen Entwicklung oder bei der Vorbereitung auf den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“.
Drei derartige Einrichtungen gibt es in Bayern, eine in Plankstetten (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz), eine weitere in Thierhaupten (Landkreis Augsburg) und eben die in Klosterlangheim, ein Kirchdorf mit rund 400 Einwohnern, das heute zur oberfränkischen Stadt Lichtenfels gehört. Die Schule der Dorf- und Flurentwicklung (SDF) ist dort im Konventbau des ehemaligen Zisterzienser-Kloster Langheim untergebracht.
An die Gründungsversammlung am 29. September 1993 erinnerte bei dem Festakt Lothar Winkler, stellvertretender Vorsitzender des Trägervereins und Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung Bamberg. Über 130 Interessierte seien damals zusammengekommen, um den Verein zu gründen. Über die Jahre betrachtet, habe fast jedes Wochenende ein Seminar stattgefunden, sagte er.
Roland Spiller, Referatsleiter Integrierte Ländliche Entwicklung und Flurneuordnung im Landwirtschaftsministerium sprach von drei Jahrzehnten Engagement und Leidenschaft für die Menschen im ländlichen Raum. Unter dem Motto „Gemeinsam erkennen, entwickeln und handeln“ würden in der bundesweit einmaligen Einrichtung die Bürger mitgenommen, sie seien eingeladen, sich einzubringen und die Entwicklungen vor Ort aktiv zu begleiten. Die Herausforderungen seien groß: Ernährungssicherheit, regenerative Energien, Klimawandel, Biodiversität. Bei all diesen Themen spiele der ländliche Raum eine entscheidende Rolle.
Anfangs sei die Dorf- und Flurentwicklung durchaus kritisch beäugt worden, erinnerte sich Klaus Reder, der Bezirksheimatpfleger vom Nachbarregierungsbezirk Unterfranken. „Man dachte, es gebe künftig keinen Platz mehr für Häslein und Gräslein“, so Reder. Die Angst der Heimatpfleger vor der Flurbereinigung sei groß gewesen. Mittlerweile habe man gelernt, dass Flurbereinigung, Dorf und Heimat bestens zusammenpassen.
Zum Festakt hatten die Verantwortlichen auch einen Film zusammengestellt, in dem zahlreiche beteiligte Personen, Kommunalpolitiker, Entscheidungsträger und Zeitzeugen über die Einrichtung sprachen. Holger Magel etwa, ehemaliger Chef der Bayerischen Verwaltung für Ländliche Entwicklung. Seinen Worten zufolge sei es von Anfang an das Ziel gewesen, dass Bürger ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen und nichts von oben verordnet wird. Die Entwicklung der Schulde der Dorf- und Flurentwicklung bezeichnete er als sensationell. „Die Dörfer sind die Seele des Landes, was gibt es Wichtigeres, als sich um die Seele zu kümmern“, so Magel.
Bild: Trafen sich bei der Feierstunde zum 30-jährigern Bestehen der Schule der Dorf- und Flurentwicklung Klosterlangheim (von links): der stellvertretende Vorsitzende Lothar Winkler, der unterfränkische Bezirksheimatpfleger Klaus Reder und Roland Spiller vom Landwirtschaftsministerium.
Wildschäden durch Vögel nehmen zu / BBV: Jagdseminar zu rechtlichen Grundlagen im Schadensfall
Bayreuth. Jäger, Jagdpächter, Landwirt und Grundeigentümer: Wenn alle Beteiligten miteinander sprechen, ja vielleicht sogar zusammenwirken, dann gibt es draußen in der Flur auch keine Probleme. Auf diesen einfachen Nenner lässt sich das Ergebnis des BBV-Jagdseminars in Bayreuth bringen. „Kommunikation ist das Wichtigste“, brachte es einer der Teilnehmer auf den Punkt. Dann sei bei einem Wildschaden auch eine gütliche Einigung vor Ort möglich. „Wenn man miteinander redet, dann erreicht man viel“, sagte Werner Kuhn, Sprecher der AG Jagdgenossenschaften in Unterfranken. „Der Idealfall ist immer eine gütliche Einigung“, so Torsten Gunselmann von der Hauptgeschäftsstelle des oberfränkischen Bauernverbandes in Bamberg.
Weil die gütliche Einigung halt nicht immer möglich ist, gibt es genaue Regelungen, die Gunselmann den Teilnehmern des Jagdseminars, Mitglieder von Jagdgenossenschaften und Grundstückseigentümer vorstelle. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Wildschadensschätzer. Knapp 50 gibt es in Oberfranken. Sie würden in der Regel vom Bauernverband geschult und der Unteren Naturschutzbehörde vorgeschlagen.
Ein Streitpunkt sei immer wieder, bei welchen Wildarten ein Schaden ersetzt wird, so der Referent. Doch genau das sei ganz klar im Bundesjagdgesetz und im Bayerischen Jagdgesetz geregelt. Die ganze Palette des Schalenwilds vom Reh bis zum Wildschwein, fällt darunter, ebenso Wildkaninchen und Fasane. Keinen Ersatz gebe es dagegen beim Fuchs und bei den Vogelarten, wie Krähen, Fischreiher, Möwen., Schwäne, Wildtauben, Wildenten, oder Wildgänsen. Die Vögel stellten sich in Oberfranken in den letzten Jahren allerdings als immer größer werdendes Problem heraus. Gerade im Maintal nähmen die Schäden massiv zu, sagte Gunselmann. Vor allem Schäden durch Gänse, Krähen oder Schwäne, weil sie alle keine natürlichen Feinde hätten. Wir setzen uns dafür ein, die Schäden zu regulieren, denn so kann es nicht weitergehen“, so der Referent.
Als weiteren Streitpunkt nannte Gunselmann die Frage, welche Kulturen bei Schadensfällen ersatzpflichtig sind. Doch auch das sei gesetzlich klar geregelt. Alle gängigen Kulturen auf Ackerland gehörten dazu, aber auch Anpflanzungen im Wald, der Aufwuchs bei Grünlandschäden und auch Streuobstwiesen. Nicht entschädigungspflichtig, oder zumindest nur dann, wenn intakte Schutzvorrichtungen vorhanden sind, seien „Garten- und hochwertige Handelsgewächse“. Dazu gehören Erdbeeren, Spargel oder Wein. Ganz schlüssig war es bei der Aufzählung allerdings nicht, warum Sonnenblumen nicht dazugehören, Raps dagegen schon. Ersatzpflichtig sind nach den Worten Gunselmanns grundsätzlich die Ernte, der Substanzschaden, also Wühlschäden oder Schäden an fest installierten Zäunen, sowie die Kosten der Schadensermittlung.
Überall zu hoch, wenn nicht sogar deutlich zu hoch, ist laut des letzten vorliegenden Verbissgutachtens die Situation im den Landkreisen Bayreuth, Hof und Kulmbach. Die Verbiss-Situation habe im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zugenommen und liege meist über dem bayerischen Durchschnitt, so Dieter Heberlein von der BBV-Hauptgeschäftsstelle. Tatsächlich war in den „Forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung“, wie das Verbissgutachten offiziell heißt, nicht nur die Rede von schwerwiegenden ökonomischen Auswirkungen für die Waldbesitzer, etwa durch hohe Kosten für dringend notwendigen Bau von Schutzzäunen, sondern auch von ökologischen Auswirkungen, zum Beispiel durch das Aussterben mancher Baumarten. Laut Gutachten, das immer im dreijährigen Turnus angefertigt wird, sind die Rehwildbestände in den Landkreisen deutlich angestiegen. Damit steigt natürlich auch die Verbiss-Problematik. Ein wichtiges Ziel des Gutachtens ist es, die behördliche Rehwild-Abschusspläne für die kommenden drei Jahre zu erstellen. Eine Konsequenz ist es deshalb, dass die Abschussempfehlung deutlich erhöht werden muss.
Oberfrankenweit gibt es nach den offiziellen Zahlen 670 Jagdgenossenschaften im BBV: Die meisten mit 126 im Landkreis Bamberg, die wenigsten mit gerade mal 28 im Landkreis Wunsiedel.
Aus dem Oberland für Deutschland: Christbaumsaison beginnt in diesen Tagen / Beste Qualität ohne Käferschäden - Mäßige Anhebung der Preise unumgänglich
Petschen.
Eine geringfügige Preisanpassung muss sein, sagt Uwe
Witzgall. Sie wird allerdings so moderat ausfallen,
dass man sich auch heuer den Christbaum leisten
kann, sagt der Landwirt aus Petschen oberhalb von
Stadtsteinach. Seit mittlerweile elf Jahren baut der
53-Jährige auf rund 30 Hektar Fläche hauptsächlich
Nordmanntannen, in geringerer Stückzahl auch
Nobilis-Tannen, Blaufichten und Schwarzkiefern an
und beliefert damit Händler in ganz Deutschland. Der
Hof und die Plantagen liegen direkt auf der
Fränkischen Linie auf rund 540 Meter über
Normalnull.
Auch bei ihm sei alles teurer geworden. Allein bei den Netzen haben es Preissteigerungen um bis zu 25 Prozent gegeben. „Auch beim Lohn haben wir nachlegen müssen“, sagt er. Uwe Witzgall beschäftigt vier feste Mitarbeiter, drei weitere kommen in wenigen Tagen, wenn die heiße Phase startet, dazu. „Wir zahlen über Mindestlohn“, so der Landwirt. Anders seien gute und zuverlässige Kräfte gar nicht mehr zu bekommen. Die ganze Familie hilft ohnehin mit. Für Kopfzerbrechen sorgten derzeit noch immer die hohen Energiepreise. Außerdem habe der Gesetzgeber jetzt auch noch eine Ausweitung der Maut auf kleinere Transporter beschlossen.
Trotz der Trockenheit im zurückliegenden Sommer kann Uwe Witzgall all seinen Kunden eine hervorragende Qualität der Bäume garantieren. „Zumindest die größeren stecken das weg“, sagt er. Im Gegenteil: „Die Qualität der Nadeln ist top.“ Der Wuchs sei gut, der Regen im August habe nochmal für einen zusätzlichen Wachstumsschub gesorgt. Lediglich bei den Jungpflanzen habe die Trockenheit Spuren hinterlassen. Besonders bei den Blaufichten und den Nobilis-Edeltannen gebe es trockenheitsbedingte Ausfälle. Nordmanntannen seien dagegen sehr widerstandsfähig. „Die haben das weggesteckt“, so Uwe Witzgall. Nordmann-Tannen stehen auf 85 Prozent seiner Anbaufläche.
Derzeit sind er und seine Mitarbeiter vor allem mit Schnittgrün beschäftigt für Garten- und Grabbedeckungen sowie für Kränze beschäftigt. Aber schon in wenigen Tagen kommen die ersten Lkw zum Aufladen von Christbäumen. Viele Kunden wollten ihren Baum schon früh, weil er zum Beginn der Adventszeit bereits im vollen Schmuck erstrahlen soll. Das können Rathäuser, Ämter und Büros sein, oder auch Firmenkunden. Auch der große Baum, den der Porzellanhersteller Rosenthal in Selb aufstellt, wird von den Plantagen aus Petschen kommen.
Uwe Witzgall kann sich über Anfragen nicht beklagen., Kunden und Händler hätten ziemlich konstant bestellt, sagt er. Das ist gut so, denn andernorts gab es durchaus unwetterbedingte Ausfälle. In Polen etwa soll ein starker Frost großen Teile der dortigen Plantagen schweren Schaden zugefügt haben. Auch in Mittelfranken habe es aufgrund von Hagelschäden größere Ausfälle gegeben. Engpässe seien aber nicht zu befürchten, gibt Uwe Witzgall Entwarnung.
Auch der Borkenkäfer sei bei den Nordmann-Tannen kein Thema. Weil die Nordmann-Tanne ein Pfahlwurzler ist, lässt sie der Käfer in der Regel links liegen. Probleme bereitet dann schon eher das zunehmende Rehwild. „Die Zäune müssen in Ordnung sein, sonst kann es schnell richtig teuer werden“, sagt Uwe Witzgall. Deshalb muss er ständig die Zäune kontrollieren.
Einen Tipp hat Uwe Witzgall für alle Christbaumbesitzer: „Der gekaufte Baum sollte vor dem Aufstellen schattig und im Freien liegen, dann hält er am längsten“. In der Wohnung sollte anschließend ein kleines Stück abgesägt und der Ständer mit Wasser gefüllt werden. So hat man am längsten seine Freude an den Weihnachtsbäumen aus dem Frankenwald. Wie haltbar die Bäume aus Petschen sind, konnte man im zurückliegenden Jahr bei der Feuerwehr in Schwandt beobachten. Der dortige Baum sei so in Schuss gewesen, dass sein Stamm sogar noch als Spitze für den Maibaum zu verwenden war.
Wer
Lust hat, sich seinen Baum selbst auszusuchen und
eventuell sogar selbst zu schlagen, der kann am
ersten, zweiten und dritten Adventswochenende,
jeweils Samstag und Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr
auf die Plantage zwischen Vorderreuth und Schwandt
kommen und sich seinen Baum direkt beim Produzenten
kaufen. Ansonsten gibt es Verkaufsstände mit den
Bäumen von Uwe Witzgall in Kulmbach am Eulenhof bei
Samen Hühnlein, aber unter anderem auch in
Himmelkron, Stammbach, Wonsees, ganz neu in
Hallstadt und sogar in der Ludwigstraße am
Rathausbrunnen in Hof.
Auch Norbert Grass von Christbaumgrass in Wahl bei Presseck kann eine geringfügige Preiserhöhung nicht ganz ausschließen. „Ganz genau wissen wir es noch nicht, aber wenn, dann nicht viel.“ Auf jeden Fall will man versuchen, die Preise „mehr oder weniger“ zu halten. Ab Mitte November werde eingeschlagen, der Verkauf wird zum 1. Advent starten. Die Nachfrage werde so sein, wie alle Jahre, da werde sich nichts ändern.
Keine Spuren habe die Trockenheit bei Norbert Grass hinterlassen. „Die Kulturen schauen alle sehr gut aus.“ Angebaut würden ausschließlich Nordmann-Tannen. Deshalb sei auch der Borkenkäfer kein Thema. Die Tanne sei nicht der geschädigte Baum, ganz im Gegensatz zur Fichte. Gegen Rehwild könne man sich nur durch Zäune schützen, deshalb seien sämtliche Kulturen eingezäunt und würden regelmäßig kontrolliert. Die Christbäume von Norbert Grass gibt es ab 25. November ab Hof und ab dem 1. Advent auf den Plätzen, unter anderem in Helmbrechts, Münchberg (Rewe) und in Hof (Möbel SB-Halle in der Schaumbergstraße gegenüber dem Landratsamt). Sollte jemand früher einen Baum benötigen, sei es kein Problem, den frisch geschlagenen Baum direkt ab Hof abzuholen.
Günter Schmidt aus Heinersreuth bei Presseck beginnt ebenfalls in diesen Tagen mit dem Einschlag. Er geht davon aus, dass die Bäume „minimal teurer“ werden. Das bedeute maximal fünf Euro mehr pro Baum. Anders sei es nicht mehr machbar, gibt er zu bedenken, geht aber davon aus, dass die Nachfrage gleichbleiben werde. Trotzdem werde je nach Qualität für jeden Geldbeutel etwas dabei sein, ist sich Günter Schmidt sicher. Billige Bäume gebe es bereits ab 19 Euro, die teuersten Bäume aus seinem Angebot beziffert er auf 80 bis 85 Euro. „Das ist natürlich eine reine Qualitätsfrage.“
Auf die stehenden Bäume habe die Trockenheit des zurückliegenden Sommers keine Auswirkungen, bei den Jungpflanzen habe er allerdings über einem Drittel Ausfall. Mit Jungpflanzen meint Günter Schmidt die Bäume, die er heuer im Frühjahr gepflanzt hatte. Ursache für die Widerstandsfähigkeit der Tanne sei einmal mehr die Tatsache, dass es sich um einen Pfahlwurzler handle, dessen Wurzeln nach unten und nicht in die Breite gingen. Von den rund 10000 frisch gepflanzten Bäumen seien bestimmt 4000 kaputt gegangen.
Bei Günter Schmidt gibt es ebenfalls nur Nordmann-Tannen. Nobilis biete er wegen des ungleichen Wuchses nur noch als Schnittgrün für Gärtnereien an. Bei ihm seien weder Borkenkäfer noch Rehwild ein Thema gewesen. Der Borkenkäfer gehe ohnehin nicht an die Nordmann-Tannen und wegen des Rehwildes seien, wie bei den Kollegen auch, alle Kulturen komplett eingezäunt. „Ohne Zäune geht gar nichts“, so Günter Schmidt. Seine Bäume gibt es unter anderem in Bayreuth (Königsallee), in Hof (Holz Schödel) in Thurnau und natürlich ab Mitte November auch ab Hof in Heinersreuth.
Bilder:
1. Noch
ist alles ruhig, doch schon in wenigen Tagen wird
auf den Christbaumplantagen von Uwe Witzgall in
Petschen Hochbetrieb herrschen.
2. Direkt
auf der Fränkischen Linie liegen die Plantagen von
Uwe Witzgall in Petschen oberhalb von Stadtsteinach.
Das Beste fürs Tierwohl vom Kalb bis zur Kuh / Gesetzesentwurf zum Aus für Anbindehaltung würde Lichtenfelser Betrieb schwer treffen
Reundorf.
Ob die Milchviehhaltung in den nächsten Jahren bei
Familie Seelmann in Reundorf, einem Ortsteil von
Lichtenfels, noch weiter betrieben wird, hängt
maßgeblich von der Gesetzgebung auf Bundesebene ab:
Wird die Anbindehaltung untersagt, sieht sich Stefan
Seelmann gezwungen, die Milchviehhaltung für immer
aufzugeben.
„Eigentlich wollte der Sohn den Betrieb weiterführen, doch das wird schwierig“, machen sich Stefan Seelmann und seine Frau Manuela keine Illusionen. „Uns werden so viele Steine in den Weg gelegt.“ Seit 40 Jahren ist er als Landwirt tätig, hat den Beruf von der Pike auf gelernt. „Und jetzt sind wir auf einmal draußen die Bösen“, schüttelt Stefan Seelmann beim öffentlichkeitswirksamen Stallgespräch zur Aktion „Rettet Berta vor dem Schlachthof und die Kleinbauern vor dem Aus“ mit dem Kopf.
Der Gesetzesentwurf zum Verbot der Anbindehaltung komme praktisch einem Berufsverbot gleich, sagt der Lichtenfelser Kreisobmann Michael Bienlein. Das faktische Aus für die Anbindehaltung treffe die Familie Seelmann schwer, denn sie hatten den kleinen Anbindestall vor einigen Jahren sogar noch erweitert. „Wir machen das Beste fürs Tierwohl, vom Kalb bis zur Kuh“, ist der Betriebsleiter überzeugt.
Zusammen
mit seiner Frau Manuela bewirtschaftet Stefan
Seelmann den Milchviehbetrieb im Obermaintal im
Haupterwerb. Auf rund 75 Hektar landwirtschaftlicher
Fläche bauen sie hauptsächlich Futtergetreide,
Silomais, Luzerne und Kleegras für die eigene
Tierhaltung an. Auf dem Hof werden 33 Milchkühe in
Anbindehaltung sowie rund 50 Tiere für die Nachzucht
der eigenen Milchviehherde gehalten. Ein Stallneubau
scheitert schon an der nicht vorhandenen Fläche,
weil der Hof am Ortsrand an einer Seite an ein
Hochwasserschutzgebiet grenzt und sich an der
anderen Seite zu nahe an der Autobahn A73 befindet.
Mit Ausnahme der bei Bedarf zugekauften GVO-freien Eiweißkomponenten (GVO steht für gentechnisch veränderte Organismen), erzeugt der Betrieb sein Futter ausschließlich über die eigenen Flächen selbst. Die Milch vermarktet der Betrieb an die Milchwerke Oberfranken West in Meeder bei Coburg. Deren Vorstand Harald Reblitz zufolge stammten nur mehr vier Prozent der angelieferten Milchmenge aus Anbindehaltung. Allerdings kämen diese vier Prozent von 16 bis 18 Prozent der Betriebe, die regelmäßig liefern.
Zusätzlich zur Milchviehhaltung betreiben die Seelmanns noch eine kleine Schweinemast mit rund 30 Tieren, die direkt an einem örtlichen Metzger vermarktet werden. Die Einnahmen aus einer Photovoltaikanlage mit rund 50 kW auf dem Dach der Maschinenhalle ergänzen das Betriebseinkommen.
Kühe
werden in Anbindeställen doch nicht misshandelt“,
widersprach Kreisobmann Michael Bienlein den
Aussagen mancher sogenannter
Tierschutzorganisationen. Teilweise gehe es ihnen
sogar besser, wusste er aus seiner 35-jährigen
Tätigkeit als hauptberuflicher Betriebshelfer zu
berichten. Keine Notwendigkeit, Anbindeställe zu
verbieten sieht auch Kreisobmann Harald Peetz aus
dem Nachbarlandkreis Kulmbach: „Irgendwann hört die
Anbindehaltung doch von selbst auf, da mittlerweile
ausnahmslos nur noch Laufställe gebaut werden.“
Außerdem gab Harald Peetz zu bedenken: „Hier weiß
der Bauer noch, wie seine Kühe heißen, sie haben
nicht nur eine Nummer, wie in manchen
Großbetrieben.“
Bilder:
1. Familie
und Verbandsvertreter beim öffentlichkeitswirksamen
Stallgespräch zur Aktion „Rettet Berta vor dem
Schlachthof und die Kleinbauern vor dem Aus“.
2. Manuela und Stefan Seelmann im Stall, der erst
vor wenigen Jahren noch einmal erweitert wurde.
3. Kreisobmann Michael Bienlein war 35 Jahre lang
als Betriebshelfer tätig und kennt die Anbindeställe
in der Region.
Jagddruck nicht immer zielführend / Forum „Waldkontroversen“ an der Universität Bayreuth – Aussagen des BJV-Vizepräsidenten sorgten für Widerspruch
Mit
seinen provokanten Thesen hat Eberhard Freiherr von
Gemmingen-Hornberg (Bild links) beim Forum
„Waldkontroversen“ an der Universität Bayreuth für
Aufsehen gesorgt. Das jetzige Desaster in den
Wäldern sei nichts anderes als die Folge früherer
falscher Forstwirtschaft, sagte der Baron, der einer
von drei stellvertretenden Vorsitzenden des
Bayerischen Jagdverbandes (BJV) ist.
Freiherr von Gemmingen-Hornberg, der sich selbst als „jagender Waldbesitzer“ bezeichnete, nannte es einen Trugschluss, dass immer höhere Abschusszahlen zum gewünschten Erfolg führen. Eine ständige Erhöhung des Jagddrucks sei nicht immer zielführend. „Die falsche Bejagung fördert die Waldschäden“, sagte er.
Insbesondere kritisierte von Gemmingen-Hohenberg die Schaffung von Monokulturen durch die Konzentration auf die Fichte. Auch die Jagd habe einiges falsch gemacht und sich vom Forst vor sich hertreiben lassen. Jetzt, wo die Kalamitäten über den Wald hereinbrechen, rufe man nach dem Jäger und glaube, dass man mit maximalem Jagddruck den Karren aus dem Dreck ziehen könne. Die Jäger seien jedenfalls bereit, den Waldumbau konstruktiv zu begleiten und mitzugestalten. Die vielgepriesene Jagdwende, die auch das Thema des „Forums Waldkontroversen“ war, müsse modern und zielgerichtet sein.
Der Sprecher plädierte dafür, wieder so viel Natur wie möglich im Wald zuzulassen, aber auch von der Ideologie der Verjüngung ohne Zaunbau wegzukommen. So ließen sich die waldbaulichen Fehlentscheidungen der zurückliegenden Jahre eventuell korrigieren. Nicht gerecht werde man mit dem Rezept, dass auf zunehmenden Wildschaden eine Abschusserhöhung folgen müsse.
Mit seinen Aussagen forderte Freiherr von Gemmingen-Hornberg erheblichen Widerspruch geradezu heraus. Da werde die Situation deutlich heruntergespielt, sagte Jagdvorsteher Georg Nützel. Auf die derzeitige Situation müsse man doch reagieren, Gelassenheit sei mit Sicherheit der falsche Weg. Man könne doch nicht den Waldbesitzern die Schuld in die Schuhe schieben, sagte Angelika Morgenroth, Vorsitzende der WBV Bamberg. Sie erinnerte daran, dass Monokulturen in den zurückliegenden Jahrzehnten Stand der Dinge gewesen seien. „Wir als Kleinstwaldbesitzer sind auf die Jagd angewiesen“; so Morgenroth. Ein weiterer Zuhörer sprach von schwerer Kost und bemängelte, dass der Bayerische Jagdverband offenbar kein Leitbild habe. „Wahrscheinlich sind wir ihm nicht wichtig genug“, so der Waldbesitzer.
Einig
war man sich dagegen bei einer Forderung, die Silvia
Backhaus (Bild links) vom Ökologischen Jagdverband
aufgestellt hatte. Ihr ging es darum die Jagdzeiten
zu verändern. „Wir sollten die Jagdzeiten nicht
verlängern, sondern optimieren“, sagte sie. Damit
konnte sich auch Freiherr von Gemmingen-Hornberg
anfreunden. Einig wurde man sich mit einer
Vorverlegung auf Mitte April aufgrund der Anpassung
an die Vegetation. Schluss sollte am 31. Dezember
sein, damit die Tiere eine mehrmonatige Ruhephase
haben. Neu eingeführt werden sollte eine
Sommerpause, mindestens von Mitte Juni bis Mitte
Juli. Mit der Bayerischen Staatsregierung sei das
aber leider nicht zu machen, bedauerte Silvia
Backhaus. Da würden offensichtlich persönliche
Jagdinteressen über das Gemeinwohl gestellt.
„Fakt ist, dass der Wald leidet.“ Mit diesen Worten hatte Gregor Aas, bisheriger Leiter des Ökologisch-Botanischen Gartens an der Universität Bayreuth, die „Waldkontroversen“ eröffnet. Die Schaffung naturnaher Mischwälder, die dem künftigen Klima standhalten und die Vielfalt der geforderten Waldfunktionen gerecht werden, das sei die Herausforderung der Zukunft.
Auch eine Publikumsfrage gab es: Sollte für einen erfolgreichen Waldumbau mehr oder weniger Wild als bisher erlegt werden. Deutlicher hätte die Antwort nicht ausfallen können: über 82 Prozent der Teilnehmer, die sich an der Frage beteiligt hatten, antworteten mit ja.
Glyphosat: Fluch oder Segen für die Landwirtschaft? / Naturschutzverbände lehnen Unkrautvernichtungsmittel ab – Bauernverband befürwortet den Einsatz
In der Europäischen Union wird aktuell darüber gestritten, ob Glyphosat für weitere zehn Jahre zugelassen sein sollte. Viele Landwirte würden das begrüßen. Das Mittel gilt weltweit als der am häufigsten eingesetzte Wirkstoff und steht deshalb besonders im Brennpunkt. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat keine gravierenden Bedenken geäußert. Glyphosat ist für die Direktbestellung nötig. Das Verfahren gilt als besonders bodenschonend, da es Humusabbau, Bodenerosion sowie Bodenverdichtung vermeidet. Allerdings ist Glyphosat auch nach Meinung vieler Wissenschaftler mitverantwortlich für die schwindende Artenvielfalt, vor allem bei Insekten. Daraus ergeben sich Risiken für Landwirtschaft und Obstbau. Statt auf Glyphosat sollte man auf schonendere Methoden setzen, so heißt es.
Glyphosat ist der am meisten und am besten überprüfte Wirkstoff und alle unabhängigen und seriösen Gutachten bestätigen keine schädlichen Wirkungen, sagt Harald Peetz, der Kulmbacher Kreisobmann des Bauernverbandes. Damit sei die Verlängerung der Zulassung so wie sie die EU plant nur der logische Schritt. „Dass unsere durch grüne Ideologien und durch eine Ablehnung der konventionellen Landwirtschaft geprägte Ampelregierung in Berlin wieder mal einen Sonderweg zu Lasten der Deutschen Bauern geht, haben wir in den letzten beiden Jahren leider schon öfters erlebt und es verwundert mich nicht mehr“, so Peetz.
Abgesehen davon, dass in Deutschland der weitaus größere Teil des Mittels nicht in der Landwirtschaft eingesetzt wird, sondern vor allem seine Anwendung in Privatgärten und Hofeinfahrten so wie bei der Bahn, dem Straßenbauamt und auf Flughäfen findet, dürfe Glyphosat von der Landwirtschaft in Deutschland nur vor der Saat oder nach der Ernte eingesetzt werden. Dadurch könne kein Wirkstoff in die Kulturpflanzen kommen. Wenn es also Rückstände in Lebensmittel geben sollte, müsse man sich die Herkunft der Grundprodukte anschauen. Denn, dass in anderen Ländern außerhalb der EU Glyphosat auch noch zur Abreifbeschleunigung eingesetzt wird, dafür könne der Deutsche oder Europäische Landwirt nichts. Oder, dass in Nord- und Südamerika und in Asien Pflanzen gentechnisch verändert würden, vor allem Soja, das nicht nur im Tiertrog landet, sondern auch direkt auf dem Teller, damit die Pflanzen Glyphosat verträglich sind und der Wirkstoff dann während der Vegetation eingesetzt werden kann. „Da wäre unsere Regierung in Berlin gefordert, dafür zu sorgen das solche Lebensmittel nicht auf den Europäischen Markt kommen und nicht nur die Deutschen Bauern durch immer neue Auflagen und Verbote zu benachteiligen.“
Für den Kreisobmann ist klar: „Es kann auch eine konventionelle Landwirtschaft ohne Glyphosat geben, aber die Nachteile für die Umwelt werden groß sein.“ Nachteile beim Humusaufbau, weil wieder mehr gepflügt werden muss, höhere Erosion, weil der Boden nicht mehr so lange bedeckt sein kann, mehr CO2 Ausstoß durch mehr Überfahrten mit der Egge oder dem Striegel bei der mechanischen Unkrautbekämpfung. Die Biolandwirtschaft habe diese Probleme jetzt schon. Daraus resultierte eine schlechterer CO-2-Fußabdruck und natürlich werde die Produktion teurer, was die heimische Landwirtschaft weiter schädigt und uns noch mehr von nicht nach deutschen Standards im Ausland produzierten Produkten abhängig macht. Peetz: „Wir wollen ja alle Lebensmittel aus der Region essen, aber das Kaufverhalten zeigt leider etwas anderes.“
„Glyphosat ist ein schönes Thema, wie wissenschaftsfremd und Ideologiereich die aktuelle Bundesregierung und besonders die Grünen agieren“, sagt Martin Baumgärtner, Landwirt aus UNterzaubach und stellvertretender BBV-Kreisobmann. „Nachdem wir die eigenen letzten Atomkraftwerke abgeschaltet haben und nun unseren fehlenden Strom mit grünen Atomstrom aus den Nachbarländern beziehen, komme der nächste Paukenschlag. „Ich hoffe nur, dass die Bahn und die Kommunen keine Ausnahmegenehmigung erhalten“, so Baumgärtner weiter. Grundsätzlich sei es mal wieder eine Wettbewerbsverzerrung innerhalb der EU und eine Egoistische Wählerbefriedigung der Grünen auf den Rücken der Landwirtschaft.
Eine grundlegend andere Position vertritt naturgemäß der Landesbund für Vogelschutz: Glyphosat sei lange als Wundermittel gegen Unkraut im Garten angepriesen worden, sagt Sprecherin Katrin Geyer von der Kreisgruppe Kulmbach. Doch es töte nicht nur Pflanzen, sondern nehme Tieren auch wichtige Nahrungsquellen und ihren Lebensraum. Die Anwendung des Wirkstoffs im Haus- und Kleingarten sei deshalb 2021 verboten worden. Leider sei Glyphosat damit nicht aus den Gärten verschwunden. Das Verbot gelte nämlich immer erst dann, wenn die Zulassung eines bestimmten Produktes ausläuft. Man könne Unkrautvernichter, die Glyphosat enthalten, also nach wie vor in Baumärkten und im Online-Handel kaufen. Zudem dürfte es noch eine unbekannte Menge solcher Mittel geben, die in Schuppen und Kellern der Gartenbesitzer lagern.
In Frankreich sei der Einsatz von Glyphosat im Haus- und Gartenbereich schon lange verboten. „Solch ein Verbot würde ich mir auch für Deutschland wünschen“, sagt Katrin Geyer. Wer der Natur etwas Gutes tun will, gärtnere also heute schon giftfrei, indem er zum Beispiel Nützlinge in seinen Garten lockt oder giftfrei gegen Unkraut vorgeht, zum Beispiel mit Brennesseljauche.
Ähnlich argumentiert der Bund Naturschutz: „Der BN lehnt die von der EU geplante Verlängerung der Zulassung von Glyphosat ab“, sagt Karlheinz Vollrath, 1. Vorsitzender Kreisgruppe Kulmbach. Der massenhafte Einsatz von Glyphosat gelte laut zahlreicher Studien als wahrscheinlich krebserregend für Menschen und als mitverantwortlich für das weltweite Artensterben. „Glyphosat muss endlich verboten werden“, so Karlheinz Vollrath.
Anstrengende Ausbildung, anspruchsvoller Beruf / 32 zukünftige Landwirte aus Ost-Oberfranken verabschiedet
Selbitz.
32 junge Leute aus dem östlichen Oberfranken haben
ihre Ausbildung zum Landwirt erfolgreich
abgeschlossen. Die zehn Frauen und 22 Männer stammen
aus den Landkreisen Bayreuth, Hof, Kulmbach,
Wunsiedel, einige wenige auch aus benachbarten
Landkreisen. Bei einer Feierstunde in der Eventhalle
Strobel in Dörnthal bei Selbitz wurden sie feierlich
verabschiedet und erhielten ihre Zeugnisse. Urkunden
gab es für die drei Jahrgangsbesten: Florian Eckl
aus Stammbach, Patrick Ponader aus Tröstau und Alina
Sendelbeck aus Creußen. Alle drei haben ihre
Ausbildung mit der Gesamtnote 1 beendet.
Bei der Abschlussfeier hoben sämtliche Redner das hervor, was den Landwirt von vielen anderen Berufen unterscheidet. „Er ist Chemiker, Botaniker, Biologe, Tierpfleger, Tierarzt, Arbeiter und Unternehmer in einer Person“, brachte es Tim Schmidt vom Beruflichen Schulzentrum Hof auf den Punkt. Die duale Ausbildung besitze weltweit einen hohen Stellenwert, so Bernhard Grünewald, Leiter der Staatlichen Berufsschule in Bayreuth. Die Ausbildung biete die besten Voraussetzungen, Herausforderungen einer schnelllebigen Welt zu meistern. Trotzdem werde das duale System nur selten nachgeahmt, weil es anstrengend, teuer und aufwändig sei.
Der Nachwuchs werde aber auch dringend gebraucht, sagte der Hofer BBV-Kreisobmann Ralph Browa. „Wir sind froh über den Nachwuchs auf den Höfen, brauchen jede Arbeitskraft und auch der Maschinenring suche händeringend Betriebshelfer“, so Browa. Er gab den Absolventen fünf Dinge mit, die im Leben unabdingbar seien und die alle mit dem Buchstaben „H“ beginnen: Herz, Hirn, Handeln, Haltung und Humor.
Das Thema Lebensmittelsicherheit sei durch die aktuellen Krisen wieder in den Focus gerückt, sagte Burkhard Traub von der für die Ausbildung der Landwirte zuständigen Regierung von Oberfranken. Die angehenden Landwirte könnten nun ihren Beitrag dazu leisten, denn sie seien bestens darauf vorbereitet, Lebensmittel umweltverträglich zu erzeugen. Sie könnten damit einer überaus sinnhaften Tätigkeit nachgehen, die darüber hinaus auch abwechslungsreich wie kaum eine andere sei und die eine ausgewogene Work-Life-Balance ermögliche.
Auch Jürgen Becher vom Verband für Landwirtschaftliche Fachbildung (vfl) Hof ging auf das Thema Nahrungsmittelsicherheit ein. „Wenn wir alles auslagern, werden wir zu 100 Prozent abhängig sein“, sagte er. Das dürfe nicht das Ziel sein, denn nur die heimische Landwirtschaft könne volle Teller und eine dauerhaft sichere Versorgung mit Lebensmitteln gewährleisten.
Die erfolgreichen Absolventen sind:
Landkreis Bayreuth
Katharina Bär (Bindlach), Michael Görl (Waischenfeld), Tim Höme (Pegnitz), Tim Knörl (Weidenberg), Matthias Knörrer (Bindlach), Julius Läkamp (Goldkronach), Philipp Neidhardt (Mistelgau), Tobias Opel (Speichersdorf), Leonie Rauh (Hollfeld), Alina Sendelbeck (Creußen), Christoph Weber (Bindlach) und Lisa Wunderlich (Bad Berneck).
Landkreis Hof
Florian Eckl (Stammbach), Axel Hick (Weißdorf), Felix Kießling (Münchberg), Martin Köppel (Döhlau) und Emma Seiferth (Zell).
Landkreis Kulmbach
Franziska Bär (Neudrossenfeld), Marc Elsner (Neuenmarkt), Simone Schmidt (Kasendorf), Pascal Ströbel (Kulmbach) und Nicolas Trapper (Kasendorf).
Landkreis Wunsiedel
Julia Amann (Röslau), Michael Braun (Arzberg)Nico Grießhammer (Röslau), Patrick Ponader (Tröstau), Philip Spieler (Selb) und Moritz Wunderlich (Weißenstadt).
Weitere Landkreise
Jeremias Püttner (Schlammersdorf), Moritz Müller (Bad Lobenstein), Leonie Börner (Pullenreuth) und Anna-Lena Steuer aus dem Allgäu
Bild: Sie alle haben ihren Abschluss im Ausbildungsberuf Landwirt erfolgreich gemeistert und erhielten bei der Feierstunde für die Absolventen aus dem östlichen Oberfranken ihre Zeugnisse.
Landwirt: „Der wichtigste Beruf der Welt“ / 32 frischgebackene Landwirte aus Westoberfranken verabschiedet
Kronach.
32 Absolventen des Ausbildungsberufes Landwirt aus
dem westlichen Oberfranken haben in Kronach ihre
Urkunden und Zeugnisse erhalten. Für die
„Freisprechungsfeier“ ist seit dem zurückliegenden
Jahr die Regierung von Oberfranken statt wie vorher
das jeweilige Landwirtschaftsamt zuständig.
Hintergrund ist die Neuorganisation der
Ämterstruktur im Jahr 2021. Lediglich die
Berufsberatung liegt weiterhin in den Händen der
Landwirtschaftsämter. Unter den 32 Absolventen aus
den Landkreisen Bamberg, Bayreuth, Coburg, Forchheim
und Lichtenfels waren auch acht Frauen. Mit Isabell
Zenk und Lukas Krapp kamen zwei der Jahrgangsbesten
aus Scheßlitz im Landkreis Bamberg. Dritter unter
den Jahrgangsbesten war Christian Dinkel aus Bad
Staffelstein.
Isabell Zenk wurde gleichzeitig als Schulbeste ausgezeichnet. Sie hatte bereits eine Ausbildung zur Bankkauffrau erfolgreich absolviert. Doch in der Bank sei es ihr zu trocken gewesen, so dass sie kurzerhand eine Ausbildung zur Landwirtin machte, sagte Jörg Zinn, stellvertretender Schulleiter des Beruflichen Bildungszentrums in Coburg. „Von der Sparkasse zur Powerfrau in der Landwirtschaft“, so beschrieb es Jörg Zinn. Tatsächlich bewirtschaftet Isabell Zink zusammen mit ihrem Vater einen Mastbullenbetrieb bei Scheßlitz, darüber hinaus ist sie auch für den Maschinenring tätig und besitzt sogar den Jagdschein.
Einfach war die Ausbildung wohl für keinen der 32 Absolventen. Sie hatten alle im Corona-Jahr 2020 begonnen und mussten lange mit Online-Unterricht zurechtkommen. Doch das ist noch lange nicht die einzige Schwierigkeit. Wie der Prüfungsausschussvorsitzende Holger Heilingloh sagte, stammten immer mehr Landwirtschafts-Azubis nicht mehr aus landwirtschaftlichen Betrieben. So sehr das auch zu begrüßen sei, so wenig Hintergrundwissen über die Landwirtschaft sei bei diesen Auszubildenden vorhanden. Für viele Betriebe kein einfaches Unterfangen, zumal ja auch die Ausbildungsbetriebe weniger würden.
Trotzdem, Landwirt sei noch immer der wichtigste Beruf der Welt, so der Kronacher Kreisobmann Klaus Siegelin. In keinem anderen Beruf sei es möglich, Nahrungsmittel und Energie zu erzeugen, CO2 in der Fläche zu binden und gleichzeitig Natur- und Artenschutz zu betreiben. „Ihr könnt das alles und damit gehört euch die Zukunft“., rief der Kreisobmann den jungen Leuten zu. Ähnlich argumentierte Gerd Zehnter, Kreisvorsitzender des Verbandes für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf): Wenn Landwirte auch nur mehr 1,4 Prozent der arbeitenden Bevölkerung ausmachen, so seien doch über 50 Prozent der Fläche in Deutschland in Bauernhand. Damit habe die Landwirtschaft nicht nur eine Sonderstellung, sondern trage auch eine große Verantwortung.
„Die Bedeutung von Nahrungsmittelsicherheit ist uns allen vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen wieder so richtig bewusst geworden“, sagte Burkhard Traub von der Regierung. Doch Landwirte stünden noch für vieles mehr, für den Erhalt der Kulturlandschaft für das gesellschaftliche Leben auf dem Land, für ein aktives Dorfleben und eine lebendige Dorfkultur. Eine fundierte landwirtschaftliche Ausbildung bezeichnete Traub als bestmögliche Vorbereitung auf das künftige Berufsleben. Der stellvertretende Kronacher Landrat Gerhard Löffler gab den Absolventen noch mit auf den Weg, dass die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, nicht unterschätzt werden dürfe. An die Eltern appellierte er dabei, „die Jungen auch mal gewähren zu lassen“.
Die folgenden jungen Leute haben ihre Ausbildung zum Landwirt erfolgreich bestanden.
Landkreis Bamberg:
Sebastian Görtler (Oberhaid), Johannes Hänchen (Heiligenstadt), Lukas Krapp (Scheßlitz), Michael Rehner (Burgebrach), Vanessa Sauer (Heiligenstadt), Adrian Starklauf (Bamberg), Eva Willert (Burgebrach), Regina Wolf (Hallstadt) und Isabell Zenk (Scheßlitz).
Landkreis Bayreuth: Lukas Schatz (Aufseß.
Stadt und Landkreis Coburg:
Stefan Angermüller (Rödental), Knut Kettel (Rödental), Elias Thamm (Fürth am Berg) und Sarah Sandmann (Coburg).
Stadt und Landkreis Forchheim:
Lisa Dressel (Heroldsbach-Poppendorf), Jakob Endres (Forchheim), Patrick Galster (Leutenbach), und Johannes Heilmann (Hausen).
Landkreis Kronach: Marina Grebner (Wilhelmsthal) und Kristina Pfadenhauer (Pressig).
Landkreis Lichtenfels:
Christian Dinkel (Bad Staffelstein), Manuel Pfister (Weismain), Julian Schaible (Altenkunstadt) und Jakob Weis (Bad Staffelstein).
Aus oberfränkischen Nachbarlandkreisen wurden verabschiedet:
Marius Engel (Kalchreuth), Matthias Parsche (Eckenthal), Oliver Ehrlich (Untermerzbach), Jonas Vierling (Stettfeld), Marvin Roth (Heldburg), Walter Morgenstern (Thüngen) und Oliver Wolf (Uhlstädt-Kirchhasel).
Bilder:
1. Isabell Zenk gilt als Schulbeste des gesamten
Prüfungsjahrgangs. Dafür erhielt sie aus den Händen
des stellvertretenden Schulleiters Jörg Zinn aus
Coburg unter anderem eine Anerkennungsurkunde und
einen Geldpreis.
2. Diese jungen Leute aus den Städten und
Landkreisen Bamberg, Coburg, Forchheim und
Lichtenfels haben ihren Berufsabschluss zum Landwirt
erfolgreich absolviert.
BBV als Denkfabrik für die gesamte Gesellschaft / Kreiserntedank im Kronacher Land – Effelter feierte Apfelfest zum Dorfjubiläum
Effelter.
Eingebettet in die Feierlichkeiten zum 800-jährigen
Bestehen des Dorfes Effelter auf dem Höhenrücken des
Frankenwaldes, hat der Kronacher BBV-Kreisverband
sein Erntedankfest gefeiert. Gleichzeitig wurde das
neue Dorfgemeinschaftshaus eingeweiht und auch der
traditionelle Apfelmarkt fand passend zu Erntedank
statt, so dass die Dorfgemeinschaft und die
örtlichen Vereine ein ganzes Wochenende lang auf den
Beinen waren und mit ihren Aktivitäten viele Gäste
von weither angelockt haben.
Einer davon war Günther Felßner. Große Worte fand der bayerische BBV-Präsident bei seiner Festansprache: „Wir als Landwirtschaft gehen in ein neues Zeitalter“, sagte er. Ernährung sowieso, Energie auch, dazu die Dekarbonisierung, also langfristig die Schaffung einer kohlenstofffreien Wirtschaft, um die Emissionen zu verringern, und natürlich auch der Schutz der Artenvielfalt, das alles sollen die Aufgaben der Landwirtschaft der Zukunft sein. „Das ist unser Green Deal, sagte Felßner: „Die Menschen ernähren, sie mit Energie zu versorgen, Erdöl in Kunststoffen zu ersetzen und unsere Lebensgrundlagen zu schützen.“ Der Bauernverband will dabei nicht mehr nur für die zwei Prozent der Landwirte tätig sein, sondern sich als „Denkfabrik in Sachen Nachhaltigkeit für die gesamte Gesellschaft“ verstehen. Auch mit der bayerischen Landwirtschaft hat Felßner Großes vor. Sie soll der erste Sektor sein, der CO-2-neutral produzieren wird, und das vielleicht sogar in Deutschland oder in ganz Europa.
Kreisobmann
Klaus Siegelin hatte zuvor Alarm geschlagen, was den
Zustand der Wälder im Frankenwald angeht. ER sprach
von einer wahren Katastrophe. Ganze Täler und ganze
Höhenzüge seien vom Borkenkäfer leer gefressen
worden. „Der Käfer hat bei uns ganze Arbeit
geleistet“, sagte Klaus Siegelin. Der Aufwand ganzer
Generationen sei binnen weniger Jahre zerstört
worden. Unmengen von Vermögen, Altersvorsorge und
auch von Heimat seien praktisch vernichtet. Die
wahren Folgen seien noch lange nicht absehbar.
Und auch auf den Feldern fiel die Bilanz im Kronacher Land nicht ungetrübt aus. Sonne satt bis Mitte August, dann aber sei die Ernte von den heftigen Niederschlägen jäh unterbrochen worden. „Aus Brotweizen und aus Braugerste wurde Futtergetreide“, sagte der Kreisobmann. So manche Hoffnung habe sich nicht erfüllt. Auch was die Rahmenbedingungen seitens der Politik angeht, zeigte sich Klaus Siegelin skeptisch und schließlich machen auch die gestiegenen Produktionskosten den Landwirten im Landkreis schwer zu schaffen.
Nichts
gegen Vegetarier oder Veganer, so die
Europaabgeordnete Monika Hohlmeier. Wichtig sei aber
doch die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit der
Lebensmittel. Und da gehöre Fleisch eben auch dazu.
„Niemand soll einem anderen vorschreiben, was er
essen darf.“ Diese Auffassung vertrat der örtliche
CSU-Bundestagsabgeordnete Jonas Geissler. Wenn
Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in seinem
Haus ein Fleischverbot ausgesprochen habe, so sei
das ein Schlag ins Gesicht aller Bauern. Angesichts
der vielen Probleme rief Landrat Klaus Löffler zu
Mut und Optimismus für die Zukunft auf. „Es sind die
Menschen unserer Heimat, die das Fundament des
Miteinanders bilden.“
Am
Rande des Kreiserntedankfestes wurde das neue
Dorfgemeinschaftshaus eingeweiht. Das
ortsbildprägende Gebäude entstand während der
zurückliegenden drei Jahre an Stelle der ehemaligen
Schule und schlug mit knapp 1,3 Millionen Euro zu
Buche. Nun liege es An den Menschen, das Haus mit
Leben zu erfüllen, sagte Susanne Grebner,
Bürgermeisterin der Gemeinde Wilhelmstal, zu der
Effelter gehört. Vor dem Hintergrund eines überaus
lebendigen Vereinsleben im Dorf machte sie sich
allerdings wenig Sorgen über die künftige Auslastung
des Hauses. In dem großzügigen, über 100
Quadratmeter großen Gruppenraum war zu Erntedank
eine Ausstellung heimischer Äpfel zu sehen.
Bilder:
1. Zum
Erntedank war der ganze Ort auf den Beinen: Effelter
feierte nicht nur Erntedank, sondern auch ein
Dorfjubiläum.
2. Von
links: die Kronacher Kreisbäuerin Marina Herr,
Apfelkönigin Carina, BBV-Präsident Günthert Gelßner
und Kreisobmann Klaus Siegelin.
3. Neuer Mittelpunkt von Effeltrich: Zu Erntedank
wurde das künftige Gemeinschaftshaus seiner
Bestimmung übergeben.
4. Apfelausstellung
im Apfeldorf: Kaum zu glauben, wie viele
verschiedene Sorten es gibt.
Landfrauen stehen ihren Mann / Gemischte Erntebilanz beim Kulmbacher Kreiserntedankfest
Wirsberg.
Die Landfrauen und ihre Arbeit standen im
Mittelpunkt des Kulmbacher Kreiserntedankfestes, das
der Bauernverband im Wirsberger Bürgerzentrum
gefeiert hat. „Kinder, Küche, Kirche, das war
einmal, heute sind wir auf Augenhöhemit den Männern
auf den Bauernhöfen“ sagte die bayerische
Landesbäuerin Christine Singer aus Murnau. „Die
Landfrauen sind längst eine feste Größe“, so
Kreisobmann Harald Peetz und Landrat Klaus Peter
Söllner stellte fest: „Da hat sich wirklich viel
getan, Landfrauen organisieren, übernehmen
Verantwortung und überörtliche Aufgaben in Politik
und Gesellschaft.“
Hintergrund für die zentrale Rolle der Landfrauenarbeit beim Kreiserntedank war, dass die Landfrauenarbeit im Bauernverband heuer ihr 75-jähriges Bestehen feiert. 1948, als in der Politik Frauen praktisch noch gar nicht vorkamen, war s der Bauernverband, der auf die Arbeit der Landfrauen setzte. Mit Christine Singer stellte sich erstmals im Kulmbacher Land auch die Landesbäuerin vor, die vor knapp einem Jahr in das Amt gewählt wurde. Sie hatte damals die Nachfolge von Anneliese Göller aus dem Bamberger Landkreis angetreten.
Die
Erntekrone auf der reichhaltig geschmückten Bühne
des Bürgerzentrums im Blick teilte Christine Singer
jeder der vier Streben der Krone eine Funktion zu.
Freude, Dank, Sorge aber auch Hoffnung, dafür
stünden die vier Streben. Dank, „dass wir
Mitarbeiter Gottes sein und die Schöpfung bewahren
dürfen“, Freude über die aufgegangene Saat, Sorge
vor dem, was der Landwirtschaft derzeit alles
aufgebürdet wird und Hoffnung, dass es immer wieder
weiter geht. Zusammenhalten könne dies alles das
Miteinander von Bauern und Gesellschaft. Doch dafür
brauche es den Dialog. „Wir müssen uns einmischen,
in die Politik, die Vereine und Organisationen“,
sagte die Landesbäuerin. Nur dann könne man imstande
sein, die Herausforderungen anzunehmen und
Veränderungen zu gestalten.
Zuvor
hatte die Kulmbacher Kreisbäuerin Beate Opel
beklagt, dass Erntedank vielen Menschen egal
geworden sei. Viele Menschen hätten keinen Bezug zur
Landwirtschaft mehr. Deshalb sollten die
Berufskollegen ihre Höfe öffnen und immer wieder
zeigen, „dass wir ehrliche und saubere Arbeit
leisten“. Kirche und Bauern gehörten zusammen, denn
sie seien über die Schöpfung verbunden, sagte
Pfarrer Peter Brünnhäußer von der evangelischen
Kirchengemeinde Wirsberg. Seinen Worten zufolge
hatte die Corona-Pandemie auch ihr Gutes: „Viele
Menschen haben die Natur wieder zu schätzen
gelernt“.
Eine gemischte Erntebilanz zog Kreisobmann Harald Peetz. „Die Ernte im Kulmbacher Land war durchschnittlich, genau wie die Qualität“, sagte er und fügte an: „zumindest, wenn man rechtzeitig geerntet hat. Die nassen Tage Anfang August hätten dann doch einiges zunichte gemacht. Im Kulmbacher Land und speziell in Wirsberg genieße die Landwirtschaft schon noch die notwendige Wertschätzung, darauf legte Bürgermeister Jochen Trier Wert. Wer, wenn nicht die Bauern, sollten die Kulturlandschaft pflegen, wer stünde sonst für die Genussregion? Diese Fragen stellte Landrat Klaus Peter Söllner. Deshalb sei der Landkreis zwingend auf die Arbeit der Bauern angewiesen.
Als
„solide Schlüsselbranche der gesamten Wirtschaft“
bezeichnete der Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig
(Freie Wähler) die Landwirtschaft. Er erinnerte
daran, dass die Ernährungssicherheit und der
Wohlstand immer abhängig von er Landwirtschaft
seien. „Auch daran soll uns Erntedank erinnern“, so
Rainer Ludwig. In Zukunft werde es ganz besonders
auf die Landwirtschaft ankommen. Das stellte Martin
Schöffel, agrarpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion
im Landtag, fest. Schließlich nehme die
landwirtschaftliche Fläche weltweit ab, während die
Bevölkerung gleichzeitig extrem ansteige. Schöffel:
„Wir sollten deshalb alles daransetzen, dass wir
auch in Zukunft noch unsere Bauern haben.“
Bilder:
1. Die
bayerische Landesbäuerin Christine Singer.
2. Karin Lauterbach und Lukas Tröger zeigten beim
Kreiserntedankfest, was die Genussregion so alles zu
bieten hat.
3. Von
links: Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel,
Landesbäuerin Christine Singer, die stellvertretende
Kreisbäuerin Gudrun Passing und Pfarrer Peter
Brünnhäußer.
4. Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel.
5. Von
links: Kreisobmann Harald Peetz, Landrat Klaus Peter
Söllner, Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel,
Landesbäuerin Christine Singer, MdL Rainer Ludwig,
die stellvertretende Kreisbäuerin Gudrun Passing und
MdL Martin Schöffel.
Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit der Bauern / Publikumsmagnet Landwirtschaft: Viele hundert Besucher beim Erntedank auf dem Fischlhof
Heroldsreuth.
Zum ersten Mal nach vier Jahren gab es wieder den
Tag der Landwirtschaft in Pegnitz. Diesmal aber ganz
anders: nicht in der Christian-Sammet-Halle und auch
nicht auf dem Marktplatz, sondern direkt vor Ort auf
einem Bauernhof feierten die Interessensgemeinschaft
und der Bauernverband das Erntedankfest.
Den Besuchern hat es gefallen. Viele hundert waren im Laufe des Tages nach Heroldsreuth auf den Fischlhof der Familie Strobl, einem biologisch ausgerichteten Nebenerwerbsbetrieb mit Direktvermarktung, gekommen. Weil Heroldsreuth aus genau zwei landwirtschaftlichen Betrieben besteht, machte auch der benachbarte Hof von Renate und Hermann Lehner mit und öffnete seine Stalltür. Das Angebot, Stall und Melkstand des konventionellen Milchviehbetriebs zu besichtigen, wurde rege in Anspruch genommen.
Tag
der Landwirtschaft, das bedeutete auch zahlreiche
Aktivitäten rund um den Bauernhof. Fast 40
Informations- und Verkaufsstände,
Maschinenvorführungen, aber auch traditionelle
Handwerkskunst und natürlich viele Angebote extra
für Kinder. Da gab es einen Tretschlepperparcours
und ein Getreideschatzbad, die Käserei Bayreuth
präsentierte ihre Produkte anhand von Kostproben,
die BBV-Landfrauen zeigten, wie man Butter selbst
macht und die Jägervereinigung führte vor, wie sie
per Drohne Rehkitze vor dem Tod rettet.
Kräuterpädagogin Monika Börner aus Münchs bei Betzenstein informierte über ihre segensreiche Arbeit und darüber, was man aus vermeintlichen Unkräutern alles machen kann. Imker Toni Herzing aus Büchenbach weckte die Begeisterung für heimischen Honig und Korbmacher Augustin Friedrich aus Altendorf zeigte live vor Ort, wie er seine Flechtwaren herstellt. Dazu gab es so ziemlich alles, was die Genussregion zu bieten hat: Pulled Beef Burger vom Biohof Brunner aus Kemnath, Eier von den Gebhardtshofer Weidehennen aus Weidenberg und Bauernhof-Eis von Rebekka Kießling und ihrer Eis-Manufaktur aus Münchberg. Dazu waren viele andere Zusammenschlüsse nach Heroldsreuth gekommen, die alle zusammen Landwirtschaft ausmachen: Der Maschinenring Bayreuth-Pegnitz, das Amt für Landwirtschaft und der Landhandel unter anderem mit der BayWa.
„Zum
ersten Mal feiert unser kompletter Weiler zu
Erntedank einen Tag der Landwirtschaft“, freute sich
Tanja Strobl, die den Fischlhof zusammen mit Ehemann
Markus und der Familie bewirtschaftet. Ziel der
Großveranstaltung sei es Landwirtschaft zu
vermitteln und die Wertschätzung dafür in den
Vordergrund stellen, so die Vorsitzende der
Interessensgemeinschaft und frühere Kreisbäuerin
Katrin Lang
Eröffnet wurde der Tag der Landwirtschaft mit einem ökumenischen Erntedankgottesdienst, den der evangelische Dekan Markus Rausch und die katholische Wortgottesdienst-Beauftagte Regina Schrembs in der Maschinenhalle feierten. Dort begrüßte Kreisobmann Karl Lappe später auch die Gäste. Ernährung sei das höchste Gut, auch wenn die Versorgung mit Lebensmitteln meist als selbstverständlich hingenommen werde, sagte er. Wie wichtig es sein kann, sich selbst zu versorgen habe die Energiefrage im Zuge des Krieges in der Ukraine gezeigt. Stilllegungspläne der Bundesregierung für landwirtschaftliche Flächen seien deshalb völlig unverständlich. „Diese Flächen fehlen am Ende für Ernährung und Energie und bringen nichts für das Klima.“
Wertschätzung
und Anerkennung für das große Engagement und die
harte Arbeit der Landwirte kam auch von Sandra
Huber, der zweiten Bürgermeisterin von Pegnitz.
Landrat Florian Wiedemann stellte klar, dass das
alltägliche Arbeitspensum in der Landwirtschaft von
keinem anderen Berufsstand übertroffen werde. „Wir
machen alle eine saubere Arbeit, wir lieben unsere
Tiere und wir wollen, dass es auch in Zukunft
Landwirtschaft in Bayern gibt“, sagte die
oberfränkische Bezirksbäuerin Beate Opel.
Bilder:
1+2. Großer Andrang herrschte in dem kleinen Weiler
Heroldsreuth bei Pegnitz zum Tag der Landwirtschaft,
verbunden mit dem Kreiserntedankfest des Bayreuther
Bauernverbandes.
3. Auf ihren Schultern lag die wesentliche Arbeit
zum Tag der Landwirtschaft (von links): Katrin Lang,
Tanja Strobl, Hermann und Renate Lehnert mit ihren
Kindern Leonie und Emelie.
4. Wie kommt der Honig ins Glas? Bio-Imker Toni
Herzing aus Büchenbach sorgte beim Tag der
Landwirtschaft für Aufklärung.
Realismus statt Ideologie und Nostalgie: Nutzung ist der beste Schutz / Forstwirtschaftliche Vereinigung Oberfranken feierte auf Kloster Banz ihr 50-jähriges Bestehen
Kloster Banz. Gegen die Ausweisung weiterer Schutzgebiete und gegen Stilllegungspläne für den Wald hat sich der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ausgesprochen. Diese Herangehensweise an den deutschen Wald sei nostalgisch und ideologisch, aber nicht realistisch, sagte Aiwanger beim 50-jährigen Jubiläum der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberfranken (FVO) auf Kloster Banz. Die Forstwirtschaftliche Vereinigung ist die Dachorganisation der zwölf oberfränkischen Waldbesitzervereinigungen und Forstbetriebsgemeinschaften mit zusammen rund 16500 Waldbesitzern und einer Fläche von etwa 115.000 Hektar Wald. Die Waldbesitzervereinigungen und Forstbetriebsgemeinschaften haben zusammen 60 hauptamtliche Mitarbeiter.
„Wir brauchen keinen dritten oder gar vierten Nationalpark in Bayern“, so Aiwanger. Klimaangepasste Wälder müssten gezielt durch menschliches Zutun geschaffen werden, sie entstünden nicht, indem man den Wald sich selbst überlässt. „Stilllegung ist keine Strategie“, sagte Aiwanger und rief dazu auf, die Gegner der Nutzung fachlich zu überzeugen.
„Völlig schräg“ sei es auch, wenn Brüssel jetzt wieder mit den Diskussionen beginne, ob Holz eine nachhaltige Energie sei und gleichzeitig auf fossile Energieträger setzt. „Welche Verrenkungen man macht, um Wälder still zu legen“, wunderte sich Aiwanger und sprach sich stattdessen für eine intensivere Waldwirtschaft aus. „Wir haben viel zu viel Holz in der Fläche stehen, liegen und vor sich hingammeln.“ Der Minister rechnete vor, dass ein Ster Brennholz 120 Liter Heizöl ersetzt. Deshalb sollte man nicht das zulassen, was ideologisch erwünscht, sondern das, was technisch machbar ist.
Kritik übte Aiwanger auch an der bayerischen Forstreform. Mit der Reduzierung der Reviere und der dadurch entstandenen viel zu großen Gebiete sei man deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Er forderte stattdessen mehr Personal, kleinere Reviere und eine höhere Betreuungsintensität.
Der Forstwirtschaftlichen Vereinigung bescheinigte Aiwanger eine unverzichtbare Arbeit, die Mitarbeiter würden nicht selten bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gehen. An die Waldbesitzer appellierte er, noch mehr die Öffentlichkeit zu suchen als bisher und die Menschen aufzuklären. „Wenn Ideologen über anderer Eigentum bestimmen, dann wird es gefährlich“. So Aiwanger.
Zuvor
hatte der FVO-Vorsitzende Wolfgang Schultheiß (Großheirath)
die wichtigsten Herausforderungen der Waldbesitzer
für die kommenden Jahre aufgezählt. Die
Wiederbewaldung der vom Borkenkäfer kahlgefressenen
Wälder gehört genauso dazu, wie der Waldumbau hin zu
klimatoleranten Baumarten. Gar nicht mehr so einfach
sei es, die Motivation der Waldbesitzer
aufrechtzuerhalten, da große Teile der Gesellschaft
den Wald nur noch als Freizeit- und Naturparadies
sieht. „Dieser Bewegung entgegenzuwirken, bedarf
großer Anstrengungen und benötige viel Kraft.“
Vor dem Hintergrund des Einflusses radikaler Umweltverbände und der Regulierungswut der Politik werde die Arbeit der FVO in Zukunft noch wichtiger, sagte Josef Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes. „Wir müssen viel mehr, als in der Vergangenheit unsere Interessen vertreten und mit der Gesellschaft kommunizieren“, so Ziegler. Weitere Herausforderungen sah er auch im Strukturwandel der Eigentümer und dem zunehmenden Beratungsbedarf der Waldbesitzer. Handlungsbedarf gebe es schließlich auch durch die Klimaerwärmung, die einen beschleunigten Baumartenwechsel notwendig mache.
Trotzdem habe die FVO allen Grund, positiv in die Zukunft zu blicken, so die bayerische Waldprinzessin Simone Brunner. Der Zusammenschuss habe sich als All-Round-Dienstleister bewährt und fünf Jahrzehnte lang erfolgreiche, vorausschauende und zukunftsweisende Arbeit geleistet.
Bilder:
1. Gruppenbild
zum 50. Geburtstag der Forstwirtschaftlichen
Vereinigung Oberfranken mit Wirtschaftsminister
Hubert Aiwanger den Vertretern aller
Waldbesitzervereinigung und
Forstbetriebsgemeinschaften aus dem
Regierungsbezirk.
2. Zum Festakt anlässlich der 50-Jahr-Feier der
Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberfranken
begrüßte der Vorsitzende Wolfgang Schultheiß den
bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger
(links). Rechts im Bild: FVO-Geschäftsführer Jörg
Ermert.
Erntedank auf dem Fischlhof / Großveranstaltung im kleinen Heroldsreuth: Tag der Landwirtschaft in Heroldsreuth
Heroldsreuth.
Nach vier Jahren Pause gibt es zum Erntedankfest
heuer erstmals wieder einen Tag der Landwirtschaft
in Pegnitz. Die im Zwei-Jahres-Turnus stattfindende
Veranstaltung musste zuletzt Corona-bedingt
ersatzlos gestrichen werden. Die Pause haben die
Verantwortlichen zum Anlass genommen, den Tag der
Landwirtschaft komplett neu aufzustellen. Er findet
erstmals weder in der Christian-Sammet-Halle noch
auf dem Marktplatz, sondern direkt auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb statt.
Genau genommen auf zwei Betrieben: dem Fischlhof der Familie Strobl und auf dem benachbarten Betrieb der Familie Lehner in Heroldsreuth. „Damit feiert der komplette Weiler zu Erntedank einen Tag der Landwirtschaft“, freut sich Tanja Strobl, die den Fischlhof zusammen mit Ehemann Markus und der Familie bewirtschaftet.
„Wir wollen Landwirtschaft vermitteln und die Wertschätzung dafür in den Vordergrund stellen“, sagt Katrin Lang, frühere Kreisbäuerin und Vorsitzende der Interessendgemeinschaft zum Tag der Landwirtschaft. Eröffnet wird die Veranstaltung um 11 Uhr mit einer Begrüßung durch Kreisbäuerin Angelika Seyferth, anschließend laden der evangelische Dekan Markus Rausch und der katholische Pfarrer Norbert Förster zu einem ökumenischer Erntedankgottesdienst in der Maschinenhalle ein. Gegen 13 Uhr werden Kreisobmann Karl Lappe, die zweite Bürgermeisterin von Pegnitz Sandra Huber und die Familie Strobl die Gäste begrüßen.
Bis mindestens 17 Uhr ist dann auf den beiden Höfen einiges geboten. An fast 40 Ständen können sich die Besucher informieren, Praktikern über die Schulter blicken oder das reichhaltige Sortiment der Genussregion probieren. Da kommen der Korbmacher Augustin Friedrich und der Rechenmacher Konrad Berner. Landtechnikunternehmen zeigen, wie moderne Melktechnik funktioniert. Die Bayernland-Käserei Bayreuth stellt ihr Sortiment vor, für Kinder gibt es einen Tretschlepper-Parcours, wobei die Schlepper später sogar verlost werden. Die Jägervereinigung zeigt, wie die Kitzrettung per Drohne funktioniert, der Maschinenring Bayreuth-Pegnitz führt einen Klauenpflegestand vor und Imker Tini Herzing zeigt, wo der Honig herkommt und was man alles damit machen kann.
Eine ganz besondere Aktion im Milchjahr 2023 gibt es von den Landfrauen. Sie zeigen, wie man richtig ausbuttert, wie man Butter und Buttermilch selbst herstellt und bieten auch entsprechende Kostproben an. Dazu gibt es Pulled Beef Burger, Steaks, Bratwürste, Kaffee und Kuchen Bauernhofeis und alles, was die heimische Landwirtschaft zu bieten hat. “Ohne die Bauern wäre nichts auf dem Tisch“, das ist die Botschaft, die Tanja Strobl allen Besuchern beim Tag der Landwirtschaft mit auf dem Weg geben möchte. Auch der benachbarte konventionelle Milchviehbetrieb der Familie Lehner wird sich mit einem Tag der offenen Stalltür beteiligen und zur Besichtigung des Stalles und des Melkstandes einladen.
Der Fischlhof der Familie Strobl ist ein biologisch ausgerichteter Nebenerwerbsbetrieb mit Direktvermarktung. Vor allem die Vermarktung von Eiern und den entsprechenden Produkten von Nudeln bis zum Eierlikör ist einer der wichtigste Betriebszweige. Die Familie beliefert Bioläden, Cafés und Bäckereien in der Umgebung. Derzeit gibt es ein Hühnermobil mit rund 180 Tieren, Ende des Monats soll ein weiteres Hühnermobil dazukommen. Tanja Strobl ist ausgebildete Erlebnisbäuerin, die immer wieder auch Schulklassen das Thema Landwirtschaft näherbringt.
Der Tag der Landwirtschaft findet am Sonntag, 24. September von 11 bis 17 Uhr in Heroldsreuth 1, 91257 Pegnitz statt. Die Zufahrt ist von Pegnitz kommend nach Horlach und Nemschenreuth in Richtung Weidlwang und dann links ab nach Heroldsreuth.
Bild: Kreisbäuerin Angelika Seyferth, Tanja Strobl vom Fischlhof und die frühere Kreisbäuerin und Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Katrin Lang haben auf dem Fischlhof in Heroldsreuth die letzten Vorbereitungen zum Tag der Landwirtschaft am 24. September ab 11 Uhr getroffen.
Zentraler Anlaufpunkt für die Landwirtschaft der Region / Fast fünf Jahre nach dem ersten Spatenstich: Grünes Zentrum in Münchberg eingeweiht
Münchberg.
Nicht nur der Name ist grün, es steckt auch viel
Grünes drin, zumindest aus baulicher Sicht: das neue
Grüne Zentrum in Münchberg ist in jeder Hinsicht ein
Vorzeigeprojekt. Die bayerische
Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat das
rund elf Millionen Euro teure Bauwerk am nördlichen
Ortseingang von Münchberg am Donnerstag feierlich
eingeweiht. In dem Gebäude haben das Amt für
Landwirtschaft. Ernährung und Forsten
Bayreuth-Münchberg, die Landwirtschaftsschule, der
Bauernverband, der Maschinenring Münchberg und
Umgebung sowie die Zentrale Vergabestelle der
Führungsakademie eine neue Heimat gefunden.
Die Fassade ist aus Fichtenholz, die Natursteine stammen aus dem Fichtelgebirge, geheizt wird mit Pellets, das Klima wird mit Hilfe einer Geothermie reguliert. Auf den Dächern grünt und blüht es zwischen den Solarmodulen, der Innenhof auf der hinteren Seite ist ein Paradies für Insekten und sämtliche Parkplätze wurden versickerungsoffen gestaltet. Dazu wurden 30 neue Bäume und an die 300 neue Sträucher gepflanzt. Kaum ein Punkt, der nicht berücksichtigt wurde, kein Wunsch, der offen blieb.
Dabei
gilt in Münchberg der Spruch „Was lange währt wird
endlich gut“ in ganz besonderer Art und Weise. Schon
im Oktober 2018 fand der erste Spatenstich statt,
längst waren alle Mieter in das landkreiseigene
Gebäude eingezogen. Doch die offizielle Einweihung
ließ trotzdem lange auf sich warten. Corona-bedingt
wurde sie immer wieder verschoben. Für die
Verantwortlichen war es ein besonders gutes Zeichen,
dass die Einweihung nun am Geburtstag der
Landwirtschaftsministerin stattfand.
Michaela Kaniber nannte das Haus wundervoll und einzigartig. Besonders an der Verwendung des Baustoffes Holz fand sie großen Gefallen. Sie sparte in ihrer Rede aber auch nicht an Kritik an der Bundespolitik. Dort würden jetzt gerade die Gelder gekürzt, die am dringendsten benötigt würden. Gelder für den gebeutelten Wald beispielsweise, Gelder für den ländlichen Raum und für den ökologischen Landbau. „Gerade das Fichtelgebirge und der Frankenwald hätten jetzt die größtmögliche Unterstützung verdient“, sagte Michaela Kaniber. Rhetorisch stellte sie die Frage: „Wo bleibt die Verantwortung diese grünen Lungen zu retten?“ Kurz vor der Veranstaltung hatte Daniela Janker von der Bayerischen Forstverwaltung die Ministerin vom Ausmaß der Borgenkäferschäden in der Region informiert.
Auch, dass die Nutztierhaltung vom Bundeslandwirtschaftsministerium immer wieder in Misskredit gebracht werde, prangerte Michaela Kaniber an. Eine Reduzierung um 50 Prozent, wie von einer Staatssekretärin aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium ins Gespräch gebracht, käme in Bayern einer Katastrophe gleich. Es würde nichts anderes bedeuten, als dass rund 11000 landwirtschaftliche Betriebe innerhalb der nächsten fünf Jahre ihre Schotten dicht machen müssten. „Wir müssen uns wehren gegen diese grüne Ideologie, die Landwirtschaft ist der Problemlöser, nicht der Problemmacher“, so die Ministerin.
Sämtliche
Redner in einer moderierten Grußwortrunde
pflichteten dem bei und würdigten den Neubau als
Gewinn für die gesamte Region. Das Grüne Zentrum sei
in vielerlei Hinsicht ein Gewinn für die Stadt,
sagte Bürgermeister Christian Zuber. Die räumliche
Näher zu den anderen Organisationen sei ein
Riesenvorteil für die tägliche Arbeit, so
Geschäftsführer Daniel Seuß vom Maschinenring
Münchberg. Nach den Worten von Behördenleiter
Michael Schmidt ist der moderne und innovative
Schulstandort Münchberg entscheidend für die
Weiterentwicklung der Region. Wilhelm Böhmer,
Direktor des Bauernverbandes für alle drei
fränkischen Regierungsbezirke, sprach von einem
„tollen Arbeits- und Beratungsumfeld“. Von der
Gemeinschaft mit dem Amt, der Schule und dem
Maschinenring könnten künftig alle Mitglieder nur
profitieren.
Das neue Grüne Zentrum im Norden Münchbergs hat eine Nutzfläche von über 3000 Quadratmeter, in dem Gebäude arbeiten 80 Menschen.
Bilder:
1. Markantes
Bauwerk im Norden von Münchberg: Das neue Grüne
Zentrum beherbergt das Landwirtschaftsamt, die
Landwirtschaftsschule, den Bauernverband, den
Maschinenring und die Vergabestelle der
Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten.
2. Behördenleiter
Michael Schmidt, Landwirtschaftsministerin Michaela
Kaniber, Peter Scherm vom Maschinenring, der
Landtagsabgeordnete Martin Schöffel und Landrat
Oliver Bär (von links) informieren sich auf einer
Bildschirmpräsentation über die Aufgabenbereiche der
Organisationen.
3. Andreas
Fickenscher vom gleichnamigen Backhaus in Münchberg
überreichte Landwirtschaftsministerin Michaela
Kaniber eine Geburtstagstorte. Links im Bild Landrat
Oliver Bär.
Ampfer, Distel, Kreuzkraut: Mit „Rotoviper“ und „Rumbojet“ gegen Unkraut im Grünland / High Tech in der Landwirtschaft schont die Umwelt und macht die Arbeit effektiver
Bayreuth.
Wie High Tech in der Landwirtschaft dazu beitragen
kann, den Umweltgedanken zu fördern, Ressourcen zu
schützen und gleichzeitig effektiver zu arbeiten,
das haben der Maschinenring Bayreuth-Pegnitz, die
Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks und
das Amt für Landwirtschaft jetzt in Bayreuth
eindrucksvoll demonstriert. Konkret ging es bei
einem Feldtag auf dem Gelände der Lehranstalten
darum, Unkraut auf Grünland möglichst wirkungsvoll
zu bekämpfen und dabei den Herbizid-Einsatz auf ein
Minimum zu beschränken.
Die beteiligten Partner hatten dazu drei Möglichkeiten aufgezeigt, der Einsatz von Heißwasser, der „Rotoviper“, eine Walze, die hochgeschossene Unkräuter gezielt mit Herbiziden benetzt und, ganz neu, den „Rumbojet“, der Unkräuter mittels eine Kamera punktgenau erkennt und via Herbizid bekämpft. Alle drei Möglichkeiten haben eines gemeinsam: Nicht mehr die gesamte Fläche wird mit Herbiziden gespritzt.
Notwendig sei die Bekämpfung von Ampfer, Distel und Kreuzkraut im Grünland schon immer gewesen. Nachdem im zurückliegenden Jahr der flächendeckende Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Dauergrünland verboten wurde, habe es jedoch dringenden Handlungsbedarf gegeben, erklärte Johannes Scherm, Geschäftsführer des Maschinenrings Bayreuth-Pegnitz.
Das Non Plus Ultra ist der „Rumbojet“, eine Neuentwicklung des Landtechnik-Herstellers Allgäu Automation, die der Maschinenring Bayreuth-Pegnitz ab sofort seinen Mitgliedern dank einer Zusammenarbeit mit dem Nachbarring in Tirschenreuth anbieten kann. Das High-Tech-Gerät arbeitet nach dem Motto: „So viel Herbizid wie nötig, so wenig wie möglich“. Nach den Worten von Felix Grosch vom Amt für Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg erkennen zwei Multispektralkameras mittels eingespeicherter Bilder Ampfer oder Kreuzkraut und bringen dem Pflanzenschutz punktgenau auf der zu bekämpfenden Pflanze aus. Bundesweit seien erst 80 Jets im Einsatz, in Oberfranken ist der Maschinenring Bayreuth der erste, der die neue Technik seinen Mitgliedern anbieten kann.
„Unser Ziel ist es, diese Technik auch bei uns zu etablieren“, sagt Johannes Scherm. Das Gerät schafft fünf Hektar und mehr pro Stunde und sei damit auch von der Effektivität unschlagbar. Laut Hersteller beseitigt das Gerät bis zu 80 Prozent der Unkräuter. Es vermeidet Narben und wirkt sich aufgrund des geringen Bodendrucks auch positiv auf die entsprechende Fläche aus. Im Vergleich zur Flächenbehandlung werden je nach Befall rund 90 Prozent der Spritzmittel eingespart, was zum einen die Kosten erheblich senkt und die Umwelt schützt.
Total chemiefrei sei die Bekämpfung mit Heißwasserthermie zwar möglich, die Flächenleistung sei aber eher begrenzt, so dass diese Methode nur im kommunalen Bereich, etwa auf Friedhöfen oder in Parks oder zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners Sinn macht. Immerhin arbeitet der Maschinenring Bayreuth-Pegnitz schon seit fünf Jahren erfolgreich damit. Ein Mitglied des Maschinenrings habe den „Rotoviper“ im Einsatz, eine Art Walze auf zwei Rädern, die Unkräuter aufgrund ihrer Wuchshöhe selektiert und gezielt mit Herbizid benetzt. Die Nachfrage sei aber eher überschaubar, da man unterschiedliche Wuchshöhen von Grünland und Unkraut benötigt.
Beikräuter wie zum Beispiel die stumpfblättrige Ampfer müssen unter anderem deshalb bekämpft werden, weil sie wertvolle Futtergräser verdrängen, zu einer schlechteren Futterqualität führen und die Tiergesundheit beeinträchtigen. Verschiedene, im Grünland vorkommenden Kreuzkräuter enthalten höhere Konzentrationen an hoch giftigen Pyrrolizidin-Alkaloiden. Diese Stoffe sind besonders für Pferde und Rinder sehr giftig und führen zu akuten tödlichen Leberschäden.
Wer sich ein Bild vom Erfolg der Unkrautbekämpfung und den entsprechenden Mitteln dazu machen möchte, könne die entsprechenden Flächen auf dem Gelände der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth besichtigen, so Tobias Weggel von den Lehranstalten. Die Demonstrationsflächen befinden sich in der Nähe des Betonplattenweges vor dem Lehranstalten rechts ab und sind ausgeschildert.
Bild: High Tech auf Grünland: so futuristisch wird es schon bald in der Region aussehen, wenn Landwirte das Unkraut auf ihren Wiesen mit dem Rumbojet umweltschonend und ressourcenschonend bekämpfen.
Kostbares Gut Wasser optimal nutzen: App soll Landwirte bei der Bewässerung unterstützen / Kaum Bedarf im Kulmbacher Land
Kulmbach.
Trockenheit und tropische Temperaturen bereiten der
Landwirtschaft, Gärtnern, Waldbesitzern und auch den
Winzern immer mehr Probleme. Vor allem Nordbayern
ist von Hitze und Trockenheit betroffen. Abhilfe
könnte die Bewässerung von bestimmten Anbauflächen
schaffen. Harald Köppel, Geschäftsführer des
Bauernverbandes Bayreuth/Kulmbach/Kronach winkt
allerdings schon mal ab. In unseren Breiten würden
die Felder bis auf wenige Sonderkulturen kaum
bewässert.
Dem Landwirtschaftsministerium zufolge werden in Bayern aktuell etwa drei Prozent des Freilands bewässert. Im Vergleich zu anderen Ländern sei das ein geringer Wert. „Wir brauchen dennoch dringend intelligente Lösungen zur Bewässerung, damit die Obst- und Gemüsebauern vor allem in Nordbayern auch in Zukunft heimische Lebensmittel herstellen können, denn Wasser wird auch in Bayern immer mehr zum kostbaren Gut“, sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber vor wenigen Tagen bei der Vorstellung einer neuen Bewässerungs-App.
Sie hat das Ziel, Wasser möglichst sparsam einzusetzen. Die App wurde im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums unter Federführung der Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Landwirtschaftliches Bauwesen in Bayern und mit Unterstützung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft entwickelt. Das webbasierte Entscheidungsinstrument hilft den Landwirten und Anbauern, den besten Bewässerungszeitpunkt und die richtige Wassermenge genau zu berechnen. Dazu werden unter anderem Messdaten von 680 Wetterstationen, die Bodengüte, die genutzte Bewässerungstechnik und Daten zu der angebauten Kultur berücksichtigt. So lassen sich Ernteerträge und Qualitäten sichern und gleichzeitig der Wasserverbrauch auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzen. Der Wassereinsatz soll so gesteuert werden, dass nur dann bewässert wird, wenn der zur Verfügung stehende Bodenvorrat aufgebraucht ist und die Pflanzen den Grad der Bodenaustrocknung gerade noch vertragen. Nur der von den Pflanzen durchwurzelte Bodenraum soll Wasser erhalten, nutzloses Versickern wird vermieden.
Und noch einen Vorteil soll die App laut einer Mitteilug bieten: Mit der App lasse sich nicht nur Wasser sparen. Die optimierte Bewässerung sorge auch dafür, dass die Düngung von den Pflanzen zuverlässig aufgenommen werden kann. Damit werde vermieden, dass mit dem nächsten Starkregen wertvollen Nährstoffe in tiefere Bodenschichten oder ins Grundwasser verlagert werden.
Außer den Spargelkulturen in Rothwind, den Obstkulturen in Lindenberg und einigen Erdbeerfeldern würden zumindest in der Region kaum irgendwelche Kulturen bewässert, sagt Harald Köppel vom BBV. Für den normalen Getreideanbau oder für den Anbau von Futter wäre das Bewässern viel zu kostspielig. „Bewässern ist teuer, da braucht man eine Frucht, bei der es sich trägt.“ Anders sei es im Nürnberger Knoblauchsland und auch in Niederbayern, wo auch schon mal der Körnermais oder Zuckerrüben bewässert werden. Was Oberfranken betrifft, so könne sich Köppel vorstellen, dass die Bamberger Gärtner oder auch die Kirschenanbauer um Forchheim herum entsprechende Bewässerungssysteme nutzen. Im Bayreuther, Kulmbacher oder Kronacher Raum spiele die Bewässerung aber kaum eine Rolle.
Was die Zukunft bringt, könne man allerdings nicht sagen. Vielleicht sei es eines Tages auch notwendig, die Felder zu bewässern, um überhaupt noch etwas zu ernten. Noch vor zehn oder 15 Jahren habe man ja auch hier nicht absehen können, dass Oberfranken mal zum Trockengebiet wird.
Die neue App ist für jeden Nutzer in vollem Funktionsumfang kostenlos und sowohl für die Nutzung am PC als auch über das Smartphone geeignet. Zur Bewässerungs-App gelangt man unter www.alb-bayern.de/app. Fundierte Informationen zur Handhabung des Entscheidungsinstruments wurden im Bewässerungsforum Bayern ausgearbeitet, zu finden unter www.alb-bayern.de/bef1.
Bild: Wasser möglichst sparsam einsetzen, das ist das Ziel der neuen Bewässerungs-App. Im Kulmbacher Land kommen derzeit Bewässerungssysteme allerdings kaum zum Einsatz.Landwirte lehnen umstrittene App ab / BBV Bayreuth diskutierte mit den Kandidaten zur Landtags- und Bezirkstagswahl
Bayreuth. Viele Landwirte sperren in diesen Zeiten ihre Hoftore für immer zu. Schuld daran sind eine überzogene Bürokratie, praxisfremde Auflagen, die politischen Rahmenbedingungen und das teilweise schlechte Image, das Bauern in der Gesellschaft haben. In einem Gespräch mit Kandidaten zur Landtags- und Bezirkstagswahl aller Parteien hat der Bauernverband in Bayreuth seine Forderungen und Probleme zur Sprache gebracht. Konsens war dabei, dass die Landwirtschaft vor Ort auch in Zukunft gebraucht wird, um die Menschen mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen.
Flächenstilllegungen seien da eher kontraproduktiv, sagte Kreisobmann Karl Lappe. „Die politische Vorgabe, vier Prozent der Fläche still zu legen versteht doch kein Mensch, wo die Fläche doch aktuell immer knapper wird“, schimpfte er. Das Thema Flächenstilllegungen sah er beispielhaft für viele andere Probleme, mit denen sich Bauern derzeit rumschlagen müssten. Sachkunde und gute fachliche Praxis stünden leider nicht mehr im Vordergrund, stattdessen hätten die „Theoretiker in den Amtsstuben“ das Sagen. Sie wollten den Bauern vorschreiben, wie sie ihre Fläche zu bewirtschaften hätten.
Als besonderes Ärgernis erwies sich dabei die neue FAL-BY-App, mit der die Angaben der Landwirte in ihren Förderanträgen nachgeprüft werden. Die App soll den Bauern helfen, die Flächenangaben im Mehrfachantrag stets auf dem aktuellen Stand zu halten und damit die Auszahlung der Fördergelder sicherzustellen. Hintergrund dafür ist die Einführung eines Flächenmonitoringsystems, das von der EU verpflichtend vorgeschrieben ist. Kern dieses Systems ist die Beobachtung landwirtschaftlicher Fläche mithilfe von Satellitendaten. Die Satelliten prüfen beispielsweise die angebauten Kulturen, die Vorgaben zur Mindestbewirtschaftung oder die Schnittnutzug auf Grünland.
So ist es zumindest gedacht. In der Praxis scheint die App allerdings alles andere als zu funktionieren. Sonnenblumen seien etwa als Getreide identifiziert worden, schmale Grundstücke seien erst gar nicht erkannt worden, so Landwirt Christian Hannig aus Hollfeld. Harald Galster, stellvertretender BBV-Kreisobmann aus Gefrees bemängelte, dass sich die App noch in der Erprobungsphase befinde, bei eventuellen Fehlern aber schon Sanktionen drohten. Harald Köppel, BBV-Geschäftsführer, sagte, dass die App viele Landwirte überfordere, besonders ältere Semester blieben auf der Strecke. Viele Bauern befürchteten auch eine Art Totalüberwachung.
Davon könne keine Rede sein, so Halil Tasdelen von der SPD. Gleichzeitig kritisierte der Landtagskandidat aber auch die zunehmende Bürokratisierung. Martin Schöffel, Landtagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses, gab an, dass auch weiterhin eine persönliche Überprüfung der jeweiligen Fläche durch einen Mitarbeiter des Landwirtschaftsamtes möglich sei. Der Mensch sollte auf jeden Fall das Heft des Handelns in der Hand haben, sagte Tim Pargent, Landtagsabgeordneter der Grünen.
Ablehnung kam dagegen von Stefan Frühbeißer von den Freien Wählern. Es könne nicht sein, dass immer jemand über einen sitzt und prüft, ob man alles richtig macht. Hier stehe die Landwirtschaft mit dem Rücken zur Wand. Ablehnung kam auch von der AfD: „Ich glaube nicht, dass den Bauern von einer App gesagt werden muss, was sie zu tun und lassen haben“, so Mario Schulze. Die Landwirte seien schließlich die Fachleute vor Ort. Er stehe deshalb für den Grundsatz: „So wenig wie möglich regulieren, so viel Freiraum wie möglich lassen“.
Als äußerst bedenklich bezeichnete es Kreisbäuerin Angelika Seyferth, dass sich die Gesellschaft immer weniger mit der Landwirtschaft identifiziert. Sie werde sich deshalb mit den Landfrauen weiterhin dafür einsetzen, dass aus der Projektwoche mit dem Titel „Schule fürs Leben“ ein eigenes Schulfach wird. Im Landkreis Bayreuth laufe die Projektwoche derzeit „mehr schlecht als recht“, weil der Aufwand für die beteiligten Betriebe so groß sei, dass er kaum mehr zu stemmen ist. Früher habe es ja auch das Fach Hauswirtschaft gegeben, sagte Angelika Seyferth, die auch dafür plädierte, landwirtschaftliche Themen in die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrern zu bringen.
Das sei auch dringend notwendig, so der CSU-Landtagskandidat Franc Dierl aus Speichersdorf. „Wir müssen den Menschen erklären, was Landwirtschaft bedeutet und dass die Milch nicht aus dem Supermarkt, sondern von der Kuh kommt.“ Alle sollten daran mitarbeiten, das Standing der Landwirtschaft zu verbessern, denn die Landwirte seien es schließlich, die für die Versorgung der Menschen zuständig sein. Dabei sei Oberfranken derzeit weit davon entfernt, sich selbst versorgen zu können.
Bild: BBV trifft Politik: Die Kreisvorstandschaft des Bauernverbandes in Bayreuth diskutierte mit den Landtags- und Bezirkstagskandidaten über aktuelle Themen.
Mit Hirse gegen die Trockenheit / Landwirt Dominik Schmitt hat bei Kirchleus eine Versuchsfläche für Hirseanbau angelegt
Kirchleus.
Von der Aussaat Mitte Mai bis Ende Juli so gut wie
kein einziger Tropfen Regen und trotzdem vernünftige
Bestände. Kaum eine Kulturpflanze schafft das. Eine
Pflanze gibt es aber doch, die extrem
trockenheitstolerant ist und die weltweit gerade
deshalb oft angebaut wird.
„Hirse könnte gerade in Zeiten des Klimawandels eine sehr interessante Kultur für unsere Landwirte sein“, sagt Dominik Schmitt, Pflanzenbauberater beim Erzeugerring Oberfranken. In Danndorf bewirtschaftet er den Naturlandhof Schmitt, einen Naturlandbetrieb, am Stennesberg bei Kirchleus, direkt an der Straße nach Esbach hat er heuer im Internationalen Jahr der Hirse eine Versuchsfläche mit neun verschiedenen Sorten angelegt. „Wir wollten einfach mal verschiedene Sorten ausprobieren“, sagt er. Auf den Flächen seines Naturland-Betriebs baut Dominik Schmitt Rispenhirse für den Legehennen-Halter Michael Grampp aus Fölschnitz an, der damit die Futterration für seine rund 9000 Bio-Legehennen aufbessert.
Als sogenannte C4-Pflanze sei die Hirse besonders auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und damit für risikobehaftete Trockenstandorte als Kulturfrucht interessant, so Dominik Schmitt. Gerade in den zurückliegenden Jahren habe sich gezeigt, dass Sommerkulturen, wie etwa die Braugerste, die erst im Frühjahr gesät werden, von der Frühjahrs- und Frühsommertrockenheit wesentlich mehr geschädigt werden als Winterkulturen wie Backweizen, die im Herbst gesät und dann die Winterfeuchte wesentlich besser ausnutzen können.
Durch den Wegfall von Pflanzenschutzmitteln, beziehungsweise durch immer größer werdende Probleme mit „Ungräsern“ wie dem Ackerfuchsschwanz, gerate eine abwechslungsreiche Fruchtfolge immer mehr in den Fokus. Somit könne die Hirse mit ihrem hohen Durchhaltevermögen in Trockenperioden ein wertvoller Baustein einer abwechslungsreichen Fruchtfolge sein.
Auch Naturland-Berater Werner Vogt-Kaute sieht in der Hirse aufgrund ihrer guten Verträglichkeit von Trockenheit eine gute Option für Landwirte. Im Gegensatz zu vielen anderen Kulturen wie Buchweizen oder Amaranth seien bei der Hirse vor allem auch „vernünftige Erträge“ zu erzielen.
Hirse gilt als eine der ältesten und noch immer wichtigsten Kulturpflanzen weltweit. Die Kolbenhirse für den Wellensittich kennt man. Doch es gibt noch viele weitere verschiedene Arten, die Rispen-, Sorghum, Perl- und Teffhirse. Sie alle seien eine wichtige Nahrungsgrundlage in vielen Regionen, überwiegend in Asien und Afrika.
Vor dem Siegeszug der Kartoffel sei der Anbau von Rispenhirse bis in die Neuzeit hinein auch in Deutschland sehr bedeutend gewesen. In wenigen Regionen wie der Lausitz und Südostbayern sei sie noch im 20. Jahrhundert kultiviert worden.
Ein Problem stellt nach den Worten von Dominik Schmitt allerdings noch die Vermarktung dar. Darum sei es wichtig den Verbraucher auf die Hirse aufmerksam zu machen und zu Informieren. „Nur wenn ein Markt entsteht, kann die Hirse auch wirtschaftlich angebaut werden.“
Dabei gelte Hirse als sehr gesund. Sie habe hohe Gehalte an Vitaminen, Kieselsäure und Eisen und eigne sich hervorragend als glutenfreies Produkt für Menschen mit Zöliakie. Im Handel werde Hirse als gelb-goldene Hirsekörner angeboten, als Flocken, Schrot oder als Mehl. Hirse eigne sich darüber hinaus auch als Reis-Alternative für Beilagen oder Füllungen. Ihr milder Geschmack verträgt sich zudem gut mit verschiedenen Gemüsen in Suppen, Eintöpfen, Currys oder Salaten. Selbst im Müsli kommen Hirseflocken zum Einsatz. Neben der menschlichen Ernährung sei die Hirse auch schon immer als Geflügelfutter eingesetzt worden. Methionin sei die erste limitierende Aminosäure in der Öko-Geflügel- und Schweinefütterung.
Doch nicht nur für Biobetriebe sei Hirse interessant, aufgrund der hohen Trockenheitstoleranz sei Hirse auch für konventionelle Betriebe geeignet. Dominik Schmitt verweist auf die Körner- oder Sorghumhirse, die höhere Erträge liefern als die Rispenhirse und vollständig als Ersatz für Futterweizen, etwa in der Schweinefütterung dienen kann.
Bei einem Feldtag auf seinen Versuchsflächen hat er interessierten Landwirten die verschiedenen Hirsesorten vor wenigen Tagen vorgestellt. Janina Goldbach von der Landesanstalt für Landwirtschaft berichtete dabei über verschiedene Anbauerfahrungen und Pflanzenschutzexperten stellten den Einsatz von Biostimulanzien vor.
Bild: Dominik Schmitt auf seiner Versuchsfläche am Stennesberg bei Kirchleus, wo er neun verschiedene Hirsesorten angebaut hat.
Wald im Trockenstress / Trotz der Niederschläge der zurückliegenden Tage: Situation bleibt angespannt
Kulmbach. Die Wälder in der Region leiden stark unter Trockenheit. „Sorgenkinder“ sind vor allem die Nadelbaumarten Kiefer und Fichte. Aber auch alle anderen Bäume sind betroffen. Verfrühter Laubabfall, vertrocknete Kronenteile oder komplett absterbende Bäume sind als Stressreaktionen des Waldes nicht zu übersehen. Wie sieht die Situation im Kulmbacher Land aus?
„Derzeit
überrollt uns eine riesige Borkenkäferwelle“, sagt
Carmen Hombach (Bild links), Kulmbacher
Stadtförsterin und Vorsitzende der
Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach. „Wir
finden jeden Tag frisch eingebohrte Bäume, allein
für die WBV arbeiten derzeit 10 Harvester-Gespanne.“
Die Trockenheit sei ein massives Problem für die
Waldbesitzer. Die Fichten seien dadurch so
geschwächt, dass der Käfer ein leichtes Spiel hat.
Der Kiefer sei es ebenfalls zu warm, so dass auch
sie nach und nach dem Prachtkäfer und den
Kiefernborkenkäfern „Großer und Kleiner Waldgärtner“
zum Opfer fallen wird.
Die auf den durch Käfer entstandenen Kahlflächen gepflanzten jungen Bäume vertrocknen nach den Worten der Stadtförsterin größtenteils. Es gebe Ausfälle zwischen 30 und 100 Prozent je nach Standort, Lage und gepflanzter Baumart. „Dass der Klimawandel kommt, wussten wir, aber dass er sich in unseren Wäldern so massiv und so schnell auswirken wird, war für uns alle nicht absehbar“, so Carmen Hombach. „Wir stehen im Wald vor riesigen Herausforderungen und brauchen aufgrund der massiven, langen Trockenphasen neue Strategien, um die Wiederbewaldung zu schaffen.“
Die
Trockenheit trifft uns leider in mehreren Punkten
sehr schmerzlich, sagt Christian Dormann (rechts),
Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Hollfeld,
zu der auch weite Teile des Kulmbacher Landkreises
gehören. Einerseits begünstige die Trockenheit die
extreme Ausbreitung des Borkenkäfers der wiederrum
Kahlflächen schafft. Genau auf diesen bekommen wir
die nächste Folge extrem zu spüren. Auf den freien,
ungeschützten Flächen verdunste durch das fehlende
Waldklima viel mehr Wasser als normal. Dies komme
noch erschwerend zum fehlenden Niederschlag hinzu.
Diese Gesamtsituation sei gerade mit Hinblick auf
die Schaffung eines klimatoleranten Zukunftswaldes
mit Einbringung neuer Baumarten durch Pflanzung
extrem schlecht. Christian Dormann: „Uns vertrocknen
die Pflanzen auf der Fläche.“
„Gut, dass wir seit einigen Tagen vermehrt Niederschläge haben, wir erwarten davon schon einen positiven Effekt“, sagt Jens Haertel, Bereichsleiter Forsten beim Amt für Landwirtschaft Coburg-Kulmbach. Für den Wald könne es nichts Besseres geben. Trotzdem sei die Situation im gesamten Amtsgebiet relativ angespannt, so Jens Härtel. Innerhalb des Bereiches sei die Situation allerdings auch unterschiedlich. Da gebe es laubholzreiche Wälder mit Eichen, Buchen, aber auch die Fichtenwälder im Frankenwald. In letzteren seien die größten Schäden festzustellen. „Da ist es wichtig, dass man das Holz erntet, bevor der junge Borkenkäfer wieder ausfliegen kann.“ Die Situation habe bereits dazu geführt, dass in weiten Teilen vor allem im Landkreis Kronach Kahlflächen entstanden sind. Das sei schon deutlich mehr sichtbar als in den anderen Bereichen des Amtsgebietes.
Insgesamt
sei „die Gesundheit der Wälder“ angespannter
geworden. Das könne man vor allem am Zustand der
Kronen festmachen. Dort seien dann weniger Nadeln,
beziehungsweise Blätter vorhanden, als bei einem
gesunden Baum. Die Trockenheit, die Wärme im Sommer,
vor allem die Spitzentemperaturen von über 30 Grad
hätten zugenommen und das könne man am Wald
mittlerweile deutlich sehen. Es gebe kaum mehr eine
Baumart, an der überhaupt keine
Gesundheitseinschränkungen festgestellt werden kann,
bei der einen mehr, bei der anderen weniger. „Der
Klimawandel spiegelt sich in allen Wäldern in
unterschiedlichen Ausprägungen wider.“ Um sich
zukunftssicher aufzustellen, sollte man möglichst
artenreiche und vom Alter unterschiedliche Bäume auf
der Fläche haben. „Desto höher die Splittung, umso
höher die Widerstandskraft.“
Den Frankenwald im Kronacher Landkreis bezeichnete Jens Härtel als bayernweiten Hotspot. Sowohl das Amt als auch die Bayerischen Staatsforsten setzten deshalb in diesem Bereich mehr Personal ein als anderswo. Im Kulmbacher Landkreis seien ebenfalls die Ausläufer des Frankenwaldes betroffen. Konkret nannte der Bereichsleiter die gemeinden Neuenmarkt und Presseck. Dort sei die Situation schwieriger als in anderen Bereichen, aber dennoch nicht ganz so schlimm, wie im Landkreis Kronach.
Bilder: Trotz der Niederschläge in den zurückliegenden Tagen: Der Wald leidet auch m Kulmbacher Land.
Weniger Bio durch Weidepflicht / „Bio-Bayern-Tour“ des BBV: Ökologisch wirtschaftende Milchviehhalter steigen mangels Fläche aus der Produktion aus
Kulmbach.
Nach jahrzehntelangem Wachstum musste der Absatz bei
Ökoprodukten im zurückliegenden Jahr erstmals einen
Einbruch verzeichnen. Die Ursachen dafür sind
vielfältig. Ein Grund für den Rückgang ist laut
Bauernverband die EU-Öko-Verordnung, die ab dem
kommenden Jahr verpflichtend eine Weidepflicht
vorsieht. Diese Vorschrift, die besagt, dass die
Kühe einen Zugang zu einer Weide haben müssen, war
eines der beherrschenden Themen bei der „Bio-Bayern-Tour“,
die jetzt auf dem Betrieb von Kerstin und Hermann
Grampp in Unterkodach Station machte.
Eingeladen waren sämtliche Direktkandidaten für die Landtagswahl im Herbst. Ihnen stellte die Familie Grampp ihren Milchviehbetrieb vor, ihnen berichtete der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif, was seinen Berufskollegen unter den Nägeln brennt. Landwirt Grampp kam schnell zur Sache: „Ein großer Teil der biologisch wirtschaftenden Milchviehbetriebe werden aussteigen“, sagte er. Hintergrund ist, dass die Flächen für die verpflichtende Weidehaltung meist gar nicht vorhanden sind, und wenn, dann alles andere als in Stallnähe.
Er selbst habe regelmäßig 50 der insgesamt 200 Tiere im ausgesiedelten Bereich seines Betriebes auf der Weide, hauptsächlich Trockensteher und trächtige Kalbinnen. Mehr geht nicht. Alle Kühe, die gemolken werden müssen, könne er mangels Fläche rund um den Bereich des 2008 errichteten Laufstalls am Ortsrand nicht ins Freie lassen.
Dazu
muss man wissen, dass sich von den gut 200 Hektar
Fläche, die von der Familie Grampp bewirtschaftet
wird, nur ein kleiner Teil in seinem Eigentum
befindet. Der weitaus größte Teil verteilt sich auf
fast 200 Feldstücke von 34 verschiedenen Pächtern.
Die Durchschnittsgröße eines Feldstücks liegt
Hermann Grampp zufolge bei einem einzigen Hektar.
Diese Konstellation ist so oder ähnlich in ganz
Oberfranken, wenn nicht in ganz Franken, zu finden.
Sollte die Weidepflicht so umgesetzt werden, würden
alle großen Bio-Milchviehbetriebe wieder aussteigen,
das befürchten die Verantwortlichen.
Harald Reblitz von den Milchwerken Oberfranken-West in Meeder bei Coburg – dorthin liefert Hermann Grampp seine Milch – geht davon aus, dass in Oberfranken 30 Prozent der Betriebe mit 50 Prozent der Fläche die Bio-Landwirtschaft aufgeben werden, wenn die Weidepflicht kommt. „Man wird Kompromisse finden müssen, andernfalls ist definitiv Schluss“, so Harald Reblitz. Er kritisierte besonders, dass die Politik auf der einen Seite die Zielvorgabe 30 Prozent Ökolandwirtschaft bis 2030 ausgegeben habe, sie den Biobauern auf der anderen Seite das Wirtschaften aber unnötig erschwere.
Nach den Worten von Referent Torsten Gunselmann von der Hauptgeschäftsstelle des Bauernverbandes in Bamberg arbeiten aktuell elf Prozent der insgesamt gut 9000 landwirtschaftlichen Betriebe im Regierungsbezirk ökologisch. Knapp 14 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche werde ökologisch bewirtschaftet. Damit liege Oberfranken voll im Trend, bei der Fläche sogar leicht über dem bayerischen Durchschnitt. Was den Anteil an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche angeht, hat der Landkreis Kronach die Nase vorn, Schlusslicht ist der Landkreis Bayreuth.
Zusätzlich
verschärft werde das Problem der geforderten
Weidehaltung bei kleinen Flächenstrukturen und oft
beengten Hofstellen durch die Sommertrockenheit, da
auf den Weiden in den fränkischen Regionen einfach
kein Futter wächst. Auch Hermann Grampp würde sich
deshalb Ausnahmen von der Weidepflicht wünschen.
Sollte es keine Ausnahmen geben werde dies statt zu
mehr, zu weniger Biobetrieben und vor allen Dingen
zu einem Einbruch in der Öko-Tierhaltung führen.
Bilder:
1. Rund
200 Kühe tummeln sich im ausgesiedelten Laufstall
der Familie Grampp in Unterkodach.
2. Kandidaten
für die Landtagswahl im Herbst besichtigten den
Laufstall des Betriebes von Kerstin und Hermann
Grampp in Unterkod
3. „Kommt
die Weidepflicht, verlieren wir 30 Prozent der
Bio-Fläche“: Der oberfränkische BBV-Präsident
Hermann Greif (rechts) und Referent Torsten
Gunselmann vom Bauernverband diskutierten mit den
Direktkandidaten für die Landtagswahl.
ach.
„Ideologie schlägt Hirn“: Landwirte kritisieren krankes System / Trockenheit, Inflation, Ukraine-Krieg: Oberfrankens Bauern gehen von Mindererträgen aus
Buch am Forst. Die ausgebliebenen Niederschläge zwischen Mai und Mitte Juli sind bei den oberfränkischen Bauern das zentrale Thema. „Als Konsequenz daraus müssen unsere Landwirte in diesem Jahr mit niedrigeren Erträgen rechnen“, sagte der BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif bei der Vorstellung der Erntebilanz auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Angermüller in Buch am Forst bei Lichtenfels.
Die Trockenheit fordere in etlichen Getreidebeständen sichtlich ihren Tribut. Auch in Oberfranken reagierten die Feldfrüchte aufgrund der massiven Trockenheit und Hitze mit Mindererträgen. Dabei habe eigentlich alles ganz gut angefangen in diesem Jahr. Hermann Greif berichtete von einem kalten und nassen Frühjahr mit fast schon zu vielen Niederschlägen vor allem im April. Doch dann sei es ihm und seinen Berufskollegen so vorgekommen, als hätte jemand den Schalter umgelegt und ab Mai sei der Regen die absolute Ausnahme gewesen.
„Wir hatten einfach zu wenig Wasser“, sagte der BBV-Präsident. In nahezu allen Ecken Oberfrankens sei es zu trocken gewesen. Durch den Wassermangel hätten die Getreideähren automatisch kleinere Körner gebildet. Damit sei auch der Mehlkörper in den Körnern deutlich kleiner ausgefallen. Noch einigermaßen gut davon gekommen sei man bei Wintergerste und Winterraps. Diese Früchte seien noch am besten mit der Trockenheit zurechtgekommen und die Ertragserwartungen lägen noch auf durchschnittlichem Niveau.
Anders sehe es dagegen bei Weizen, Roggen und Triticale aus. Hier hätten die fehlende Wasserversorgung und Nährstoffaufnahme zu echten Problemen geführt. Auch bei den typischen Sommerkulturen wie Zuckerrüben, Körnerleguminosen, Kartoffeln oder beim Mais seien die Trockenschäden deutlich zu erkennen. Ganz besonders hab es die Braugerste getroffen. Einst als „Königin der Anbaufrüchte“ gefeiert, sei aufgrund der Probleme schon in den zurückliegenden Jahren die Anbaufläche erneut zurückgegangen, binnen Jahresfrist von 27000 auf mittlerweile nur noch 23200 Hektar.
Vor
allem für die Futterbaubetriebe stelle das alles
eine große Herausforderung dar. Auch in den
Vorjahren seien die Erträge schlecht gewesen und so
seien die Futterreserven mittlerweile aufgebraucht.
Vor allen Dingen Silomais und Grünland seien
ertragsmäßig stark unterdurchschnittlich
ausgefallen. „Viele Betriebe sind deshalb auf
Futtersuche oder bauen ihre Tierbestände ab“, sagte
Hermann Greif.
Dabei ist de Trockenheit nur eines der Probleme, mit denen sich die Bauern herumschlagen müssen. Hohe Betriebsmittelpreise, hohe Dieselpreise, die Inflation, der Ukraine-Krieg, der die gesamte Wirtschaft beeinflusst und die noch immer weiter ausufernde Bürokratie sind weitere Probleme, die dafür sorgen, dass immer mehr Bauern resignieren und aufgeben.
Kein gutes Haar ließ Hermann Greif dabei an den agrarpolitischen Weichenstellungen aus Brüssel und Berlin. Er kritisierte beispielsweise das „Naturwiederherstellungsgesetz“ der EU, das die Landwirte künftig noch stärker in der Bewirtschaftung ihrer Flächen einschränken soll, die Pläne zur weiteren Beschränkung von Pflanzenschutzmitteln. Auch die von der Bundesregierung ab 2024 trotz Dürre und schwindender Versorgungssicherheit angekündigte Stilllegungspflicht stößt bei den Bauern auf pures Unverständnis. „Hier ist Bundesagrarminister Cem Özdemir auf dem Holzweg“, schimpfte der Präsident und weiter: „Ideologie schlägt offenbar das Hirn“. In keinem Beruf werde so hineinregiert, wie in die Landwirtschaft, kein Beruf werde so überwacht, wie die Landwirtschaft. „Das System ist vollkommen krank“, so Hermann Greif.
Bei der Vorstellung der Erntebilanz gab es allerdings auch positive Meldungen. So würden derzeit viele alte Kulturpflanzen wiederentdeckt. Landwirt Johannes Angermüller aus Buch am Forst hatte beispielsweise schon Zuckerhirse angebaut, auf 15 Hektar gedeiht die „Durchwachsene Silphie“ (Becherpflanze), die vor allem als Energiepflanze für Biogasanlagen genutzt wird. Erstmals zur Aussaat sei bei ihm heuer der Nutzhanf gekommen. In der Vergangenheit sei der Hanf insbesondere als Faserpflanze zur Herstellung von Textilien und Seilen verwendet worden. Heute würden die Bastfasern und die holzigen Teile des Stängels als Industriewerkstoff, in der Zell- und Papierindustrie sowie als Baumaterial genutzt. Aus den Samen werde Hanföl und Hanfmehl für die Lebensmittel und Futtermittelindustrie gepresst. Keine Rolle spiele beim Nutzhanf die Erzeugung von Haschisch und Marihuana aus den getrockneten Hanfblättern, da die angebauten Sorten auf einen ganz schwachen THC-Gehalt (Tetrahydrocannabis) gezüchtet wurden und damit zur Verarbeitung als Rauschdroge völlig ungeeignet sind.
Bilder:
1. Im
Kulmbacher Land ist die Ernte in diesen Tagen voll
im Gange. Doch die Trockenheit macht vielen Bauern
einen Strich durch die Rechnung.
2. Landwirt
Johannes Angermüller aus Buch am Forst, BBV-Direktor
Wilhelm Böhmer, Kreisbäuerin Marion Warmuth, der
oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif,
Vizepräsident Michael Bienlein und Gabriel Lieb (von
links) von der BBV-Geschäftsstelle Lichtenfels
besichtigten ein Hanffeld im Landkreis Lichtenfels.
Fachleute sehen den Anbau von Nutzhanf als große
Chance für fränkische Betriebe.
Holzhacker, Helmtester, Hausbau: Forst und Holz im Focus / 6. Frankenwaldtag lockte tausende Interessierte in die Waldhauptstadt
Schwarzenbach
am Wald. Sie trägt nicht nur den Wald im Namen, sie
ist auch amtierender PEFC-Waldhauptstadt des Jahres:
Die Stadt Schwarzenbach im Wald. Wo, wenn nicht dort
hätte der Frankenwaldtag 2023 stattfinden sollen?
Mehrere tausend Besucher waren auf das Gelände am
Stadtrand in Sichtweite des Döbra-Berges, der mit
rund 800 Meter höchsten Erhebung des Frankenwaldes,
gekommen. Ziel war es zum einen, sich unter
forstlichen Berufskollegen auszutauschen, zum
anderen, die Themen Wald und Holz einer breiten
Bevölkerung nahezubringen.
Nun
war es freilich nicht der erste Frankenwaldtag,
sondern der sechste. Doch zwischen dem fünften und
dem sechsten Frankenwaldtag lagen coronabedingt sage
und schreibe fünf Jahre. Höchste Zeit also, dass der
Forst einmal wieder mit all dem Präsenz zeigte, was
den Wald so ausmacht: viel Technik, schweres Gerät,
Natur und Umwelt sowie jede Menge Information über
all diejenigen Ämter, Behörden und Zusammenschlüsse,
die mit den Themen verbunden sind, bis hin zum
brandaktuellen Thema Heizen mit Holz.
Über
letzterem lag allerdings ein dunkler Schatten: „Da
hat man doch tatsächlich den Energieträger Holz
infrage gestellt und darüber diskutiert, ob die
energetische Nutzung von Holz eingeschränkt, wenn
nicht gar verboten werden sollte“, wunderte sich
Andreas W. Bitter, Präsident des Bundesverbandes
„Die Waldeigentümer“ und damit oberster
Privatwaldbesitzer in Deutschland. Der Professor
hatte gleichzeitig die Schirmherrschaft über den
Frankenwaldtag übernommen. In seiner Festrede
beschrieb er das „Katastrophenszenario“, in dem sich
der deutsche Wald gerade befinde und nannte den
Frankenwald eine der am stärksten betroffenen
Regionen, wenn man vom „Waldsterben 2.0“ spreche.
Während er der Forstpolitik des Bundes ein
schlechtes Zeugnis ausstelle („Das ist keine
sachgerechte Politik“), lobte er den bayerischen Weg
mit dem erst vor wenigen Tagen geschlossenen
Waldpakt. „Ich bin mir sicher, dass im Freistaat die
Weichen richtig gestellt werden“, sagte er.
Das
ist auch dringend notwendig: „Überall sehen wir die
Narben in unserer Landschaft“, so der Hofer Landrat
Oliver Bär. Wenn man die gewohnte Kulturlandschaft
der nächsten Generation übergeben möchte, dann müsse
man jetzt handeln und gemeinsam anpacken. „Unsere
Region ist es wert, dass wir uns für sie einsetzen“,
sagte Oliver Bär. Ein Baustein dafür soll das neue
Naturparkzentrum sein, dass die Landkreise Hof,
Kronach und Kulmbach in dem ehemaligen Gasthof
„Fels“ am Schnittpunkt der drei Landkreise, direkt
an der Bundesstraße B173 errichten wollen.
Auch der Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes Josef Ziegler bezeichnete den Frankenwald als Epizentrum des Wandels. Der Wiederaufbau des Waldes müsse zum Gemeinschaftsprojekt der Region werden, forderte er. Notwendig dazu werde neben dem Wechsel der Baumarten auch die konsequente Jagd sein.
Wie
dramatisch die Situation aktuell ist, machte Manfred
Kröninger, Vorstand der Bayerischen Staatsforsten,
deutlich. Allein in den beiden hiesigen
Forstbetrieben Nordhalben und Rothenkirchen seien
derzeit 50 Harvester-Züge im Einsatz. „Unsere
Strategie ist es prinzipiell, den Wald zu erhalten“,
sagte Manfred Kröninger. Neben millionenschweren
Investitionen in die Borkenkäferbekämpfung gehörten
dazu auch Investitionen in die Ausbildung junger
Forstwirte. Zehn Azubis habe der Forstbetrieb
Rothenkirchen derzeit, ab September kommen drei
weitere an der neuen Ausbildungsstätte Schwarzenbach
am Wald dazu.
Das freut vor allem auch den Bürgermeister Reiner Feulner. „Wir leben Wald und Holz“, bekräftigte er. PEFC-Waldhauptstadt sei dabei nicht nur irgendein beliebiger Titel. Er bescheinige vielmehr, dass die Stadt in besonderer Form für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung engagiere und auf eine langjährige Bewirtschaftung ihrer Wälder nach den PEFC-Standards zurückblicken könne.
Bilder:
- Mehrere tausend Besucher waren zum 6.
Frankenwaldtag nach Schwarzenbach am Wald gekommen,
um sich über alle Themen rund um Forst und Holz zu
informieren.
- Große Maschinen, schweres Gerät: „Forstwirtschaft
live erleben“ wurde beim Frankenwaldtag
großgeschrieben.
Die maßgeblichen Akteure des Frankenwaldtages in Schwarzenbach am Wald (von links): Amtschef Michael Schmidt, die bayerische Waldkönigin Antonia Hegele, Waldeigentümer-Präsident Andreas W. Bitter, Urban Treutlein, der stellvertretende Leiter der Bayerischen Forstverwaltung, Bürgermeister Reiner Feulner, Landrat Oliver Bär, Josef Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes und Manfred Kröninger von den Bayerischen Staatsforsten.
Landwirte wollen Projektwoche mit Leben erfüllen / Landwirtschaftsazubis beim Praxistag „Schule fürs Leben“ – Kreisbäuerin sucht potentielle Nachahmer
Schönlind.
„Landwirtschaft ist weder Bullerbü, noch
Massentierhaltung.“ Das sagt Karin Reichel,
Kreisbäuerin von Wunsiedel. Sie gehört zu den ganz
besonders Engagierten, wenn es darum geht, Schülern
Landwirtschaft zu vermitteln. Rund 25 Schulklassen
hat sie so pro Jahr auf ihrem Hof in Reicholdsgrün.
Weil sie so engagiert ist, liegt es ihr besonders am
Herzen, weitere Mitstreiter zu gewinnen. So
veranstaltete sie mit dem Bauernverband einen
Praxistag, zu dem die Schüler eingeladen wurden, die
das Berufsgrundschuljahr in Münchberg besuchen. Ziel
war es, den einen oder anderen zu gewinnen, der
eventuell auf dem elterlichen Betrieb ebenfalls das
Konzept „Schule fürs Leben“ in die Tat umsetzt.
Es sollte aber keine trockene, theoretische Veranstaltung mit den Absolventen des Berufsgrundschuljahres sein. Vielmehr wurde der Besuch einer Schulklasse originalgetreu durchgeführt. Vom Aussteigen aus dem Schulbus bis zur gemeinsamen Brotzeitt auf dem Hof. Richard Schübel, Seniorchef auf dem Schübelhof in Schönlind bei Wunsiedel, hatte seinen Betrieb dazu geöffnet und so gab es verschiedene Stationen, wie etwa: „Woher kommt das Frühstücksei?“, „Biogas – Energie aus der Landwirtschaft“ oder „Gesund und lecker, was steckt in unserem Essen“.
„Schon seit 20 Jahren gehen Landfrauen in die Schulen“, erläuterte Karin Reichel. Das Projekt „Erlebnisbauernhof“ sei der Einstieg gewesen, um Schule und Bauernhof zusammen zu bringen. Leider habe es nicht zu dem immer wieder geforderten Schulfach „Lebensökonomie und Alltagskompetenzen“ gereicht. Statt dessen habe es die Projektwochen „Schule fürs Leben“ gegeben und diese gelte es nun von Seiten der Landwirte mit Leben zu erfüllen.
Bevor es andere tun, möchte man sagen, denn auch andere Anbieter sind zugelassen, die verpflichtende Projektwoche einmal in der Grundschule, einmal danach zu veranstalten. „Wenn wir es nicht schaffen, ein Angebot zu unterbreiten, wird die Projektwoche anders durchgeführt und das vielleicht nicht in unserem Sinne“, so Karin Reichel. Die Bauern sollten dahinter sein, Kinder an die Landwirtschaft heranzuführen und ihnen Themen wie Gesundheit, Haushaltsführung, Ernährung und Verbraucherverhalten nahe zu bringen.
Ganz wichtig für alle potentiellen Anbieter der Praxiswoche „Schule fürs Leben“: Die Hürden sind bewusst niedrig gehalten worden. Der Betrieb muss nicht speziell qualifiziert oder zertifiziert sein, eine ausgebildete hauswirtschaftliche oder landwirtschaftliche Kraft sollte allerdings schon vorhanden sein.
„Vorbereitung ist die halbe Miete“, gab Karin Reichel den potentiellen Nachahmern der Projektwoche mit auf dem Weg. So gelte es zunächst einige Schwerpunkte abzufragen, auf die man sich konzentrieren möchte, Sitzgelegenheiten bereitzustellen, den Schulbus persönlich an der Hofeinfahrt zu empfangen und den Schülern einige „Bauernhofregeln“ zu erläutern. Vorsicht vor laufenden Maschinen und Fahrzeugen, immer in der Gruppe bleiben, Tiere ansprechen, bevor man sie anfasst, das alles sind solche Bauernhofregeln.
Auch die Verantwortlichen auf den Betrieben kämen manchmal aus dem Staunen nicht heraus, etwa wenn es tatsächlich Schüler gibt, die noch nie ein Naturjoghurt gesehen und gegessen haben, die nicht wissen, dass man Brot mit Kräutern essen kann, oder die nicht so recht erklären können, wo das Ei herkommt. Und noch einen wichtigen Tipp hatte Karin Reichel für alle Betriebsleiter: „Hunde und Katzen bitte einen Vormittag wegsperren, sonst ist die Aufmerksamkeit dahin.“
Ansprechpartner für alle Interessen der Projektwoche ist die örtliche Geschäftsstelle des Bauernverbandes. Natürlich findet das Ganze nicht für Gotteslohn statt. Für eine dreistündige Unterrichtseinheit, also üblicherweise von 9 bis 12 Uhr gibt es 220 Euro, Geld, das die Schulen bezahlen müssen und selbst mit dem Kultusministerium abrechnen können.
Bild: Einmal ein Huhn anfassen, nicht jeder traut sich das. Kreisbäuerin Karin Reichel zeigt beim Praxistag Schule fürs Leben in Schönlind, wie man es macht.
Tierhaltung im Kreuzfeuer / Nur die Grünen beteiligten sich nicht an der Diskussion um die Zukunft der Landwirtschaft – Spitzengespräch auf dem Betrieb der Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel
Neufang.
Nur die Grünen hatten trotz Einladung keinen
Vertreter geschickt, zum Politikergespräch des
Bayerischen Bauernverbandes auf den Betrieb der
Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel in Neufang bei
Wirsberg. Sowohl von der CSU als auch von den Freien
Wählern, der SPD den Linken, der ÖDP und der AfD
waren entweder die Direktkandidaten zur Landtagswahl
im Herbst oder zumindest ein Vertreter anwesend, um
mit der Kreisvorstandschaft des Bauernverbandes über
die Probleme des Berufsstandes zu diskutieren.
Dabei entzündete sich die wesentliche Kritik an der Politik der Grünen und vor allem an Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Die Zukunft der Tierhaltung in unseren Breiten war dabei eines der beherrschenden Themen. „Jeder muss sich klar machen, dass wir eine eigene Lebensmittelversorgung im Land brauchen“, sagte Martin Schöffel (CSU). Das Gegenmodell dazu sei das, was Özdemir praktiziere. Schöffel appellierte an alle Politiker, die Tierhaltung besser zu unterstützen. Die Fleischverbote im Bundeslandwirtschaftsministerium seien reine Ideologie, so Schöffel. „Das Rind ist kein Klimakiller, sondern trägt zu vernünftigen Kreisläufen bei.“
Ähnlich argumentierte sein Landtagskollege Rainer Ludwig von den Freien Wählern. Auch er kritisierte den „ideologischen Kampf“ gegen die Tierhalter. „Wir brauchen Planungssicherheit und keine ideologiegetriebenen Vorhaben“, sagte Ludwig. Gängelung und überbordende Bürokratie müssten ein Ende haben. Holger Grießhammer, Landtagskandidat der SPD stellte klar, dass er hinter der Tierhaltung stehe und sich auch dafür einsetzen wird. Seine Partei habe sich stets für eine bäuerliche Landwirtschaft ausgesprochen.
Elisabeth Schulze von der Ökologisch-Demokratischen Partei, selbst Bio-Gärtnerin in Veitlahm, goss ein wenig Öl ins Feuer mit ihrer Forderung, die Zahl der Großvieheinheiten pro Hektar zu begrenzen. Es gebe zwar keine seriöse Ernährungsempfehlung, feststeht aber ihrer Meinung nach, dass die derzeitig übliche Menge zu viel sei. Es sei die Frage, ob die Tierhaltung unbedingt so weiterbetrieben werden muss, wie derzeit, sagte sie. Sebastian Engelhardt, Landtagskandidat der Linkern aus Hof, argumentierte ähnlich. „Wie viel Fleisch wollen wir essen?“, das müsse man sich schon fragen. Für ihn stand fest, dass es Veränderungen geben wird. Gleichwohl sollte es nicht das Ziel sein, Verbote auszusprechen.
Georg Hock von der AfD warf Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vor, einen „Vernichtungskrieg“ gegen die Landwirtschaft zu führen. „Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich esse und auch nicht, wie ich heize“, sagte er mit Blick auf die höchst umstrittene Empfehlung zu zehn Gramm pro Tag. Letztlich doktere man in der Landwirtschaftspolitik nur an den Symptomen herum, das Höfesterben werde man so aber nur hinauszögern, aufhalten werde man es nicht. Hock sah das Problem in Brüssel bei der Europäischen Union. Seine Forderung lautete deshalb, dass die Agrarhaushalte wieder zurück in die Mitgliedsländer sollten und nicht mehr in Brüssel über den Etat entschieden werde.
Zuvor hatte Kreisobmann Harald Peetz der Bundespolitik vorgeworfen, grüne Ideologie hochzuhalten. „Die Grünen versuchen die Landwirtschaft zu knebeln, wo es nur geht“, sagte er. Da brauche sich niemand zu wundern, wenn das fränkische Schäufele künftig aus dem Schweinehochhaus in China kommt. Überhaupt sei die gesamte Zukunft des ländlichen Raums nur mit der Landwirtschaft und nicht gegen sie möglich.
Eindringliche Worte fand auch Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel und deren Mann Karl Heinz. Beate Opel sprach vom „Krieg gegen die Landwirtschaft“. Freilich könne sich jeder so ernähren, wie er möchte, Fleisch zu verteufeln, das sei aber der falsche Weg. Auch Karl Heinz Opel meinte, dass in Sachen Landwirtschaft längst alles aus den Fugen geraten sei. Doch aus seinen Worten sprach auch ein wenig Zuversicht: „Wir kämpfen weiter und lassen uns nicht unterkriegen“.
Bild: Direktkandidaten und Vertreter fast aller Parteien trafen sich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel, um mit der Kreisvorstandschaft des Bayerischen Bauernverbandes über die die aktuelle Landwirtschaftspolitik zu diskutieren.
Spezialisierung wird künftig groß geschrieben / Michael Schreyer aus Windischeschenbach landete beim Berufswettbewerb der Landjugend auf Bundesebene im Mittelfeld
Windischeschenbach,
LKs. Neustadt an der Waldnaab. „Man knüpft Kontakte
aus ganz Bayern, Kontakte, die bleiben und so
entsteht ein riesiges Netzwerk.“ Michael Schreyer
(19) wird sein persönliches Netzwerk künftig noch
gewaltig erweitern können. Als bayerischer
Landessieger im Berufswettbewerb der Landjugend hat
er vor wenigen Tagen am Bundesentscheid in Echem in
Niedersachsen teilgenommen. Dort landete er im
Mittelfeld und belegte den 14. Platz unter 22
Teilnehmern. Ein wenig enttäuscht klang er danach
schon, doch auch Michael Bayer weiß: „Dabei sein ist
alles“.
Die geknüpften Kontakte nimmt ihm sowieso keiner mehr und die Erfahrung, die er beim Bundesentscheid gewinnen konnte, auch nicht. „Hat halt leider nicht gereicht“, sagt Michael Bayer, der nach dem Wettbewerb gar nicht nach Hause kam, sondern gleich auf seinen Ausbildungsbetrieb auf das Staatsgut in Almesbach musste, weil er dort Wochenenddienst hatte.
„Es war eine super Veranstaltung“, sagt er. Schön wäre es natürlich schon gewesen, wenn es für einen Platz auf dem Siegertreppchen gereicht hätte. Das Niveau sei ziemlich hoch gewesen. Da ging es beispielsweise darum, einen Gesundheitscheck von einem Kalb zu absolvieren und eine Getreidebonitur durchzuführen, also die Körner unter anderem auf Krankheiten zu untersuchen.
Die
Konkurrenz sei schon stark gewesen, obwohl bei fast
allen der Spaß, das Zusammensein und das
gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund gestanden
hätten. Lediglich die Baden-Württemberger seien
recht zielorientiert gewesen, merkt Michael Bayer
an. Aber ansonsten sei man übereingekommen, auch
weiterhin in Kontakt zu bleiben. „Ich bin mit
einigen neuen Handynummern nach Hause gekommen.“
Sein drittes Ausbildungsjahr hat Michael Schreyer in einem ganz besonderen Betrieb absolviert: im Staatsgut in Almesbach bei Weiden, dem Versuchs- und Bildungszentrum für Rinderhaltung. Bald ist er fertig und will erst einmal ein Praxisjahr absolvieren, und zwar auf dem elterlichen Betrieb zuhause in Gleißenthal bei Windischeschenbach.
„Dort gibt es bestimmt genug zu tun“, ist er sich sicher. Seine Eltern Monika und Martin Schreyer bewirtschaften dort einen Milchviehbetrieb mit rund 100 Kühen in einem erst 2020 neu erbauten Stall. An die 100 Hektar Fläche bewirtschaftet die Familie dort in der nördlichen Oberpfalz. Ein Teil wird vermarktet, der andere Teil ist zum Eigenverbrauch für die Kühe bestimmt. Nach dem Praxisjahr strebt er entweder die Meisterschule oder die Technikerschule in Triesdorf an. Irgendwann wird er wohl auch den elterlichen Hof übernehmen, die ältere Schwester ist am Vermessungsamt in Straubing tätig, die jüngere Schwester besucht noch die Realschule.
Michael
Schreyer hatte in Windischeschenbach die Grundschule
und in Neustadt an der Waldnaab die Realschule
absolviert. Nach seinem Abschluss 2020 besuchte er
das Berufliche Schulzentrum in Neustadt. Nach dem
Berufsgrundschuljahr war sein erster
Fremdlehrbetrieb ein Milchviehbetrieb in
Tirschenreuth.
Hier im Staatsgut in Almesbach ist Michael Schreyer „voll mit eingebunden“. Heute erledigt er so typische Hofarbeiten, wie er es nennt. Er mischt die Futterrationen für die Trockensteher, kümmert sich um das Einstreu, füllt Verbrauchsmittel auf. Hier in Almesbach fand auch schon der Bezirksentscheid des Berufswettbewerbes statt, bei der er als Sieger in der Sparte Landwirtschaft I. hervorgegangen war. Obwohl es sozusagen ein Heimspiel war, hatte er sich sowohl für den oberpfälzischen Bezirksentscheid als auch für den bayerischen Landesentscheid gut vorbereitet. Vor allem, was die Präsentation anging. Beim Bezirksentscheid sei das ja noch relativ leicht gewesen, dort musste der Ausbildungsbetrieb vorgestellt werden. Beim Landesentscheid wurde es dann schon schwieriger, da ging es um das Thema „Digitalisierung in der Landwirtschaft“.
Insgesamt sei ihm der praktische Teil immer leichter gefallen, sagt Michael Schreyer. Er untertreibt, wenn er sagt, dass er im theoretischen eher Durchschnitt sei. Die Motivation sei jedenfalls von Mal zu Mal gestiegen.
Die
Zukunft der Landwirtschaft sieht Michael Schreyer
trotz so mancher Widrigkeiten eher positiv.
„Spezialisierung wird großgeschrieben“, sagt er. Die
Effizienz werde gesteigert werden müssen, das Thema
Klimaschutz weiter im Vordergrund stehen und
alternative Energien würden auch in Zukunft eine
große Rolle spielen. In Sachen Tierwohl sei dagegen
wohl schon alles Machbare umgesetzt worden.
Zum Landesentscheid ist Michael Schreyer gemeinsam mit den anderen bayerischen Teilnehmern mit einem Bus angereist. Zuvor hatten sich die bayerischen Sieger schon zu einem Vorbereitungsseminar in Herrsching getroffen. Besonders beeindruckt hat ihn bei den bisherigen Kreis-, Bezirks- und Landesentscheiden das breite Altersspektrum der Teilnehmer. „Der jüngste war 16, der älteste immerhin schon 33.“
Bilder:
1. Typische
Hofarbeiten erledigt Michael Schreyer auf dem
Staatsgut in Almesbach.
2. Nach
dem Abschluss steht für Michael Schreyer erst einmal
ein Praxisjahr auf dem elterlichen Betrieb an.
3. Hier
im Versuchs- und Bildungszentrum in Almesbach
kümmert sich Michael Schreyer um das Einstreuen in
den Boxen.
4. Im
Bayerischen Staatsgut in Almesbach, dem Lehrbetrieb
von Michael Schreyer, steht die Rinderhaltung im
Mittelpunkt.
Die Trockenheit ist wieder da / Bislang keine Verbote – Schäden schon jetzt festzustellen – Wasserversorgung als Herausforderung
Kulmbach. Wasser wird in Zukunft kostbarer. Das steht fest. Auch heuer beschäftigt die Trockenheit einmal mehr Landwirte, Gärtner und Privatleute. Wegen der Trockenheit und wegen niedriger Grundwasserstände schränken beispielsweise in Niedersachsen bereits erste Landkreise die Wassernutzung ein. Im Landkreis Vechta drohen Bußgelder bei Verstößen. Dort dürfen die Bürger in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr Gärten, Grünanlagen, Sportplätze und Äcker nicht mehr bewässern. Auch im Landkreis Nienburg dürfen die Bürger ihre Gärten ab einer Temperatur von 24 Grad Celsius Der Niederschlag aus dem Winter und dem Frühjahr habe nicht ausgereicht, um die Grundwasserstände nachhaltig zu erhöhen, heißt es. Wie sieht die Lage im Landkreis Kulmbach aus?
Wasserwirtschaftsamt
„Das Thema Trockenheit wird uns sicherlich auch in diesem Jahr wieder beschäftigen“, sagt Gabriele Merz, Leiterin des für Kulmbach zuständigen Wasserwirtschaftsamtes Hof. Nicht zuletzt deshalb, weil nach einem etwas nasserem Winterhalbjahr das hydrologische Sommerhalbjahr schon wieder zu trocken startet. Der Niederschlag im Winter habe in etwa dem langjährigen Mittel 1971 bis 2000 entsprochen. Am Beispiel der Station Presseck sei ersichtlich, dass die zweite Maihälfte und die erste Junihälfte nahezu ohne Niederschlag zu einem deutlichen Defizit beim Niederschlag in diesem Jahr geführt habe. Dies macht sich nach den Worten der Behördenleiterin dann auch beim Niederschlags-Dürreindex der vergangenen 30 Tage bemerkbar, der für große Teile der Region Oberfranken Ost extreme beziehungsweise sehr große Trockenheit anzeigt.
Diese Bild habe sich durch die Niederschläge in den vergangenen Tagen wieder etwas entspannt, so dass insbesondere im Landkreis Kulmbach wieder eher mäßige Trockenheit vorherrscht. Demzufolge seher es auch hinsichtlich der Abflüsse im Landkreis Kulmbach etwas günstiger aus, als in der Region Oberfranken West. „Bei uns schwanken die Abflüsse derzeit zwischen normal und niedrig mit der Tendenz zu niedrig“, so Gabriele Merz. „Mit Blick auf diese Situation sollten daher alle, wie auch in den vergangenen Jahren, sorgsam und sparsam mit den Wasser umgehen, ob nun aus Brunnen und Quellen oder aus Flüssen und Bächen.
In der Region Oberfranken-Ost habe man in den vergangenen Jahren von Verboten abgesehen und in erster Linie an die Vernunft appelliert. „Ausgenommen davon waren bei uns lediglich die Flussperlmuschel-Gewässer im Landkreis Hof, wo per Allgemeinverfügung des Landratsamtes Hof die Wasserentnahme untersagt wurde.“ Die Nutzung des Wassers, beziehungsweise der Gewässer sei lediglich im Rahmen des Gemeingebrauchs erlaubt. Für darüber hinaus gehende Entnahmen von Wasser müsse eine Genehmigung beim Landratsamt beantragt werden. Diese Genehmigung werde dann jeweils in Abhängigkeit von der wasserwirtschaftlichen Situation an der beantragten Entnahmestelle begutachtet.
Landratsamt
Das Landratsamt Kulmbach ist nach den Worten von Pressesprecher Björn Karnstädt zuständig für die Regelung von Wasserentnahmen aus den Oberflächengewässern und aus dem Grundwasser. Im Rahmen dieser Aufgabe würden auch öffentlichen Wasserversorgern wasserrechtliche Erlaubnisse für die Wasserentnahme aus deren Brunnen und Quellen erteilt, das daraus resultierende Nutzungsverhalten der Endverbraucher bei Wasserknappheit könne aber nur durch den Wasserversorger selbst gesteuert werden.
Gleichwohl bestehe grundsätzlich die Möglichkeit, die sonst allgemein zulässige Wasserentnahme aus Oberflächengewässern einzuschränken, um die Natur, insbesondere die Tier- und Pflanzenwelt oder das Gewässer und seine Ufer zu schützen. Inwieweit eine solche Regelung zur Einschränkung an Oberflächengewässern in diesem Sommer für einzelne oder mehrere Gewässer getroffen wird, sei derzeit nicht absehbar und hänge insbesondere von einer wasserwirtschaftlichen Beurteilung des Wasserwirtschaftsamtes ab.
In den vergangenen Jahren seien die Kreisverwaltungsbehörden seitens der Regierung von Oberfranken mitunter gebeten worden, durch Bekanntmachungen auf die Niedrigwassersituation hinzuweisen und die Bevölkerung zu sensibilisieren, von den Möglichkeiten des Gemein-, Eigentümer- und Anliegergebrauchs zurückhaltend Gebrauch zu machen. Dies würde natürlich auch Aktivitäten wie Gartengießen oder Autowaschen betreffen, so Björn Karnstädt.
Die Ausübung des Gemeingebrauchs steht grundsätzlich jedermann zu. Hierbei sei jedoch zu berücksichtigen, dass die erlaubnisfreie Wasserentnahme laut Bayerischem Wassergesetz nur durch Schöpfen mit Handgefäßen, also nur in geringen Mengen, erfolgen darf. Eine Entnahme mittels ein er Leitung mit oder ohne Pumpe ist im Rahmen des Gemeingebrauchs lediglich in geringen Mengen für das Tränken von Vieh und den häuslichen Bedarf der Landwirtschaft möglich. Eine Feldbewässerung scheide dabei jedoch aus.
Bei anhaltender Trockenheit und entsprechend niedrigen Wasserständen könnten bereits geringfügige Wasserentnahmen nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie haben, so dass die Entnahme dann nicht mehr vom Eigentümer- beziehungsweise Anliegergebrauch gedeckt ist. Anlieger seien hierbei die Eigentümer der an oberirdische Gewässer angrenzenden Grundstücke und die zur Nutzung der Grundstücke Berechtigten, so der Sprecher des Landratsamtes. Einbauten jeder Art, die zum Zwecke des Aufstauens ohne vorherige Gestattung im Gewässer errichtet wurden, seien in jedem Falle unerlaubt und müssen entfernt werden.
Bauernverband:
Was die Trockenheit angeht, sei die Situation die Gleiche , wie im zurückliegenden Jahr, so Harald Köppel, Geschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands (BBV). Vorteil des vergangenen Jahres sei es allerdings gewesen, dass es im Jahr davor noch eine gute Ernte gab und entsprechend Futtervorräte. Der erste Schnitt sei heuer in Ordnung gewesen, vom zweiten Schnitt bleibe dagegen nicht mehr viel. Trockenschäden seien bereits jetzt schon in sämtlichen Getreidearten feststellbar. Bei der Sommergerste beispielsweise würden die Blätter schon jetzt von unten her gelb. Ursache dafür sei ganz klar der Wassermangel. Wenn es in den zurückliegenden Tagen und Wochen geregnet habe, dass mehr punktuell und meist zu wenig. Auch bei der Wintergerste sei jetzt schon zu sehen, dass das Getreide in die Notreife übergeht. Viele Landwirte überlegten jetzt schon, ob sie Weizen, Roggen, Triticale als Ganzpflanzensilagen häckseln sollen, um Futtervorräte aufzubauen. Noch gut sehe der Mais aus, aber ohne baldigem Regen auf leichteren Standorten, würde auch das nicht von Dauer sein. Er habe die Trockenheit noch nie so früh erlebt, wie in diesem Jahr, sagt Harald Köppel.
Fernwasserversorgung Oberfranken
Für die Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) sagt Verbandsdirektor Markus Rauh, dass es schon immer eine, wenn nicht die zentrale Aufgabenstellung sei, durchgängig die Versorgung mit Trinkwasser zu den kommunalen Kunden (Gemeinden, Stadtwerke, Zweckverbände) sicher zu stellen. „Hierfür halten wir drei verschiedene Gewinnungsstandbeine vor, ebenso wie ein Wasserwerk, das rund um die Uhr das ganze Jahr besetzt ist.“ Hinsichtlich der Ressourcenmenge stehe dem Bedarf auf Seiten der Abnehmer von derzeit 15 Millionen Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr (in 2022 mit höchster Abgabemenge) eine Gesamtmenge von 21 Millionen Kubikmeter aus den drei Standbeinen gegenüber. Ein viertes Standbein ist in Vorbereitung und könnte mit entsprechendem Vorlauf aktiviert werden.
Grundsätzlich sei bei der Diskussion zu bedenken, dass die große Herausforderung die kurzfristige Belastung der technischen Systeme durch Tagesspitzen darstellt, so Markus Rauh . Gerade an Wochenenden im Sommer oder bei heißen Tagen am Abend bedingt vor allem durch das Gartenwässern, schnellten die Werte kurzfristig nach oben. Dies bringe, je nach örtlichen Bedingungen, die Gewinnung selbst, also zum Beispiel die Quellen, die Speicher oder das Verteilnetz an den Rand der Leistungsfähigkeit. Hier gelte es für die Zukunft entsprechend Vorsorge zu betreiben und wenn möglich mehrere Standbeine vorzuhalten, die Möglichkeiten zum Zwischenspeichern in Hochbehältern zu erweitern beziehungsweise zu ergänzen.
Auch der FWO-Verbandsdirektor weiß, dass es in verschiedenen anderen Regionen Deutschlands und auch Bayerns, zum Beispiel im Bereich Grabfeld in Unterfranken, bereits Bewässerungsverbote gebe. Inwieweit einzelne Kommunen im Landkreis Kulmbach dies überlegen, sei der FWO nicht bekannt.
Aufgrund des Umstandes, dass die FWO „nur“ Vorlieferant für andere Wasserversorger ist, will Markus Rauh keine ausdrückliche Einschätzung abgeben, was beispielsweise die Landwirtschaft betrifft. Allgemein könne man sagen, dass die Landwirtschaft wie auch andere Bereiche natürlich einen - durch den Klimawandel ebenfalls gestiegenen – Bedarf an Wasser habe. Diesen zu decken sei eine der zentralen Aufgaben für die nächsten Jahre. Der Landkreis Kulmbach gehört zum Versorgungsgebiet der Fernwasserversorgung Oberfranken. Die FWO beliefert rund 25 Prozent der oberfränkischen Wasserversorger.
Grünland im Focus / Info- und Praxistag des Maschinenrings Münchberg zur Grünlandverbesserung
Rieglersreuth.
„Wer einer hohe Grundfutterleistung aufweisen kann,
hat geringere Futterkosten und eine höhere
Milchleistung.“ Das sagt Lisa Schwemmlein von der
Abteilung Bildung und Beratung am Amt für
Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg. Beim
Informations- und Praxistag, den das Amt zusammen
mit dem Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg
und Umgebung sowie dem Ring Junger Landwirte heuer
auf dem Betrieb Bergmann in Rieglersreuth bei Zell
im Fichtelgebirge veranstaltet hat, gab es nicht nur
theoretische Informationen rund um die
Grünlandpflege, sondern auch technische Vorführungen
zur Grünlanderneuerung und zur Nachsaat.
Was sich ständig ändert, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Erhalt von Dauergrünland ist mittlerweile Bestandteil der Konditionalität, so Frank Stübinger vom Amt, der den Landwirten bei der Veranstaltung einen Überblick über den aktuellen Stand gab. Ganz wichtig: Die Umwandlung von Dauergrünland sei nur noch mit Genehmigung möglich. „Für alles, was wir an der Grünlandnarbe machen, brauchen wir eine Genehmigung“, so machte es der Sprecher unmissverständlich klar.
Auch die Grünlanderneuerung mit massiver Bodenbearbeitung, also mit dem Pflug, gehöre dazu. Davon ausgenommen sei lediglich Dauergrünland, das nach dem 1. Januar 2021 entstanden ist. Keine Umwandlung möglich sei bei sensiblem Dauergrünland, also etwa bei Natura-2000-Flächen, in FFH- oder Vogelschutzgebieten. Für die Bearbeitung und Prüfung des Antrags sei in der Regel das jeweilige Amt zuständig. Ein Problem könnte auftauchen, weil die entsprechende Fläche nach einer Genehmigung auch fünf Jahre lang als Grünland genutzt werden muss. Sollte also beispielsweise ein massiver Wildschaden auftreten, müsste der betreffende Landwirt „höhere Gewalt“ geltend machen.
Einen Überblick, welche Arten sich für eine Nachsaat im Intensiven Grünland eigenen gab Friedrich Asen vom Amt für Landwirtschaft. Als wichtigstes Futtergras in Bayern bezeichnete er den Wiesenfuchsschwanz vor allem aufgrund seiner frühen Robustheit. Eine der häufigsten Arten in den hiesigen Breiten sei die Wiesenrispe. Sie vertrage nicht nur die Trockenheit, sondern auch mehrere Schnitte und habe einen ausgezeichneten Futterwert. Auch das Knaulgras oder Knäuelgras könne mit seinem hohen Futterwert mithalten und gelte zudem als das trockenheitsverträglichste Gras im Intensiv-Grünland.
Als Standard für die meisten Nachsaaten bezeichnete Friedrich Asen ebenfalls aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften etwa in Sachen Futterertrag das Deutsche Weidelgras. Einziges Problem dabei: es benötige Feuchtigkeit. Für die Flächen im vorgelagerten Fichtelgebirge, dem Geschäftsgebiet des Maschinenrings Münchberg, sei es aber dennoch zu empfehlen. Das Lieschgras und den Rotschwingel nannte der Fachmann wertvolle, aber konkurrenzschwächere Arten. Eher nicht geeignet sei der Wiesenschwingel. Was Leguminosen angeht, plädierte Friedrich Asen bei Nachsaaten für den Weißklee als ausdauerndste und robusteste Kleeart mit hohem Futterwert und guter Trockenheitsverträglichkeit. Insgesamt zog Friedrich Asen das Resümee: „Eine standortgerechte Bewirtschaftung vor allem in Sachen Düngung und Schnittfrequenz ist die Grundlage für stabiles Grünland.“
Nach den Informationen folgte die Praxis. Auf den Versuchsflächen des Demonstrationsbetriebs Bergmann nahe der A9 stellte Maschinenring-Geschäftsführer Patrick Heerdegen mechanische Verfahrensvergleiche zur Optimierung des Grünlandbestandes vor. Zum Einsatz kamen unter anderem Ackerfräsen, Umkehrfräsen, Sämaschinen mit Doppelscheibenscharen sowie verschiedene Grünlandstriegel zur Nachsaat.
Bild: Landtechnik im Einsatz: Beim Praxis- und Informationstag des Maschinen- und Betriebshilfsrings in Rieglersreuth wurden verschiedene technische Möglichkeiten zur Grünlanderneuerung und -nachsaat demonstriert.
Futtermittel analysieren und Felder sensorgesteuert düngen / Präsentation beim Pflanzenbautag in Lopp: Maschinenring mit breiter Angebotspalette
Lopp.
Ihre breite Angebotspalette haben der Maschinen- und
Betriebshilfsring Kulmbach sowie der Maschinenring
Oberfranken Mitte beim Pflanzenbautag in Lopp bei
Kasendorf präsentiert. In praktischen Vorführungen
stellten die Verantwortlichen unter anderem die
Unkrautbekämpfung per Heißwasserthermie,
Möglichkeiten zur Weidezaunfreihaltung, die
Futtermittelanalyse als neues Angebot sowie
technische Möglichkeiten zur sensorgesteuerten
Düngung vor. In der MR Oberfranken Mitte haben die
drei Ringe Kulmbach, Bayreuth und Fränkische Schweiz
ihre gewerblichen Aktivitäten gebündelt.
Die Heißwasserthermie habe sich als eine überaus wirksame Behandlungsmethode für die Bekämpfung beispielsweise von Ampfer erwiesen, erläuterte Maschinenring-Geschäftsführer Horst Dupke. Dies sei nicht nur für den biologisch wirtschaftenden Betrieb, sondern durchaus auch für den konventionellen Betrieb in der Einzelpflanzenbekämpfung interessant. Die Rückmeldungen von Betrieben geht von 70 bis 100 Prozent Bekämpfungserfolg nach bereits einer Anwendung aus.
Mehrfach erprobt habe der Maschinenring die Technik in den vergangenen Jahren auch bei der Freihaltung von Elektroweidezäunen, so der Geschäftsführer. Die chemische Freihaltung sei verboten und scheide somit aus. Für die mechanische Freihaltung sei die mühselige Variante mit der Motorsense sehr verbreitet und es gebe bereits zahlreiche weitere technische Lösungen dafür, Was man zu all diesen Varianten wissen sollte, ist, dass erstens jedes Schneiden des Grases das Wachstum anregt und zweitens das Schnittgut meistens an Ort und Stelle verbleibt, was wiederum düngende Wirkung hat. „Durch den Einsatz unserer Heißwassertechnik ist damit Schluss“; so Horst Dupke Die Pflanzen würden nachhaltig geschädigt und durch wiederkehrende Behandlungen komplett zurückgedrängt.
Noch relativ neu im Portfolio des Maschinenrings ist die Futtermittelanalyse per mobiler Nahinfrarot-Spektroskopie (NIR-Technologie). Das Verfahren findet in der Regel Anwendung bei Qualitätsanalysen landwirtschaftlicher Produkte und eben auch von Futtermitteln zur Bestimmung unter anderem von Feuchte, Proteinen, Rohfasern und dem Fettgehalt. „Damit erhält der Landwirt schnell und unkompliziert den vollen Einblick in die Futterqualitäten“, erklärte Bernd Müller von der MR Oberfranken Mitte. Mit der neuen Technologie sei es möglich, die Ration und Futtereffizienz der Tiere zu verbessern. Außerdem müssten nie wieder Futtermittelproben verschickt werden. „Mit der Echtzeit-Analyse kann der Landwirt im Handumdrehen die Ration anpassen und so die Leistung des Betriebes maßgeblich verbessern.“
Schließlich führten die Verantwortlichen des Maschinenrings auch entsprechende Geräte zur sensorgesteuerten Düngung vor. „Viele unserer landwirtschaftlichen Flächen sind sehr wechselhaft in ihrer Ertragsfähigkeit, und das oftmals schon auf einem einzelnen Feldstück“, so Horst Dupke. Ertragsschwache Bereiche auf dem entsprechenden Feld könnten die einheitliche Düngergabe gar nicht in Ertrag umsetzen und belasteten am Jahresende die Nährstoffbilanzen, kosteten unnötig Geld und brächten kaum Mehrertrag. Eine mögliche Maßnahme dagegen sei die Optimierung der Düngung durch Sensortechnik. Die Sensoren seien aber auch auf allen anderen Flächen einsetzbar und würden Einsparungspotentiale in Bezug auf Dünge- und Pflanzenschutzmittel mit sich bringen.
Bild: Dominik Seiferth (3. von rechts) aus Kupferberg erklärt den Landwirten die Einsatzmöglichkeiten der Heißwasserthermie zur Unkrautbekämpfung.
Beste Werbung für die Landwirtschaft / Tag der offenen Tür lockte viele tausend Besucher in die Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken
Bayreuth.
Es war vor allem ein Fest für die Kinder. Ein Fest,
zu dem die Massen in Strömen kamen. Rund 7000 sollen
es gewesen sein, die der Bezirk Oberfranken beim Tag
der offenen Tür mit Familienfest auf dem Gelände
Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth
gezählt hat. Alles in allem war das Ganze beste
Werbung für Landwirtschaft, waren sich die
Veranstalter einig.
Kühe füttern, auf dem Pony reiten, den Tretschlepper-Führerschein machen, für Kinder können das erste attraktive Berührungspunkte mit der Landwirtschaft sein. Diese und viele Angebote funktionierten noch immer, trotz der unbegrenzten Zahl an digitalen Beschäftigungsmöglichkeiten, denen Kinder heute ausgeliefert sind, waren sich die Veranstalter sicher und sollten am Ende recht behalten. So waren die gut 30 Mitmach- und Spielstationen den ganzen Tag über belagert. Selbst der riesige Sandhaufen zum Buddeln und Spielen, die Straßenlokomotive und das Kasperle-Theater zogen da noch.
Ziel
war es, dass Kinder spielerisch etwas über Tiere,
Natur- und Umweltschutz sowie über die
Landwirtschaft allgemein erfahren sollten. Der
Kuhstall war geöffnet, auf den Wiesen des
großzügigen Geländes tummelten sich Schafe, Alpakas
und die Hühner vom mobilen Hühnerstall. Auch ein
Imker gab einen Einblick in seine Arbeit und
Hufschmied Florian Köhler aus Bamberg führte vor,
wie Pferde beschlagen werden. Mit
Informationsständen vertreten waren die
oberfränkische Naturparks Fichtelgebirge, Fränkische
Schweiz, Frankenwald und Steigerwald mit
verschiedenen Mitmach-Angeboten.
Am
Nachmittag stattete dann auch Ministerpräsident
Markus Söder dem Familienfest einen Besuch ab. Damit
war auch die große Polizeipräsenz schon ab den
Vormittagsstunden zu erklären. Söder sprach mit den
Besuchern, nahm sich Zeit für Selfies und trug sich
in das Goldene Buch des Bezirks ein.
Der oberfränkische Bezirkstagspräsident Henry Schramm nannte den Besuch Söders einen Ausdruck von Wertschätzung. Einen besonderen Dank richtete er an die zahlreichen Helfer und Kooperationspartner des Familienfests. Der Bezirk Oberfranken ist Träger der Landwirtschaftlichen Lehranstalten. Neben dem Bezirksjugendring, der Landjugend und den Landfrauen waren auch wieder das THW und die Feuerwehr dabei.
Bilder:
1. Einen
Blick in die Ställe der Landwirtschaftlichen
Lehranstalten konnten die Besucher des Tages der
offenen Tür werfen.
2. Eine
dampfbetriebene Straßenlokomotive zog ihre Bahnen
über das weitläufige Gelände.
3. Aus
ganz Oberfranken und darüber hinaus kamen die
Besucher zum Tag der offenen Tür in die
landwirtschaftlichen Lehranstalten am Stadtrand von
Bayreuth.
4. Aus
dem Fichtelgebirge war die Familie Grießhammer mit
ihren Alpakas in die Lehranstalten gekommen.
5. Besonders
für Kinder war beim Tag der offenen Tür in den
Landwirtschaftlichen Lehranstalten viel geboten.
6. Hufschmid
Florian Köhler führte vor, wie Pferde fachgerecht
beschlagen werden.
Guter Absatz, hohe Nachfrage, stabile Preise / Kritik an der Jägerschaft: Bamberger Waldbauern blicken auf turbulentes Jahr zurück
Baunach.
Mit scharfer Kritik am Jagdverband und am Bamberger
Landratsamt hat sich die bisherige und künftige
Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung Bamberg,
Angelika Morgenroth aus Scheßlitz, zu Wort gemeldet.
Bei der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus in
Baunach warf sie den Jägern einen katastrophalen
Umgang mit den Waldbesitzern vor. „Es fehlt
weitestgehend an Einsicht für unsere Sorgen und
Probleme“, sagte Angelika Morgenroth. Waldbesitzer
würden verunglimpft und verhöhnt, zuletzt auf der
Kreishegeschau Anfang April. Dem Landratsamt warf
die Vorsitzende vor, das Gebaren der Jäger auch noch
zu dulden. Dem Jagdbeirat sprach Angelika Morgenroth
Sachverstand und ausgleichendes Handeln ab.
Stattdessen zählten Parteibuch und Mitgliedschaft im
Jagdverband. Konkret fehlten beispielsweise bis
heute Abschusspläne. Dabei verhindere doch gerade
der hohe Verbiss Regeneration und Aufbau
klimaresilienter Wälder. „Der Wald ist die stärkste
Waffe gegen den Klimawandel“, so Angelika Morgenroth.
Für die WBV Bamberg war 2022 ein überaus turbulentes Jahr. Das lag nicht nur an den übermäßigen Wildbeständen, den ausbleibenden Niederschlägen, dem Borkenkäfer oder den mangelhaften politischen Rahmenbedingungen. Die Waldbauern rund um den Markt Heiligenstadt im südöstlichen Bamberger Landkreis hatten zudem im Juli 2022 mit einem ungewöhnlich heftigen Gewittersturm zu kämpfen. Laut Geschäftsführer Konstantin Meyer seien dabei über 15.000 Festmeter Schadholz angefallen. Das habe sämtliche Pläne zur Aufarbeitung des Schadholzes zunichte gemacht, sagte er. Ganze Fichtenflächen seien regelrecht abrasiert worden, viele Wege hätten aufgrund der umgestürzten Bäume nicht mehr passiert werden können.
Dem Geschäftsführer zufolge hatte die WBV Bamberg im zurückliegenden Jahr 49.200 Festmeter Holz vermarktet. Im Jahr davor waren es aufgrund der außergewöhnlichen Schadholzsituation 73.500 Festmeter, 2020 waren es 41700 Festmeter. Konstantin Meyer räumte ein, dass der weitaus größte Teil davon Fichten gefolgt von der Kiefer seien. Insgesamt sprach er von einem guten Absatz, einer hohen Nachfrage und von stabilen Preisen. Aufgrund der Energiekrise seien die Restholzpreise „durch die Decke“ gegangen. Für das laufende Jahr rechnet Konstantin Meyer aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage aber eher wieder mit rückläufigen Preisen.
Vorsitzende Angelika Morgenroth hatte zuvor beklagt, dass „unser aller Wald“ immer mehr in den Focus von Politik und Gesellschaft gerate. Dem pflichtete Forstdirektor Gregor Schießl, Abteilungsleiter am Landwirtschaftsamt Bamberg, bei. Die Gesellschaft habe jeden Bezug zur Realität der Land- und Forstwirtschaft verloren, sagte er. Dabei kritisierte er besonders den Anspruch vieler Menschen auf das Eigentum anderer. Die Bevölkerung habe vergessen, dass es die Waldbesitzer waren, die über Generationen die Bestände geschaffen haben, die sie der gesamten Bevölkerung kostenlos zur Verfügung stellen. „Gesunde, stabile und ertragreiche Wälder brauchen Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, das alles zu leisten.“
Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde Angelika Morgenroth mit 74 von 77 möglichen Stimmen in ihrem Amt bestätigt. 2. Vorsitzender bleibt Thomas Kraus aus Stadelhofen. Als 3. Vorsitzender löst der bisherige Rechnungsführer Roland Krapp Markus Dippold ab. Beide kommen aus Scheßlitz. Markus Dippold wurde zu einem von zwei Kassenprüfern gewählt. Der zweite Kassenprüfer ist Matthias Schick. Schriftführer bleibt Johannes Hölzl, ebenfalls aus Scheßlitz und neue Rechnungsführerin ist Helga Ebitsch.
Bild:Rechnet im laufenden Jahr eher wieder mit rückläufigen Preisen: der Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Bamberg Konstantin Meyer.
Artenschutz oder störende Blütenflug / Strittiger Schnittzeitpunkt von Grünland sorgt in Untersteinach für Unstimmigkeiten
Untersteinach.
Das Thema Artenschutz ist in aller Munde. Den
Landwirten liegt das Thema besonders am Herzen.
„Aber kaum macht man was dafür, dann ist es auch
wieder nicht recht“, sagt Christoph Jurkat. Zusammen
mit seinem Bruder Michael und den Eltern
bewirtschaftet Christoph Jurkat das zu Neuenmarkt
gehörende Gut Oberlangenroth mit seinen rund 100
Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Auch gut
eineinhalb Hektar Grünland in Untersteinach gehören
dazu. Und genau das sorgt gerade für
Unstimmigkeiten.
Hintergrund ist eine Bitte von Seiten der Gemeinde, die Wiese gegenüber der katholischen Kirche zeitnah zu mähen, da wiederholt Anrufe von Anwohnern in der Verwaltung eingegangen seien. Ein Bürger habe sich wohl über den Blütenflug, vor allem von Löwenzahn, verursacht durch das „lange Gras", beschwert.
Für die Jurkats grenzt es schon fast an Schizophrenie, in Zeiten von Bürgerbegehren wie „Rettet die Bienen“ und Aufrufen zum Erhalt der Artenvielfalt solch eine Bitte zu erhalten. Die Wiese sei zwar von Wohnhäusern umringt, aber vor allem hier wäre es die Erwartungshaltung der Bewirtschafter gewesen, dass sich um Artenschutz bemühte Bürger freuen, wenn ein Landwirt durch einen späteren Schnittzeitpunkt einen Beitrag dazu leistet.
Durch die spätere Mahd, die unter anderem in Biodiversitätsrichtlinien, beispielsweise vom Bioland-Verband, gefordert und gefördert wird, hätten Wildtiere Zeit, ihren Nachwuchs sicher auf die Welt zu bringen. Da die Wiese innerhalb des Ortes liegt sei dort eher nicht mit Rehkitzen, wohl aber mit Feldhasen zu rechnen. Die Pflanzenwelt, vor allem ökologisch wertvolle Pflanzen, hätten die Möglichkeit zu blühen und auszusamen. „Es geht um das gesamte Pflanzenspektrum“, so Christoph Jurkat, der auch darauf verweist, dass die Wiese nicht gedüngt werde.
Wenn erst ab Mitte Juni gemäht wird, dann unter anderem auch deshalb, weil die Jurkats nachhaltig, ökologisch und gesund wirtschaften wollen und deshalb bereits 2016 dem Bioland-Anbauverband beigetreten sind. „Jeder Mitgliedsbetrieb muss einen Maßnahmekatalog zur Biodiversität erfüllen“, erklärt Christoph Jurkat. Er räumt auch ein, dass es ganz natürlich zu Pollenflug kommt. Doch wenn das Grünland länger steht, gibt man auch der Natur eine Chance.
Die Jurkats hatten das kleine Stück Grünland vor rund drei Jahren von der >Gemeinde gepachtet. Zuvor sei es von einem konventionellen Landwirt bewirtschaftet worden. Der habe wohl schon deutlich früher gemäht. Wahrscheinlich seien das die Anwohner noch so gewohnt gewesen. Jetzt ist es der erste Schnitt, ein zweiter folgt, je nach Niederschlag, wohl Ende August.
Bild: Christoph) links) und Michael Jurkat auf der Wiese in Untersteinach, die wegen des späten Mähzeitpunktes bei Anwohnern für Unstimmigkeiten gesorgt hatte.
Menschlich und fachlich überaus kompetent / Ehepaar Kaufenstein vom Maschinenring Bayreuth-Pegnitz als beste Betriebshelfer Deutschlands ausgezeichnet
Bayreuth/Pegnitz.
Sie gehören zu den besten Betriebshelfern
Deutschlands: Monika und Thomas Kaufenstein aus
Stemmenreuth bei Pegnitz. Das Ehepaar ist für den
Maschinen- und Betriebshilfsring Bayreuth-Pegnitz
tätig und wird in diesen Tagen bei der
Bundesversammlung der Maschinenringe in Köln mit dem
Betriebshilfe-Award ausgezeichnet.
Monika (49) und Thomas Kaufenstein (48) bringen es zusammen auf fast 60 Jahre Tätigkeit für den Maschinenring. „Wir haben unsere Bewerbung mit der menschlichen und fachlichen Kompetenz der beiden begründet“, sagt Johannes Scherm, Geschäftsführer des Maschinenrings in Bayreuth. Das sah die Jury des Bundesverbandes der Maschinenringe genauso und so erhielt das Ehepaar aus Stemmenreuth die höchste Punktzahl. Insgesamt konnten alle 240 Maschinen- und Betriebshilfsringe aus Deutschland geeignete Bewerber vorschlagen.
Das Ehepaar Kaufenstein bewirtschaftet in Stemmenreuth einen landwirtschaftlichen Betrieb im Zuerwerb. Sie haben schon vor Jahren die Milchviehhaltung aufgegeben und den Schwerpunkt ihres Betriebes auf die Färsenmast, also die Mast junger weiblicher Rinder zur Fleischerzeugung, verlagert.
Für
den Maschinenring sind die beiden nebenberuflich
tätig. „Wir erhalten von den Einsatzbetrieben die
besten Rückmeldungen, die beiden werden sehr häufig
nachgefragt“, sagt Geschäftsführer Scherm. Er
beschreibt das Ehepaar als überaus aktive Helfer,
die es alljährlich auf eine hohe Zahl an
Einsatzstunden bringen. „Monika und Thomas
Kaufenstein unterstützen landwirtschaftliche
Betriebe, die sich meist in einer schwierigen
Situation befinden nicht nur mit ihrer Arbeitskraft
sondern geben auch psychischen und menschlichen
Beistand“, so Johannes Scherm. Beide seien stets
korrekt, aufrichtig, immer hilfsbereit und könnten
auch mal zuhören. „Das ist für mich die ideale
Mischung, die wir uns von unseren Betriebshelfern
wünschen“.
Der Geschäftsführer legt aber auch großen Wert darauf, dass die Kaufensteins den Preis stellvertretend für alle Betriebshelfer erhalten. „Wir haben viele gute Mitarbeiter.“ Trotzdem sei die Situation in der Betriebshilfe überaus angespannt. „Wir suchen dringen Leute“, so der Geschäftsführer. Obwohl die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe weiter nach unten geht, bleibe die Nachfrage auf stabilen Niveau.
Intern wurde der Preis bereits vor einigen Tagen auf dem Gelände der Landwirtschaftlichen Lehranstalten übergeben. Dabei wurde unter der Regie von Bundesverbandsmitarbeiter Patrick Fischer nach Art der Versteckten Kamera auch eine Art Imagefilm erstellt, bei dem das Ehepaar mit dem Preis überrascht wurde. Der Film portraitiert Monika und Thomas Kaufenstein und wird unter anderem bei der Preisverleihung in Köln gezeigt.
Bild:
1. Monikas und Thomas Kaufenstein.
2. Geschäftsführer Johannes Scherm (links) und
Vorsitzender Reinhard Sendelbeck (rechts)
gratulierten Monika und Thomas Kaufenstein zum
Betriebshelfer-Award
Engpässe in der Betriebshilfe / Der Maschinenring leistet einen wichtigen Beitrag zur Landwirtschaft in der Fränkischen Schweiz
Windischgaillenreuth. Die Situation ist überall die
Gleiche: auch der Maschinen- und Betriebshilfsring
Fränkische Schweiz sucht dringend Betriebshelfer.
„Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Kräften“,
sagte der alte und neue Vorsitzende Bernhard Hack
(Foto) aus Weilersbach bei der Jahresversammlung in der
Halle des Lohnunternehmers Klaus Wölfel in
Windischgaillenreuth. Gerade in den zurückliegenden
Wochen sei so mancher Engpass zu bewältigen gewesen.
Die Zahlen waren sowohl bei der sozialen, als auch bei der wirtschaftlichen Betriebshilfe angestiegen. Knapp 15600 Einsatzstunden wurden der Bilanz zufolge im zurückliegenden Jahr geleistet, knapp 3000 mehr als noch im Jahr zuvor. Etwa zwei Drittel entfallen auf die soziale Betriebshilfe, also in Notsituationen, bei Krankheit, Kur oder Reha. Ein Drittel der Stunden sind wirtschaftliche Betriebshilfe, etwa zur Abdeckung von Arbeitsspitzen. Der Maschinenring Fränkische Schweiz beschäftigt vier hauptberufliche und 29 nebenberufliche Betriebshelfer. Zwei weitere Helfer sind selbstständig tätig, dazu kommen einige Dorfhelferinnen.
Das wichtigste Geschäftsfeld des Maschinenrings ist mit einem Verrechnungswert von rund 2,9 Millionen Euro noch immer der Maschineneinsatz. Alle Bereiche seien dabei gestiegen, bis auf die Sparten Schlepper und Transport sowie Futterbau und Strohernte. Hier seien die Verrechnungswerte rückläufig gewesen. Gleichwohl machten diese beiden Bereiche noch immer mit die größten Teile im Maschinenumsatz aus. Insgesamt, also zusammen mit der Betriebshilfe, kommt der Maschinenring Fränkische Schweiz für 2022 auf einen Verrechnungswert von knapp 3,2 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es nur gut 40.000 Euro weniger.
Immer stärker in Anspruch genommen werde der Maschinenring, wenn es um das Thema Beratung geht. Egal ob Düngeberatung, Mehrfachantrag oder Dieselanträge, der Maschinenring ist immer ein wichtiger Adressat für alle Ratsuchenden. „Manchmal könne man den Strukturen kaum folgen, so schnell ändert sich alles“, sagte der Vorsitzende. Geschäftsführer Appel kritisierte dabei unter anderem die oftmals nicht durchdachten und widersprüchlichen Vorgaben und Programmfehler in der Antragsplattform. Für die Beratung ist Mitarbeiter Patrick Munzert von der Geschäftsstelle in Aufseß zuständig.
Auch die Themen Maiszünslerbekämpfung durch Schlupfwespen sowie Kitzrettung mit Hilfe des Drohnenüberflug gehöre mittlerweile untrennbar zum Aufgabengebiet des Rings. Weitere Tätigkeitsfelder des Maschinenrings Fränkische Schweiz sind die Übernahme der Geschäftsführung für das Biomasse Heizwerk Hollfeld, die Bioenergie Hollfeld GmbH und die Regnitz-Jura-Düngetrac GbR.
Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde Vorsitzender Bernhard Hack aus Weilersbach mit 62 von 64 möglichen Stimmen in seinem Amt bestätigt. Zwei stellvertretende Vorsitzende gibt es: Rainer Merz aus Oberzaunsbach wurde ebenfalls mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Für den ausscheidenden Franz Stenglein aus Tiefenlesau wurde das bisherige Ausschussmitglied Klaus Körber aus Hochstahl gewählt.
Ausschussmitglieder sind Tobias Dippold (Hohenpölz), Christian Dorn Neuses, Mario Güldner (Sachsendorf), Klaus Kilian (Oberngrub), Markus Kügel (Niedermirsberg), Florian Neuner (Stechendorf), Markus Nützel (Gößmannsberg), Markus Pirkelmann (Schönfeld),Sonja Rauh (Wiesentfels) und Stefan Schatz (Hollfeld).
Der Maschinenring Fränkische Schweiz hat aktuell 746 Mitglieder (Vorjahr 763), die zusammen eine Fläche von 17.541 Hektar (Vorjahr 17.392 Hektar) bewirtschaften. Eine Besonderheit ist, dass die Mitglieder aus den drei Landkreisen, Bamberg, Bayreuth und Forchheim kommen.
„Kein Gebiet wird vom Wolf verschont“ / Spielt der Wolf im Kulmbacher Land eine Rolle? – Situation wird unterschiedlich beurteilt
Kulmbach. Noch ist kein Wolfsriss im Kulmbacher Land mit hundertprozentiger Sicherheit nachgewiesen. Tatsache ist aber, dass sich der Wolf in Bayern immer weiter ausbreitet. Im Nachbarlandkreis Bayreuth gab es bereits mehrere Wolfsrisse. Für viele Landwirte kann das schnell zum existenziellen Problem werden. Bayern hat deshalb eine eigene Wolfsverordnung erlassen. Die neue Regelung sieht vor, dass der Wolf leichter „entnommen“ werden kann. Umweltschützer übten scharfe Kritik daran.
Die Bayerische Wolfsverordnung ist nun zum 1. Mai in Kraft getreten. Konkret sieht sie „in Ausnahmefällen den Abschuss von Problemwölfen“ vor. Die Verordnung ermöglicht vereinfachte Ausnahmen für verhaltensauffällige sowie für schadensstiftende Wölfe. Bereits ein Riss soll künftig ausreichen, um den Wolf zu bejagen, sofern die Untere Naturschutzbehörde zustimmt. Ein DNA-Nachweis ist hierfür nicht mehr nötig. Allerdings schreibt die Verordnung nach einem Abschuss vor, den Wolf zu identifizieren. Erst danach dürfen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Die Naturschutzbehörde bestimmt, wer den Wolf abschießen darf. Der Bund Naturschutz hat bereits angekündigt, eine Klage dagegen zu prüfen.
Mit Sicherheit werde Kulmbach mit dem Thema Wolf konfrontiert werden, sagt Harald Köppel, Geschäftsführer des Bauernverbandes. Wölfe würden überall mehr, in Thüringen genauso wie im Veldensteiner Forst. Überall seien männliche junge Wölfe, die sich auf die Suche nach einem Revier machten. Durchgezogen seien Wölfe im Kulmbacher Land ohnehin schon, wenngleich sich noch keiner niedergelassen habe. „Es gibt kein Gebiet, das vom Wolf verschont wird“, so Harald Köppel. Vor allem in größeren zusammenhängenden Waldgebieten wie dem Limmersdorfer Forst müsse man damit rechnen. „Man muss mittlerweile immer darauf gefasst sei, dass einem ein Wolf begegnet.“
Allerdings gebe es im Landkreis nicht so viele Weidetierhalter. Wer Weidetiere hält, für den sei das Thema Wolf alltäglich. „Seit der Wolf zunimmt, schläft keiner mehr ruhig.“ Was die Schutzzäune betrifft, so glaubt der BBV-Geschäftsführer, dass es der Wolf mittlerweile gelernt habe, mit dem Thema umzugehen. Auch wenn viele behaupten, mit Schutzzäunen sei alles möglich, so sei dies nichts anderes als ein Wunschtraum. Wolfssichere Zäune gebe es nur im Zoo.
Die Bayerischer Wolfsverordnung sei zwar grundsätzlich ein guter Schritt, doch mehr für den Alpenraum gedacht. Darauf sei die Definition „nicht zäunbare Gebiete“ abgestellt. Was bei uns zu einem Abschuss führen könnte, wäre, wenn der Wolf zu nahe an die Menschen herankommt. Harald Köppel rechnet außerdem damit, dass der Bund Naturschutz gegen die Bayerische Wolfsverordnung klagen werde.
Nach den Worten von Katrin Geyer, Sprecherin der Kulmbacher Kreisgruppe ist der Wolf im Landkreis bislang noch kein Thema. Es werde zwar immer wieder einmal von Wolfssichtungen berichtet, etwa vor einigen Jahren in Oberlaitsch oder auch schon im Limmersdorfer Forst. Sie seien aber nicht bestätigt. Katrin Geyer zufolge ist es nicht auszuschließen, dass bei uns hin und wieder einmal ein Wolf auftaucht. Dabei handle es sich aber in der Regel um sogenannte „Durchzieher“. Das seien Jungtiere, die noch kein eigenes Revier haben und keinem Rudel angehören. Solche Jungtiere könnten bis zu 80 Kilometer in einer Nacht laufen. Das bedeutet, sie durchquerten unsere Region nur und würden hier nicht sesshaft.
Natürlich könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich irgendwann einmal Wölfe im Kulmbacher Landkreis niederlassen. Das könnte am ehesten in den großen Waldgebieten im Frankenwald oder im Limmersdorfer Forst der Fall sein. Katrin Geyer gibt aber auch zu bedenken: „Wölfe sind scheu und halten sich üblicherweise von den Menschen fern.“ Sollten sich einmal Wölfe im Landkreis niederlassen, könnten sich Naturschutzbehörde, Naturschutzverbände und Jagdverbände auf die Richtlinien im „Wildtiermanagement große Beutegreifer“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt stützen. Hier seien Maßnahmen von der Einzäunung von Weiden bis hin zum Einsatz von Herdenschutzhunden aufgelistet und erläutert.
Naturschutzfachlich liegt die Zuständigkeit beim Thema „Wolf“ noch immer beim Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) im Referat 53 Wildtiermanagement, teilt Björn Karnstädt, Pressesprecher des Landratsamtes mit. Naturschutzrechtlich habe die Zuständigkeit vor dem Inkrafttreten der neuen Wolfsverordnung vollständig bei der Regierung von Oberfranken als Höherer Naturschutzbehörde gelegen. Deshalb habe die untere Naturschutzbehörde am Landratsamt Kulmbach das Thema bisher zwar aufmerksam verfolgt, aber mangels eigener Zuständigkeit zunächst keine weiteren Maßnahmen ergriffen. „Allerdings stehen wir diesbezüglich in engem Austausch mit den anderen Naturschutzbehörden“ so Karnstädt.
Eindeutige Beweise für die Anwesenheit von Wölfen im Landkreis Kulmbach gebe es bisher nicht. Die dauerhafte Ansiedelung eines Rudels ist aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde auch eher unwahrscheinlich, da es an ausreichend großen, zusammenhängenden und naturnahen Waldgebieten im Landkreis fehle.
Bei eindeutigen Nachweisen von Wölfen würden für Weidetierhalter im Landkreis gegebenenfalls höhere Anforderungen an den Schutz ihrer Herden notwendig werden, zum Beispiel Herdenschutzhunde, wolfshemmende Zäune, nächtliche Stallhaltung oder ähnliches. Die untere Naturschutzbehörde, wie auch das Landesamt für Umwelt könnten dabei beratend unterstützen. „Perspektivisch planen wir die Rekrutierung eines ehrenamtlichen Wolfsberaters“, so der Sprecher.
Keine Stellung zum Thema Wolf abgeben wollte die örtliche Kreisgruppe des Bundes Naturschutz. Vorsitzender Karlheinz Vollrath teilte mit, dass das Thema Wolf im Landkreis Kulmbach keine Bedeutung habe.
Angus-Rinder, Bisons und ein Hofcafé / Lukas und Linda Kießling bewirtschaften ihren Landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb – und haben große Pläne
Birkenhof.
Er gelernter Landschaftsgärtner, sie medizinische
Fachangestellte: Lukas und Linda Kießling aus
Birkenhof sind in ihren Berufen eigentlich völlig
ausgelastet. Hätte Lukas, 34 Jahre jung, nicht 2014
den landwirtschaftlichen Betrieb von seinem Onkel
Norbert übernommen. Zusammen mit seiner Frau Linda
führte er die Angus-Rinderzucht des Onkels nicht nur
weiter, sondern baute sie auch aus. 2015 fing er
zusätzlich sogar noch mit Bisons an. Nun wollen die
beiden noch einen Schritt weiter gehen und demnächst
ein Hofcafé eröffnen.
Gerade kommt Lukas Kießling aus dem Schlachtraum. Um Tiertransporte zu vermeiden, hat er eigens einen entsprechenden Lehrgang belegt und größtenteils in Eigenleistung einen modernen Schlachtraum gebaut. „Wir wollten die Tiere einfach nicht aus der Hand geben“, sagt er. Das Fleisch der Angusrinder wird direkt unter dem Slogan „Kießlings Qualitätsfleisch“ per Mundpropaganda vermarktet und auf Facebook- und Instagram-Seiten beworben.
Rund 35 Mutterkühe stehen auf der Weide, zusammen mit der Nachzucht kommt man auf etwa 80 Tiere. Etwa ein Jahr lang bleiben die Tiere dort, gemästet wird nicht, so dass das Fleisch absolut zart bleibt und später im Ofen garantiert nicht schrumpft. Weil er eine zweite Fleischsorte mit ins Angebt nehmen wollte, hat sich Lukas Kießling mittlerweile auch noch fünf Bison-Kühe angeschafft.
Insgesamt bewirtschaften Lukas und Linda Kießling eine Fläche von 46 Hektar, ausschließlich Grünland, das als Futter für die Tiere dient. Die Bewirtschaftung erfolgt nach biologischen Kriterien, darauf leben beide großen Wert.
Lucas Kießling sieht sich als typische Quereinsteiger. Er hat eine Lehre als Landschaftsgärtner absolviert und ist hauptberuflich im Kulmbacher Klinikum tätig. Auch Linda hat einen medizinischen Beruf. Sie ist medizinische Fachangestellte in einer Allgemeinarztpraxis in Neuenmarkt.
Während der Corona-Zeit war das Paar auf die Idee gekommen, ein zusätzliches Standbein zu schaffen. Ein Blick in den bisherigen privaten Party-Raum genügte und schon war die Idee eines Hofcafés geboren. „Der Raum ist eigentlich viel zu schade, um darin nur Familienfeste zu veranstalten“, dachen sich Lukas und Linda und so beuten wie während der zurückliegenden Monate alles ein wenig um und investierten in Technik und Geräte.
Von der ersten Idee bis zur jetzt anstehenden Eröffnung war es trotzdem noch ein weiter Weg. Lukas musste einen Lehrgang bei der Industrie- und Handelskammer absolvieren, Anträge für eine Nutzungsänderung wurden gestellt, ein Architekt bescheinigte die baurechtliche Eignung, und so weiter. Mittlerweile liegen die fast fertigen „Speisekarten“ auf dem Tisch, auf denen ein überschaubares Angebot an selbstgebackenen Kuchen und Torten, sowie einige Brotzeiten bis hin zum „Obatz´n“ aufgelistet ist. Natürlich gibt es Kaffee, aber auch alkoholische Getränkte, schließlich soll inmitten der Hofstelle einen Biergarten errichtet werden. Im Innenbereich bietet das Café 30 Plätze, draußen können es bis zu 100 werden.
Ganz fremd ist den beiden die Bewirtung nicht, denn schließlich ist vielen das alljährliche legendäre Hoffest, das immer Ende Juli stattfand noch lebhaft in Erinnerung. „Wir hoffen, in eine Marktlücke zu stoßen“, sagen Lucas und Linda Kießling. Tatsächlich ist das Angebot an klassischen Cafés außerhalb der Stadt eher dürftig. Allerdings werden sie vorerst nur an zwei Nachmittagen im Monat öffnen, immer am ersten und am dritten Sonntag zwischen 13.30 und 18 Uhr. „Wir müssen erst einmal sehen, wie es läuft“, sind sich beide einig. Auch einen Namen für das neue Hofcafé haben sich die beiden schon ausgedacht. Es wird „Freggerla“ heißen.
Die Eröffnung des Hofcafés „Freggerla“ in Birkenhof, Gemeinde Wirsberg, an der Gemeindeverbindungstraße zwischen Kupferberg und Neufang gelegen, findet am 4. Juni statt.
Bild: Lucas und Linda Kießling bewirtschaften in Birkenhof einen landwirtschaftlichen Betrieb im Nebenerwerb. Ab Anfang Juni kommt noch ein Hofcafé dazu, das an zwei Sonntagen im Monat öffnen wird, saisonal dieses Jahr von Juni bis einschließlich August.
„Hunde haben im Grünland nichts zu suchen“ / Jäger, Landwirte und Rehkitzretter starteten gemeinsame Aktion
Tauperlitz.
An vielen Wiesen im Landkreis sind sie derzeit zu
sehen: großflächige Plakate, die darauf hinweisen,
dass in diesen Tagen die Brut- und Setzzeit beginnt.
Was es mit den Schildern auf sich hat, erläuterten
gestern bei Tauperlitz Vertreter des
Bauernverbandes, der Jägerschaft und des Vereins
Kitzrettung Oberfranken.
Die Plakate sollen zum einen darauf hinweisen, Hunde an die Leine zu nehmen und Wege nicht zu verlassen. Zum anderen erklären sie allen Passanten, dass die Kitzrettung Landwirte und Jagdpächter beim Absuchen von Wiesen unterstützt, um den meist qualvollen Tod zahlreicher Rehkitze zu verhindern.
Freilaufende Hunde im Grünland, das ist in mehreren Punkten problematisch, wie die Verantwortlichen erläuterten. Finden die Hunde ein Rehkitz und schnuppern daran, dann sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Mutter des Kitzes aufgrund des fremden Geruchs nicht mehr um das Jungtier kümmert und es elend verendet. Hunde im Grünland, das bedeute aber auch jede Menge Hinterlassenschaften. Das Grünland sei schließlich das Futter für die Kühe, gab die stellvertretende Kreisbäuerin Bettina Riedl zu Bedenken. Hundekot im Futter könne aufgrund verschiedenster Giftstoffe schlimmste Erkrankungen bei den Kühen hervorrufen. Aber auch Hundespielzeug oder Holzstöckchen könnten beim Mähvorgang für große Probleme sorgen. „Spaziergänger, die unsere Wiesen für ihre freilaufenden Hunde nützen, brauchen wir nicht“, stellte Bettina Riedl unmissverständlich klar.
Vielen Menschen sei eben nicht klar, das die Wiese für den Landwirt eine elementar wichtige Fläche ist. In der Regel beginnt die Nutzungszeit des Grünlandes alljährlich am 1. Mai und dauert bis in den September hinein. So ist es auch gesetzlich vorgesehen. Die Kitzrettung setzt nach den Worten ihrer Vorsitzenden Britta Engelhardt aus Münchberg allerdings schon viel früher ein und gibt zu bedenken, dass schon ab 1. März erste Junghasen in den Wiesen eine Kinderstube finden. „Während dieser Zeit müssen Hunde an die Leine“, sagt Jagdpächter Alexander Hager.
Dabei stellen die Bauern derzeit auf ihren Grünlandflächen noch ganz andere Störfaktoren fest. Mountainbiker und sogar Motorradfahrer, die ohne Rücksicht auf Verluste querfeldeinfahren, die Flur zerstören und Jungtiere aufscheuchen. Extrem gefährlich seien auch achtlos weggeworfene Glasflaschen. Einmal im Mähwerk, könnten die Splitter große Schäden anrichten, außerdem gelangten sie in das Grünfutter.
Ziel des Vereins „Kitzrettung Oberfranken“ ist es, Wildtiere kurz vor dem Schnitt aufzuspüren und sie entweder zu verscheuchen oder solange festzusetzen und damit zu sichern, bis das Grünland gemäht ist. Vor allem die Rehkitze seien in den ersten Lebenswochen sehr gefährdet, denn die Wiesen sind in dieser Zeit so eine Art Kinderstube der Tierbabys. Die Tiere hätten in den ersten Wochen keinen Fluchtinstinkt und würden bei Gefahr regungslos an ihrem Platz liegenbleiben. Die Kitzrettung unterstützt damit die Landwirte und die Jagdpächter beim Absuchen der Wiesen und verhindert so den Tod der Kitze. „Wir sehen uns als Partner der Landwirte“, sagt Britta Engelhardt.
Früher habe man die Grünflächen mühsam zu Fuß abgehen müssen, erinnert sich Jörg Müller, selbst Landwirt und BBV-Ortsvorsitzender. Heute erleichtere ein Drohnenflug mit Wärmebildkamera die Arbeit gewaltig. Die Kitzrettung habe drei Drohnen im Einsatz, auch die Jägerschaft habe einige Drohnenpiloten in ihren Reihen. Sie fliegen das Gebiet in der Regel früh morgens in einer Höhe von 50 Metern ab. Die Trefferquote, also die Anzahl aufgespürter Jungtiere, sei deutlich besser, als beim Kontrollgang zu Fuß. Allerdings spielten auch die Kosten für eine solche Drohne eine Rolle. Das Gerät komme mit allem notwendigen Equipment schnell mal auf 7500 Euro.
Bild: Landwirte , Jäger und Vertreter der Kitzrettung Oberfranken haben bei Tauperlitz eine Plakataktion zum Beginn der Brut- und Setzzeit gestartet.
Landwirte laden zum Genusserlebnis ein / BBV-Aktion: „Frühstück auf dem Bauernhof am 21. Mai – Anmeldung bis 12. Mai
Gebhardtshof.
Gesund, schmackhaft und aus der Region: bei der
Aktion „Frühstück am Bauernhof“ stammen alle
Zutaten, mit denen die Landfrauen ein leckeres
Frühstück anbieten, von Erzeugern aus der Umgebung.
So auch auf dem Legehennenbetrieb der Familie
Heintke in Gebhardtshof, das zu Weidenberg gehört
und das zwischen Stockau und Lessau liegt. Dort gibt
es am 21. Mai von 9 bis 12 Uhr ein Bauernhoffrühstück
mit allem Drum und Dran. Um Planen zu können, ist
eine Anmeldung allerdings erforderlich.
Die Aktion fand 2019 zum ersten Mal statt und war auf große Resonanz gestoßen. „In diesem Jahr wollen wir den Verbraucher wieder zeigen, was die Landwirtschaft alles kann“, sagt Kreisbäuerin Angelika Seyferth. Tochter Martina und Mutter Heidrun Heintke setzen dabei ausnahmslos auf Zutaten aus der Umgebung.
Die Milch kommt vom Kellerhof, Kaffee von der Hollfelder Kaffeerösterei, Saft von der Kelterei im nahen Lehen, Joghurt vom Betrieb Raps in Würnsreuth, sämtliche Wurstwaren von den Metzgern Parzen und Lindner, Käse zum Teil aus Seulbitz, zum Teil aus der eigenen Käserei, der Honig aus Weidenberg sowie Brot und Brötchen von der Geseeser Landbäckerei. Die Eier stammen natürlich vom eigenen Betrieb. „Damit können wir wirklich ein komplett regionales Buffett anbieten“, freut sich Heidrun Heintke.
Martina und Heidrun Heintke bewirtschaften zusammen mit einer Mitarbeiterin den Betrieb, der von der damaligen Mutterkuhhaltung Zug um Zug zu einem Legehennenbetrieb umgebaut wurde. Hauptabnehmer der Eier sind die Edeka- und Rewe-Märkte in der Region, die regionalen Metzger und Bäcker sowie der Dorfladen Emtmannsberg. Martina und Heidrun Heintke sind regelmäßig auf mehreren Märkten, unter anderem auf dem Thermenmarkt in Obernsees vertreten. Wenn im Herbst der neue Verkaufsanhänger mit Kühltheke eintrifft, wird man die Familie mit ihren Produkten noch häufiger auf entsprechenden Märkten antreffen. Zu den Produkten gehören neben Masthähnchen auch Nudeln und ein eigener Eierlikör. Die Familie bewirtschaftet 38 Hektar landwirtschaftliche Fläche, darauf wird im Großen und Ganzen das komplette Futter für die Hennen angebaut.
„Wir wollen mit der Aktion vor allem einen positiven Akzent für die Landwirtschaft setzen“, sagt Kreisbäuerin Angelika Seyferth. Die bayernweite Aktion „Frühstück auf dem Bauernhof“ sei 2018 zum 70-jährigen Jubiläum der BBV-Landfrauen ins Leben gerufen worden und findet jährlich im Mai statt. Coronabedingt musste sie allerdings zwei Mal ersatzlos ausfallen.
Gezeigt werden soll dabei vor allem eines: Bayerns Bäuerinnen und Bauern arbeiten mit hohen Standards und erzeugen hochwertige Lebensmittel direkt vor der Haustür: „Wir wollen dabei vor allem auch die Vielfalt der Landwirtschaft in unserem Landkreis präsentieren“, so die Kreisbäuerin.
Das Frühstück auf dem Gebhardtshof findet bei jedem Wetter statt. Es kostet (inklusive der Getränke vom Buffett) für Erwachsene 15 Euro, für Kinder bis 12 Jahren 8 Euro. Kinder bis 6 Jahren sind frei. Um planen zu können, ist eine Anmeldung bis zum 12. Mai unter 09209/213 zwingend erforderlich.
Eine bayernweite Übersicht über alle teilnehmenden Betriebe gibt es im Internet unter www.BayerischerBauernVerband.de/Fruehstueck.
Bild: Die Gebhardtshofer Weidehennen stehen für artgerechte Haltung ohne Gentechnik. Davon überzeugten Martina und Heidrun Heintke die Bayreuther Kreisbäuerin Angelika Seyferth (von rechts).
Start der Spargelsaison: Genuss, Gesundheit und Geschmack / Heimischer Spargel soll nicht teurer werden – Kurze Transportwege, nachhaltig und fair
Rothwind.
Mit einer kleinen Verzögerung startet nun auch in
unseren Breiten die Spargelsaison. Während das
Wetter in großen Teilen der Landwirtschaft für
Unzufriedenheit sorgt, sind die Spargelbauern damit
ganz zufrieden. „Nach dem guten Vegetationsjahr 2022
mit dem trockenen Herbst und der Kälte im Winter
sind die Pflanzen sehr wüchsig und kraftvoll“, sagt
Matthias Stenglein aus Rothwind. Bereits Ende
Februar hätten die Pflanzen angetrieben, seien durch
die Kältephase im März aber im Wachstum noch einmal
ausgebremst worden. „Wenn es jetzt mit der Saison
losgeht, dann werden wir mit starken, äußerlich wie
innerlich qualitativ guten Spargelstanden rechnen
können.“
Rothwind, das ist so eine Art Synonym für Spargel aus dem Kulmbacher Land. Matthias Stenglein baut in dem Mainleuser Ortsteil auf rund 20 Hektar Spargel an. Er ist damit einer der größten Spargelanbauer in der Region. Wichtigste Vertriebsschiene ist die Direktvermarktung. Kleinere Teile der Ernte gehen an die Gastronomie und an den Handel. Mitte der 1990 Jahre hatte der heute 53-Jährige den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Damals ein reiner Milchviehbetrieb, heute ist die Milchviehhaltung das zweite Standbein von Matthias Stenglein.
Weil Mitte der 1990er Jahre die Milchkontingentierung eingeführt wurde, sei er auf den Spargel gekommen. Die Milchviehhaltung hate er aber nie aufgegeben. Im Gegenteil. Im modernen Stall tummeln sich rund 100 Kühe, die Milch geht an die Milchwerke Oberfranken West im Coburger Land.
Zusammen mit Ehefrau Sandra, Sohn Hans und einem festen beschäftigten Helfer bewirtschaftet die Familie den Hof. In der Spargelsaison kommen rund 20 Helfer dazu, die dann für einige Monate auf dem Hof leben. Die Anbaufläche erstreckt sich in einem Umkreis von acht Kilometern um die Hofstelle.
Nun ist es nicht so, dass es außerhalb der relativ kurzen Saison von April bis Juni in Sachen Spargel nichts zu tun gäbe. „Im Herbst werden schon die Dämme gemacht, die Folien angebracht und die Drähte gesteckt“, erklärt Matthias Stenglein. Mindestens zwei der Saisonarbeiter werden auch da benötigt.
Der Spargelbauer ist optimistisch, dass auch in Zukunft der heimische Spargel eine wichtige Rolle spielen wird. Der Kauf von heimischen Spargel sichere die Selbstversorgung im eigenen Land, sei nachhaltig und fair und durch kurze Transportwege werde eine Menge CO2 eingespart.
Eine Herausforderung sei es, geeignete Flächen zu finden. Nach zehn Jahren ununterbrochenem Anbau auf der gleichen Fläche sei der Boden „spargelmüde“ und man müsse erst einmal auf Jahre hinaus pausieren. Da hätten es die Landwirte in den von Natur aus begünstigteren Flächen etwa im Gäuboden leichter.
Eine weitere Herausforderung stelle der Mindestlohn dar. In anderen Ländern kenne man das gar nicht. Vielerorts liege der Mindestlohn auch weit unter den deutschen Vorgaben. Mit zwölf Euro erhielten Erntehelfer in Deutschland nach Luxemburg den europaweit höchsten Mindestlohn. Da zu konkurrieren sei nicht immer einfach. Ein weiterer Kostenfaktor seien die dringend benötigten Folien. „Ohne geht es nicht“, sagt Matthias Stenglein. Sie könnten zwar ganz im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz wiederverwertet werden, machten aber doch bei einer Dreifachbedeckung so um die 20.000 Euro pro Hektar aus.
Die gute Nachricht für alle Spargelfans: Der Preis für die gängige Hofsorte wird trotz Kostenexplosion in allen Bereichen nur geringfügig angehoben, verspricht Matthias Stenglein. Die Kunden wissen die Qualität jedenfalls zu schätzen und kommen teilweise von Bayreuth, Coburg oder aus dem Fichtelgebirge regelmäßig in den kleinen Hofladen.
Michael Koch, Bereichsleiter Gartenbau und Spargelmarkt-Experte der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) schätzt die anstehende Spargelsaison so ein: „Die Konsumenten sind insgesamt weiterhin hohen Preise ausgesetzt. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich in diesem Jahr nicht mehr so stark auf das Kaufverhalten aus.“ Im Endeffekt hänge viel davon ab, wie das Wetter ist. Sonnige Frühlingstage machten Lust auf Frühlingsgemüse.
Ähnlich argumentiert Simon Schumacher, Vorstandsvorsitzender des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer: „Die Konsumenten achten bei der Inflation stärker darauf, wie sie ihr Geld ausgeben. Genuss, Gesundheit und Geschmack sind vielen Käufern weiterhin sehr wichtig, und dafür steht regionaler Spargel.“ Ein weiterer Vorteil ist es nach den Worten von Simon Schumacher, dass unterschiedliche Sortierungen, also etwas zu dicke, dünne oder krumme Stangen auch günstiger in der Direktvermarktung zu haben sind, so dass für jeden Anlass und Geldbeutel der richtige Spargel angeboten werden könne.
Laut AMI lag der Selbstversorgungsgrad bei Spargel in Deutschland im zurückliegenden Jahr bei rund 86 Prozent. 2021 waren es nur 83 Prozent. Damit sei Spargel eine der wenigen Gemüsearten, die zu diesem hohen Grad in Deutschland erzeugt und auch verzehrt werden. Die Steigerung des Selbstversorgungsgrades sei darauf zurückzuführen, dass wegen der geringeren Nachfrage nach Spargel auch weniger Spargel importiert wurde.
Matthias Stenglein gibt allerdings auch zu bedenken, dass trotz Saisonstart noch nicht die volle Ernte zur Verfügung steht. Er empfiehlt allen Spargelfreunden, die von weiter her anreisen, erst einmal anzurufen und nachzufragen. Schließlich vermarktet er seine gesamte Ware feldfrisch. Da könne es schon vorkommen, dass in den Mittagsstunde alles weg ist. Weitere Infos: www.rothwinder-spargel.de.
Bild: Blickt optimistisch in die Zukunft: Matthias Stenglein baut auf rund 20 Hektar den beliebten Rothwinder Spargel an.
Plädoyer für das fränkische Selbstbewusstsein / Adrian Roßner beim Jubiläum 75 Jahre Landfrauen im Bauernverband
Bayreuth.
Ihr 75-jähriges Bestehen feiern die Landfrauen im
Bayerischen Bauernverband in diesem Jahr. Der
Kreisverband Bayreuth hat sich den Feierlichkeiten
mit einer eigenen Jubiläumsveranstaltung
angeschlossen. Dabei wurden zahlreiche aktive
Ortsbäuerinnen für ihr meist jahrzehntelanges
Engagement geehrt. „Mit den Landfrauen leben nicht
nur die Dörfer, mit den Landfrauen lebt die Heimat“,
sagte der populäre Historiker Adrian Roßner aus Zell
am Waldstein in seinem Festvortrag.
Gewürzt mit allerlei Anekdoten, humoristischen Einlagen und nicht so ganz bierernst gemeinten Statements sang der TV-bekannte Wissenschaftler das Loblied auf die Landfrau und auf seine Heimat, das Fichtelgebirge. Auch der Dialekt gehöre zur Heimat und das Fränkische sei ja wohl der „sexieste Dialekt“, den es überhaupt geben kann, so Roßner. Schon immer seien Dörfer wahre Netzwerke gewesen, in denen Heimat entstanden ist. Die Zentren der Dörfer seien zum einen das Wirtshaus und zum anderen die Kirche gewesen.
Leider habe sich bis heute vieles verändert. Aber noch immer sei der Volksglaube elementar. Als Beispiel nannte er die zahlreichen geschmückten Osterbrunnen. Das Wissen um diese Brunnen sei allerdings zum großen Teil verloren gegangen. Zum Beispiel sei kaum noch jemandem bewusst, dass die geschmückten Brunnen ein Ausdruck der Dankbarkeit für die Gaben der Schöpfung sind.
Was die fränkische Kultur laut Adrian Roßner ausmacht: „Wir reden nicht so viel, wir machen einfach“, sagte er. Seinen Worten zufolge sind die Dörfer die Zentren der ursprünglichen Kultur. „Wir sind nicht München, wir sind nicht Berlin, aber das haben wir auch nicht nötig“, appellierte Roßner an mehr fränkisches Selbstbewusstsein. Hier würden Probleme pragmatisch angepackt und gelöst. Hier sei die Kultur noch echt und müsse nicht erst durch ein Stadtmarketing erfunden werden. Ein wichtiger Bestandteil dieser Kultur seien die Landwirtschaft und damit auch die Landfrauen.
Zuvor
hatte Kreisbäuerin Angelika Seyferth an die Gründung
der Landfrauengruppen 1948 erinnert, als die
Kreisbäuerinnen noch ernannt und nicht gewählt
wurden. Welche Kontinuität in der Landfrauenarbeit
steckt, macht die Tatsache deutlich, dass es seit
der Gründung mit Karoline Hacker, Margarethe
Bauernfein, Anna Brütting und Katrin Lang nur vier
Kreisbäuerinnen vor Angelika Seyferth gab. Welchen
Stellenwert die Landfrauen haben machte die Liste
prominenter Gäste bei den alljährlichen
Landfrauentagen deutlich. Sie reicht von
Ministerpräsident Markus Söder über Schwester
Theresa bis hin zu Monika Hohlmeier, Karin Stoiber
oder Stephanie zu Guttenberg. Gemeinsame Lehrfahrten
führten die Landfrauen aus dem Bayreuther
Kreisverband schon an den Bodensee oder gar bis nach
Rom. Großen Wert legte Angelika Seyferth auf die
Tatsache, dass sich die Landfrauen traditionell auch
immer dann einbringen, wenn es um agrarpolitische
Themen geht. Mittlerweile sei es aber immer
schwieriger, Veranstaltungen in den Dörfern
abzuhalten, weil es dort kaum noch gastronomische
Betriebe gibt, die dafür geeignet sind.
Zu den Lehrfahrten wird demnächst auch eine weitere Fahrt nach Berlin dazukommen, denn die Bundestagsabgeordnete Silke Launert hatte als Geburtstaggeschenk einen Gutschein für einen kompletten Bus inklusive Besuch des Bundestags dabei. „Frauen sind die wahren Architekten der Gesellschaft“, sagte sie und würdigte das große ehrenamtliche Engagement. Landtagsabgeordneter Martin Schöffel bedauerte, dass der Bezug vieler Menschen zur Landwirtschaft mittlerweile verloren gegangen sei. Hier könnten die Landfrauen mit ihrem Wissen gegensteuern, so dass die Bauern wieder mehr Wertschätzung erfahren.
Landfrauen stünden für Tradition und Brauchtum und seien stets aufgeschlossen für neue Entwicklungen, so Landrat Florian Wiedemann. Oft stehen Landfrauen aber auch für eine menschlichere Sichtweise“, so Kreisobmann Karl Lappe und die oberfränkische Bezirksbäuerin Beate Opel rief ihre Kolleginnen auf, stolz auf ihren Beruf zu sein und auf Zusammenhalt zu setzen: „Ob bio oder konventionell, lasst euch nicht auseinanderdividieren, gerade in der jetzigen Zeit“.
Bilder:
1. Kreisbäuerin Angelika Seyferth, Bezirksbäuerin
Beate Opel (von links) sowie die stellvertretende
Kreisbäuerin Doris Schmidt (rechts) zeichneten Helga
Vogel aus Windischenlaibach für 50 Jahre
ehrenamtliche Tätigkeit als Ortsbäuerin aus.
2. Kreisbäuerin Angelika Seyferth (links) und ihre
Stellvertreterin Doris Schmidt bedankten sich bei
dem Historiker Adrian Roßner für dessen launigen
Vortrag zum Landfrauenjubiläum.
100 Rotbuchen für die FBG Pegnitz / Borkenkäfer wird für Waldbesitzer immer mehr zur Bedrohung
Pegnitz.
So geht aktiver Waldumbau in Zeiten des
Klimawandels: Der Bayreuther Landrat Florian
Wiedemann spendierte bei der Jahresversammlung der
Forstbetriebsgemeinschaft Pegnitz spontan 100
Rotbuchen-Setzlinge. Sie sollen an die Mitglieder
verteilt und an entsprechenden Stellen gepflanzt
werden.
Damit die Rotbuchen künftig nicht nur auf dem Gebiet der FBG Pegnitz gedeihen, versprach der Landrat auch den beiden anderen Waldbesitzervereinigungen im Landkreis, der WBV Bayreuth und der WBV Hollfeld, jeweils 100 Setzlingen. Ziel soll es sein, den Waldumbau noch schneller hinzubekommen und ein Stück weit dazu beitragen, den Klimawandel zu bewältigen. „Damit soll ein kleines Zeichen gesetzt werden“, sagte Florian Wiedemann. Jede Pflanzaktion sei besser, als sich auf der Straße festzukleben, wenn man wirklich etwas gegen den Klimawandel unternehmen will. Er kündigte außerdem an, die Heizung im Bayreuther Landratsamt perspektivisch auf Holz umzustellen. Denn anders, als es die EU kürzlich ausgegeben hatte, sei Holz CO2-neutral, habe kurze Wege und stärke die regionale Wirtschaft.
Für die FBG Pegnitz war 2022 ein sehr erfolgreiches Jahr, so Förster Stefan Failner in seinem Geschäftsbericht. Die für die Mitglieder vermittelte Holzmenge lag mit knapp über 29.000 Festmetern weit über der des Vorjahres. 2021 waren es lediglich knapp 17.000 Festmeter. Dazu kommen dem Bericht zufolge weitere gut 3500 Festmeter Hackschnitzel die direkt an den Handel gingen. Ein wesentlicher Grund für die immense Steigerung ist der Borkenkäfer, der zwar im Vereinsgebiet der FBG nicht so ausgeprägt war, wie andernorts, doch immerhin rund ein Viertel von den 21.000 Festmetern vermarktetem Fichtenholz sei Schadholz gewesen.
„Der Trockenstreß hat unseren Wald geprägt“, sagte der Vorsitzende Werner Lautner. Trotz allem seien die Preise aber zufriedenstellend gewesen. Das Käferholz habe sich gut verkaufen lassen, so dass für die Waldbesitzer unterm Strich etwas übrig blieb. Nun gelte es rechtzeitig mit dem Waldumbau vorwärts zu kommen, denn: „Wir wissen nicht, wie lange sich die Fichte bei uns noch hält.“
Nachdenkliche Worte zur aktuellen Waldsituation kamen von Michael Schmidt, dem Behördenleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth Münchberg. „Was die Trockenheit anrichten kann, das lässt uns alle nicht kalt“, sagte er und zeigte Bilder von gewaltigen Schäden im Frankenwald. Das sei gar nicht so weit weg von hier und könne jederzeit überall passieren. „Der Käfer wird zur ernsthaften Bedrohung“, sagte Michael Schmidt. Von den 40.000 Hektar Frankenwald sei bereits ein Viertel der Fläche völlig kahl. „Das kann uns hier auch erwischen, wenn der Klimawandel so fortschreitet“, meinte der Amtschef. Noch sei man hier im südlichen Bayreuther Landkreis auf der Insel der Glücksseligen, das könne sich aber schnell ändern.
Die FBG Pegnitz hat aktuell 1735 Mitglieder, zwölf mehr als noch im Jahr zuvor. Sie alle bewirtschaften zusammen eine Waldfläche von 12.600 Hektar, 100 mehr als im Vorjahr.
Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde die Vorstandschaft nahezu komplett in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender bleibt Werner Lautner. Der 57-Jährige steht seit 2018 an der Spitze der FBG Pegnitz. 2. Vorsitzender bleibt Bernd Kiefhaber (57) aus Ottenhof bei Plech. Die zwölf Vorstandsmitglieder, die alle mit großer Mehrheit gewählt wurden, sind: Volker Barthelmann (Arnoldsreuth), Reinhard Dennerlein (Egloffstein), Markus Gebhardt (Buchau), Gerd Gerstacker (Ahorntal), Heinz Götzke (Preunersfeld), Jürgen Pfleghardt (Reipertsgesee), Johannes Schieder (Neuhof bei Pegnitz), Matthias Schlenk (Reipertsgesee), Hermann Schmitt (Haßlach), Johannes Stiefler (Waidach), Stefan Ströbel (Prebitz) uns Karlheinz Ziegler (Hüll). Neuer Kassenprüfer ist Matthias Keil aus Hinterkleebach.
Bild: Großer Bahnhof bei der Jahresversammlung der FBG Pegnitz in der Christian-Sammet-Halle (von links): Vorsitzender Werner Lautner, Jörg Ermer vom Dachverband Forstwirtschaftliche Vereinigung Oberfranken, BBV-Kreisobmann Karl Lappe, Behördenleiter Michael Schmidt vom Amt für Landwirtschaft, Landrat Florian Wiedemann und der zweite Vorsitzende Bernd Kiefhaber.
Bewusstsein für den Bauernstand / „Mit Herz und Hand – smart fürs Land“: Berufswettbewerb der Landjugend auf Bezirksebene
Bayreuth.
Die Bewältigung eines Hindernisparcours mit dem
Schlepper, die Bestimmung von Saatgut oder die
Überprüfung eines Traktors im Hinblick auf Betriebs-
und Verkehrssicherheit: Von angehenden Landwirten
wird so einiges verlangt. Dabei sind das nur drei
von einer Vielzahl an Aufgaben die diesmal im
Berufswettbewerb der Deutschen Landjugend zu
bewältigen waren. Beim oberfränkischen
Bezirksentscheid in Bayreuth stellten sich die
Erstplatzierten aus den Landkreisen dem Vergleich
mit ihren Berufskollegen. Es ging nicht mehr und
nicht weniger als um den Einzug in den bayerischen
Landesentscheid Anfang Mai im oberpfälzischen
Almesbach.
Daran
teilnehmen werden die Sieger des Bezirksentscheids:
Lucas Hirschmann aus Thurnau und Patrick Ponader aus
Tröstau. Sie erzielten die meisten Punkte im der
Gruppe L1, in der die Teilnehmer aus den
Berufsschulen versammelt waren. Die Teilnehmer aus
den landwirtschaftlichen Fachschulen traten wie
schon in den Vorjahren in der Gruppe L2 in
Zweierteams an. Dabei konnten sich Janek Kießling
aus Töpen und Maximilian Voit aus Rehau den Platz
auf dem Siegertreppchen und damit den Einzug in den
Landesentscheid sichern. Eine Besonderheit gab es in
Bayreuth: Hier traten die Fachschulen auch aus der
Oberpfalz an. Mit Theresa Bäumler aus Waidhaus und
Johannes Götz aus Hemau schaffte es ein gemischtes
Team auf den vordersten Platz. Auch die beiden
werden am Landesentscheid teilnehmen.
Den
hohen Stellenwert des Berufswettbewerbs machten auch
die hochkarätigen Gäste deutlich, die nicht nur zur
Siegerehrung, sondern teilweise bereits während des
Wettbewerbs in die Landwirtschaftlichen
Lehranstalten des Bezirks Oberfranken gekommen
waren, um den jungen Leuten über die Schulter zu
blicken. BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif sprach
dabei von einem ganz wichtigen Ereignis für den
Bauernstand. Bezirksbäuerin Beate Opel bescheinigte
allen Teilnehmern, dass sie eindrucksvoll unter
Beweis gestellt hätten, wie kreativ und interessant
der Beruf des Landwirts ist. Keine Branche sei so
technisiert und digitalisiert, wie die
Landwirtschaft, auch das möchte man mit dem
Wettbewerb aufzeigen, so BBV-Direktor Wilhelm
Böhmer.
Es
gehe vor allem auch darum, Verständnis für den
Bauernstand, für regionale Kreisläufe und die
heimische Wirtschaft zu wecken, so der
oberfränkische Bezirkstagspräsident Henry Schramm.
Stefan Frühbeißer, Stellvertreter des Bayreuther
Landrats, appellierte an die jungen Leute, sich
nicht von so mancher negativer Diskussion entmutigen
zu lassen. Landwirte von heute müssten ein riesiges
Fachwissen mitbringen und das könnten sie beim
Berufswettbewerb unter Beweis stellen. Ähnlich
formulierte es der stellvertretende Bayreuther
Bürgermeister Stefan Schuh: Es gehe darum, die
Landwirtschaft mit cleveren und klugen Ideen nach
vorne zu bringen. „Bleiben sie am Ball, denn die
Landwirtschaft hat Zukunft“, sagte er zu den
Teilnehmern.“
Der Berufswettbewerb findet traditionell alle zwei Jahre statt. Diesmal stand der unter dem Motto „Mit Herz und Hand - smart fürs Land“. Corona-bedingt musste er beim letzten Mal allerdings ersatzlos gestrichen werden.
Bilder:
1. Einen
Hindernisparcours mit dem Schlepper inklusive
Anhänger und Ladung zu durchfahren war eine der
Aufgaben im Praxisteil des Berufswettbewerb.
2. Wieviel
Dünger muss in den Streuer: für die meisten der
jungen Landwirte stellte diese Aufgabe kein Problem
dar.
3. Einen
Traktor im Hinblick auf seine Betriebs- und
Verkehrssicherheit überprüfen mussten die Teilnehmer
des Berufswettbewerbs der Landjugend.
4. Maximilian
Voit, Janek Kießling, Lucas Hirschmann, Patrick
Ponader, Theresa Bäumler und Johannes Götz (vordere
Reihe von links) sind die Sieger beim
Berufswettbewerb der Landjugend in Bayreuth. Mit auf
dem Bild: die Gratulanten und Verantwortlichen des
Bauernverbandes.
Der Käfer hat Oberfranken fest im Griff / WBV Kulmbach/Stadtsteinach konnte 2000. Mitglied begrüßen
Stadtsteinach.
Mit einem Plus von 51 neuen Mitgliedern hat die
Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach im
zurückliegenden Jahr einen ordentlichen Zuwachs
verzeichnen können. Insgesamt bewirtschaften die
aktuell 2006 Mitglieder eine Fläche von 13448 Hektar
Wald. Bei der Jahresversammlung in Stadtsteinach
haben die Vorsitzende Carmen Hombach und
Geschäftsführer Theo Kaiser die positive
Mitgliederentwicklung zum Anlass genommen, das 2000.
Mitglied mit einer Ehrung besonders willkommen zu
heißen: Markus Suttner aus Marktleugast konnte sich
über einen Brotzeitkorb und ein forstliches Fachbuch
freuen.
Der Zustrom zur WBV hat natürlich auch einen Grund: die notwendige massenhafte Aufarbeitung von Schadholz durch den Borkenkäfer. Waren es vor dem Jahr 2018 immer so um die 50.000 Festmeter Holz, die von der WBV im Auftrag ihrer Mitglieder vermarktet wurden, sind es im zurückliegenden Jahr 150.000 Festmeter gewesen. Und das ist noch lange nicht alles: „Mindestens 30.000 bis 40.000 Festmeter sind noch im Wald“, schätzt Theo Kaiser.
Seine Prognosen klangen düster: „Wir sehen derzeit ein hohes Potenzial für eine weitere Massenvermehrung“, sagte er. Bislang sei das Käferholz nur teilweise aufgearbeitet. Theo Kaiser empfahl allen Waldbesitzern direkt nach dem Einschlag die Polterspritzung, also die Behandlung der Holzpolter mit zugelassenen Insektiziden als eine Art Ultima Ratio, „auch wenn dies politisch nicht gewollt ist.
Hintergrund ist, dass Oberfranken bayernweit die Hauptlast in Sachen Borkenkäfer trägt. Von den insgesamt 5,2 Millionen Festmetern geschädigtem Holz, befänden sich 2,1 Millionen Festmeter in Oberfranken. Die Schadensprognose des Landwirtschaftsministeriums geht für das laufende Jahr von weiteren 1,3 Millionen Festmetern geschädigtem Holz im Regierungsbezirk aus.
Diese Zahlen sind dem Geschäftsführer zu niedrig angesetzt. Theo Kaiser glaubt, dass es heuer genauso schlimm wird, wie im vergangenen Jahr, „eher noch schlimmer“. Grund dafür: Während der Borkenkäfer bislang eher westlich der Autobahn A9 sein Unwesen getrieben hat, sei er mittlerweile auch im Fichtelgebirge angekommen. Alle Hoffnungen ruhen nun auf den von allen Seiten geforderten Waldumbau. „Die gute alte Fichte wird es über kurz oder lang nicht mehr geben“, so Theo Kaiser.
Die Zahlen der Forstpflanzen, die im zurückliegenden Jahr von der WBV bestellt und an ihre Mitglieder vermittelt wurden, zeigen, dass die Botschaft des Waldumbaus im Kulmbacher Land angekommen ist. Genau 96.140 Forstpflanzen seien 2022 bestellt worden, 71 Prozent davon Laubholz, vor allem Eichen und Buchen.
Bei der Holzvermarktung hatte sich der Markt für die Fichten dennoch recht gut gestaltet und auch bei der Kiefer habe man für das Schadholz gute Preise erzielen können, sagte der Geschäftsführer. Überhaupt habe sich der Holzmarkt stabilisiert, die weitere Entwicklung hänge nun unter anderem stark vom Export ab. Eine rege Nachfrage verzeichnete die WBV auch für Industrie- und Brennholz sowie für Hackschnitzel, während der Markt für Papierholz komplett zusammengebrochen sei.
Götz Freiherr von Rotenhan, der Vizepräsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes, sprach bei der Jahresversammlung einmal mehr über die Zusammenhänge von Wald und Jagd. Beides gehöre zusammen, ohne Jäger gehe es im Wald nicht, so Rotenhan. Der notwendige Waldumbau werde nur gemeinsam gelingen, und zwar mit einer waldangepassten Jagd.
„Wald vor Wild“, so stehe es im Bayerischen Jagdgesetz. Das bedeute aber keinesfalls „Wald ohne Wild“. Es bedeute vielmehr, die Interessen des Ökosystems Wald vor jagdlichen Einzelinteressen zu stellen“, so Rotenhan. Was den Wildverbiss angeht, sehen er laut den letzten vorliegenden Vegetationsgutachten für ganz Bayern keine signifikante Trendwende zu einer Verbesserung der Situation. Noch immer sei die Hälfte aller Hegegemeinschaften im roten Bereich, das heißt, die Verbissbelastung sei zu hoch.
Kulmbach sei dabei mit sechs roten und zwei dauerhaft roten Bereichen nicht gerade ein Vorzeigelandkreis. Dauerhaft rot bedeute dabei, dass die Verbissbelastung schon seit zehn Jahren zu hoch sei. Folge einer hohen Belastung seien dabei vor allem negative Auswirkungen auf die Biodiversität. Als Lösungsmöglichkeiten schlug Rotenhan unter anderem vor, die revierübergreifende Zusammenarbeit zu forcieren, die Wildbretvermarktung auszubauen und überhaupt erst einmal ein Problembewusstsein für die Situation zu schaffen. Um das Verjüngungspotential aufzuzeigen, könne auch schon die Anlage von Weiserzäunen helfen, die sogar gefördert werden. Die Flächen innerhalb der Weiserzäune sollen aufzeigen, wie sich die Waldverjüngung ohne Wildverbiss entwickeln kann.
Bild: Mit Markus Suttner (Mitte) aus Marktleugast konnte die Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach bei ihrer Jahresversammlung ihr 2000. Mitglied begrüßen. Von der Vorsitzenden Carmen Hombach und von Geschäftsführer Theo Kaiser gab es dafür einen Brotzeitkorb mit regionalen Spezialitäten.
Landwirte sind die Lösung / 16 „Staatlich Geprüfter Wirtschafter für Landbau“ an der Bayreuther Landwirtschaftsschule verabschiedet
Bayreuth. Sie dürfen sich ab sofort als „Staatlich Geprüfter Wirtschafter für Landbau“, oder auch als „Bachelor professionell in Agrarwirtschaft“ bezeichnen: 16 junge Leute, im Wesentlichen aus den drei oberfränkischen Landkreisen Bayreuth, Kulmbach und Forchheim, die während der zurückliegenden drei Semester die Landwirtschaftsschule in Bayreuth absolviert haben. Jeweils ein Absolvent kommt aus dem Nachbarlandkreisen Amberg-Sulzbach und Neustadt an der Waldnaab. Aus den Händen von Schulleiter Uwe Lucas erhielten die drei Damen und 13 Herren im Rahmen einer Feierstunde ihre Abschlusszeugnisse.
Die Themenpalette der zurückliegenden eineinhalb Jahre war breit gefächert. Sie reichte von erneuerbaren Energien über muttergebundene Kälberaufzucht bis zu Ökolandbau sowie verschiedensten Umwelt- und Naturschutzthemen. Noch unter Corona-Bedingungen hatten die Studenten im Oktober 2021 das erste Semester begonnen, nur einer der ursprünglich 17 Teilnehmer war vorzeitig ausgeschieden. Das dreisemestrige Studium setzte einen Berufsabschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Landwirtschaft und zusätzlich ein Jahr einschlägige Berufspraxis voraus. Der jüngste der Absolventen war 18 Jahre alt, der älteste 32. Unter den 16 erfolgreichen Teilnehmern waren auch drei Damen.
„Sie haben einen großen Meilenstein in ihrer beruflichen Fortbildung erreicht“, sagte Schulleiter Uwe Lucas bei der Übergabe der Zeugnisse. Er zählte noch einmal alles zwölf Fächer auf, in denen die Absolventen mehr als 1000 Unterrichtsstunden absolviert hatten. Dazu kam eine Vielzahl von Exkursionen, Betriebsbesichtigungen und Seminaren. Die Anforderungen an künftige Betriebsleiter würden immer größer, sagte Semesterleiterin Theresa Bauer. Sie appellierte deshalb an alle Absolventen, ihre Bereitschaft zu stetiger Aus- und Fortbildung beizubehalten.
Der stellvertretende Bayreuther Landrat Klaus Bauer bezeichnete die Absolventen als Zukunft der Landwirtshaft in unserer Region. Die Landwirtschaft benötige einen bestens ausgebildeten Nachwuchs, denn die Anforderungen An die Bauern würden immer größer. Für den Bayerischen Landtag waren die beiden Abgeordneten Gudrun Brendel-Fischer und Martin Schöffel als Gratulanten gekommen. Brendel-Fischer zufolge nehme die Bildung heute in den landwirtschaftlichen Familien einen viel höheren Stellenwert ein als in früheren Jahren, sagte sie. Leider lasse die Bereitschaft nach, Ehrenämter zu übernehmen. Gerade im landwirtschaftlichen Bereich könne das Ehrenamt aber immens viel bewirken. „Landwirte üben den wichtigsten Beruf der Welt aus“, sagte Schöffel, der auch stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses im Landtag ist. Egal ob Ernährung oder Energie, beides gehe nur mit der Landwirtschaft, nicht gegen sie.
„Raus aus der Nische und hinein in die Gesellschaft“, forderte Hermann Greif, oberfränkischer BBV-Präsident. Landwirte seien nicht etwa das Problem, sondern die Lösung, etwa für die CO-2-Problematik und Burkhard Traub, Leiter des Sachgebietes Bildung in der Land- und Hauswirtschaft an der Regierung für Oberfranken sah die Aus- und Fortbildung als den entscheidenden Standortfaktor für den künftigen Wettbewerb.
Die 16 künftigen „Staatlich Geprüften Wirtschafter für Landbau§ sind: Simon Bauer (Hagenohe / Landkreis Amberg-Sulzbach), Marie Dippold (Geiersberg / Bayreuth), Luca Ehl (Sandhof / Bayreuth), Martin Galster (Dietzhof / Forchheim), Mathias Gollwitzer (Stockau / Bayreuth)), Melissa Gräf (Wickenreuth / Kulmbach, Leon Hartmann (Lindau / Kulmbach), Kathrin Lauterbach / Tressau / Bayreuth), Daniel Neus (Adlitz / Bayreuth), Tobias Pfaffenberger (Mistelgau / Bayreuth), Simon Raab (Neuenreuth ( Kulmbach), Hannes Schilling (Bayreuth), Andreas Schüpferling (Betzenstein / Bayreuth), Frank Schwarz (Görbitz / Forchheim), Gabriel Speckner (Oberhammermühle / Neustadt an der Waldnaab), Hans Stenglein (Rothwind / Kulmbach). Die vier Prüfungsbesten waren Melissa Gräf, Marie Dippold, Simon Bauer und Frank Schwarz.
Bild: 16 künftigen „Staatlich Geprüften Wirtschafter für Landbau“ konnte Schulleiter Uwe Lucas (links) nach drei Semestern an der Landwirtschaftsschule in Bayreuth verabschiedet.
100 Prozent bio, regional und saisonal: Obst und Gemüse frei Haus / Florian Blank hat bei Eckersdorf eine Solidarische Landwirtschaft und einen regionalen Bio-Lieferdienst aufgebaut
.jpg) Eckersdorf/Kulmbach.
Es ist nicht die beste Zeit für die Bio-Branche.
Florian Blank (38), ehemaliger
Luftfahrt-Elektroniker und gelernter Landwirt hat es
trotzdem gewagt. In der Nähe von Eckersdorf in
Landkreis Bayreuth bewirtschaftet er kleinen
Betrieb, der zuletzt leer stand und für den ein
Nachfolger gesucht wurde. Zunächst baute er dort
eine Solidarische Landwirtschaft auf. Parallel dazu
ist er seit Oktober des vergangenen Jahres mit einem
Biolieferdienst am Markt vertreten. Neben dem
Großraum Bayreuth beliefert er seit einigen Wochen
auch den Raum Kulmbach und will hier weiter wachsen.
Eckersdorf/Kulmbach.
Es ist nicht die beste Zeit für die Bio-Branche.
Florian Blank (38), ehemaliger
Luftfahrt-Elektroniker und gelernter Landwirt hat es
trotzdem gewagt. In der Nähe von Eckersdorf in
Landkreis Bayreuth bewirtschaftet er kleinen
Betrieb, der zuletzt leer stand und für den ein
Nachfolger gesucht wurde. Zunächst baute er dort
eine Solidarische Landwirtschaft auf. Parallel dazu
ist er seit Oktober des vergangenen Jahres mit einem
Biolieferdienst am Markt vertreten. Neben dem
Großraum Bayreuth beliefert er seit einigen Wochen
auch den Raum Kulmbach und will hier weiter wachsen.
„Es braucht alle Wege, um den Menschen einen leichten Zugang zu Bio-Lebensmitteln zu ermöglichen“, sagt Peter Ackermann, der im „Freigarten Stein“ für die Vermarktung zuständig ist. Unter www-freigarten.stein.de gibt es deshalb einen Online-Shop, in dem sich jeder potentielle Interessent ein Bild über die breite Angebotspalette machen kann.
Auf einer Fläche von rund einem Hektar bei der Einöde Stein nahe der zu Eckersdorf gehörenden Ortschaft Busbach hat Florian Blank seinen Obst- und Gemüsebaubetrieb nach der Idee einer gemeinschaftliche betriebenen Landwirtschaft errichtet. Das funktioniert so, dass die aktuell rund 60 Mitglieder alle Koste für den Obst- und Gemüseanbau tragen und im Gegenzug dazu wöchentlich einen Anteil an der Ernte erhalten.
120 sogenannte Ernteteiler wären für ein kostendeckendes Wirtschaften nötig. Um trotzdem entsprechend kostendeckend arbeiten zu können, entschloss sich Florian Blank kurzerhand, einen regionalen Bio-Lieferservice ins Leben zu rufen. Im Oktober ging er damit an den Start und heute, wenige Monate später gibt es bereits 50 bis 60 regelmäßige Kunden pro Woche. Viele Produkte sind tatsächlich aus eigener Produktion. Dazu kommen Bio-Lebensmittel von regionalen Partnerbetrieben. Der Rest wird über den Verband „Ökokiste“, ein Zusammenschluss von rund 50 Biolieferdiensten aus ganz Deutschland, zugekauft.
Eine Besonderheit, alle Produkte sind ausnahmslos aus biologischem Anbau, zu 60 Prozent nach EU-Standard, zu 40 Prozent nach dem höheren Standard der Anbauverbände wie Bioland oder Demeter. „Wir haben 35 bis 40 verschiedene Kulturen im Angebot“, erklärt Peter Ackermann. Alle möglichen Kohlsorten sind darunter, natürlich Tomaten und Paprika, Rote Beete, Zwiebeln, Salat Bohnen, Zucchini und vieles mehr. Das Brot stammt von der Biobäckerei Dieter Popp aus Münchberg.
Im weiteren Ausbau soll sämtliche zugekaufte Ware von Landwirten aus der Region stammen. Entsprechende Verhandlungen würden bereits geführt. „Wir müssen noch wachsen“, sagt Peter Ackermann, Geplant sei beispielsweise auch Pilze oder Süßkartoffeln ins Sortiment zu nehmen. Und irgendwann auch Milchprodukte und Fleisch, wofür aber noch eine entsprechende Logistik mit ununterbrochenen Kühlketten aufgebaut werden muss. Auch mit einem Teichwirt sind die Freigärtner bereits in Verhandlung. Zu Weihnachten konnten immerhin schon Weihnachtsgänse angeboten werden.
Neben Florian Blank und Peter Ackermann beschäftigen die Freigärtner schon heute zwei Teilzeitkräfte für die Ernte und für das Zusammenstellen der Lieferungen, zwei Fahrer in Teilzeit, beziehungsweise als geringfügig Beschäftigte sowie eine Bürokraft ebenfalls in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis. Bei der Werbung setzen die Freigärtner zum einen auf die sozialen Medien, zum anderen auf Mund-zu-Mund-Propaganda.
Bild:
„Freigärtner“ Florian Blank baut in Stein bei
Eckersdorf Obst und Gemüse an.
Foto: privat
Bauern als Schutzverband für unsere Lebensgrundlagen / BBV-Präsident Felßner: Landwirten gehört die Zukunft“
Bayreuth.
Raus aus der Opferrolle, rein in die Macherrolle“.
Das fordert Günther Felßner, der neue bayerische
Bauernverbandspräsident. Beim Bayreuther Bauerntag
in der Tierzuchtklause sagte Felßner: „In Zukunft
kommt es mehr denn je auf uns Bauern an“. Um das zu
untermauern, stellte er vier Schlagworte in den
Raum: Ernährung, Energie, Dekarbonisierung und
Biodiversität.
Mehr Menschen, weniger Fläche, das nannte der Präsident eine der großen Herausforderungen der Zukunft. Günstige Rohstoffe, günstige Energie, daraus sei das europäische Wohlstandsmodell entstanden. Nun aber würden auch noch Russland und China als Exportländer wegfallen. „Unser Wohlstandsmodell wackelt“, so Felßner. Die Bauern hätten die Lösung für viele Probleme, sie erzeugten Lebensmittel und Energie und spielten auch in Sachen Dekarbonisierung ganz vorne mit.
Dekarbonisierung bedeutet so viel wie die Dezimierung der Kohlenstoffintensität, wodurch die Menge an Treibhausgasemissionen, die bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen, verringert wird. Ziel ist weniger CO2-Ausstoß. Einfacher gesagt: „Aus der stofflichen Verwertung von Erdöl für Plastik und Kunststoffe müssen wir raus bis 2050“, so Felßner. Bleibt noch die Biodiversität: „Wir Bauern sind ein Schutzverband für unsere Lebensgrundlagen“ Alles in allem müsse eine intelligente und multifunktionale Landwirtschaft die Lösung sein. Landwirte müssten nicht wieder zurück in die Mitte der Gesellschaft, sie sind und sie waren stets die Mitte der Gesellschaft. „Was von den Rändern kam, sind die Angriffe auf uns gewesen.“
Zuvor
hatte der Bayreuther Kreisobmann Karl Lappe von
enormen Verwerfungen in sämtlichen Bereichen seit
Beginn des Ukraine-Kriegers gesprochen. Die
Landwirtschaft habe es unterschiedlich getroffen.
„Wir haben alle Höhen und Tiefen mitgemacht“, sagte
er. Ferkelerzeuger hätten beispielsweise am meisten
leiden müssen, wobei sich die Situation aktuell ins
Positive verwandle. Bei den Milcherzeugern sei die
Situation genau andersherum. Wo der Milchpreis zu
einem ungeahnten Höhenflug angesetzt habe, sei er
derzeit wieder am Fallen. Dazu müssten er und seine
Berufskollegen mit den explodierenden Preisen für
Dünge- und Betriebsmittel, Energiekosten und Löhne
zurechtkommen. Der Strukturwandel setze sich
ungebremst fort, wer einmal die Hoftore zugesperrt
hat, der werde sie nicht mehr öffnen.
In ihren Grußworten versicherten sämtliche Redner, eng an der Seite der Landwirtschaft zu stehen. Die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer (CSU) wünschte sich mehr Männer und Frauen aus der Praxis in der Politik und im Staatsapparat, um unrealistische Entscheidungen in Zukunft zu vermeiden. MdL Tim Pargent von den Grünen beklagte den immer noch weiter voranschreitenden Flächenfraß. „Wenn die Fläche erst einmal weg ist, dann brauchen wir nicht mehr über die Düngeverordnung oder über mehr Öko-Landwirtschaft diskutieren“, sagte er. Bayreuther Oberbürgermeister Thomas Ebersberger wünschte sich mehr Produkte aus regionaler Erzeugung in Schulen und Kantinen. So könnte man die hochwertige Lebensmittelproduktion vor Ort sichern.
Beim Bauerntag wurden zahlreiche aktive Ortsobmänner für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. Für 15 Jahre: Michael Schmidt (Ortsverband Gefrees), Dieter Albrecht (Haag-Schreez), Alfred Legath (Kirchenpingarten). Für 20 Jahre: Marco Riedelbauch (Bärnreuth), Gerhard Meyer (Creez-Pettendorf), Martin Gebhardt (Döhlau), Wolfgang Lochmüller (Fischbach), Roland Hagen (Lessau), Rainer Zimmermann (Lindenhardt), Siegfried Gerstacker (Wohnsgehaig). Für 25 Jahre: Hermann Redel (Eschen-Busbach), Dieter Dressendörfer (Emtmannsberg), Markus Böhm (Escherlich), Harald Bauer (Glashütten), Dieter Wolfrum (Neudorf), Hans Lindner (Neuhof), Günther Schirbel (Ramsenthal), Gerhard Wunderlich (Würnsreuth). Für 30 Jahre: Wolfgang Hacker (Bindlach-Crottendorf), Karl-Heinz Probst (Draisenfeld), Ewald Kießling (Streitau-Witzleshofen), Georg Schmidt (Nemmersdorf), Peter Reichenberger (Oberwarmensteinach). Für 35 Jahre: Helmut Hohlweg (Bad Berneck), Heinrich Geißler (Gottsfeld), Manfred Etterer )Kirchenlaibach), Harald Galster (Stein). Für 45 Jahre: Dietmar Höss (Mehlmeisel).
Bilder:
1. Ein Präsentkorb für den BBV-Präsidenten (von
links): der stellvertretende Kreisobmann Harald
Galster, Kreisbäuerin Angelika Seyferth, Günther
Felßner, Kreisobmann Karl Lappe und
BBV-Geschäftsführer Harald Köppel.
2. Für seine 45jährige Tätigkeit als aktiver
Ortsobmann zeichneten der bayerische BBV-Präsident
Günther Felßner (links) Dietmar Höss aus Mehlmeisel
aus.
Landfrauen sind stille Heldinnen / Wunsiedler Landfrauentag: Christine Medick zur Ehrenkreisbäuerin ernannt
Bad
Alexandersbad, Lks. Wunsiedel. Die Ernennung von
Christine Medick zur Ehrenkreisbäuerin war der
Höhepunkt des Wunsiedler Landfrauentages im
Evangelischen Bildungszentrum (EBZ) von Bad
Alexandersbad. Sichtlich gerührt nahm die
langjährige Kreisbäuerin Urkunde und Geschenke
entgegen und appellierte an die Landfrauen, sich
ehrenamtlich zu engagieren.
Der Wunsiedler Landfrauentag hatte diesen Namen auch wirklich verdient, denn Kreisbäuerin Karin Reichel hatte ein Programm zusammengestellt, das tatsächlich fast einen ganzen Samstag ausfüllte. Schon am Vormittag ging es mit einem ausgiebigen Brunch in der Turnhalle des Bildungszentrums los. Am Nachmittag folgten dann neben den Ansprachen und der Auszeichnung von Christine Medick mehrere Auftritte des Landfrauenchors, eine Andacht von Bäuerin und Prädikantin Andrea Marth sowie der Auftritt der Faschingsgesellschaft Rot-Weiß-Schirnding, der auch außerhalb der Saison viel Zuspruch erfuhr.
Der oberfränkischen Bezirksbäuerin Beate Opel kam der Part zu, das Wirken von Christine Medick zu würdigen. Ihren Worten zufolge wurde die künftige Ehrenkreisbäuerin 1996 erstmals zur Ortsbäuerin gewählt, ein Amt, das sie auch heute noch wahrnimmt. Von 1997 bis 2002 sowie von 2017 bis 2022 war sie stellvertretende Kreisbäuerin, von 2002 bis 2017 Kreisbäuerin. Christine Medick ist Gemeinderätin von Thiersheim und gehört dem Wunsiedler Kreistag an, zunächst für die CSU mittlerweile für die Freien Wähler. Sie habe sich in herausragender Art und Weise um den Berufsstand verdient gemacht“, sagte Beate Opel.
Zuvor
hatte Kreisobmann Harald Fischer das Wirken von
Christine Medick in launigen Worten und untermalt
mit vielen Fotos Revue passieren lassen. Was dabei
auffiel: immer wieder hatte sie das Gespräch mit
Politikern gesucht, sie auf den Hof eingeladen oder
an prominenter Stelle das Wort ergriffen.
Beispielsweise bei der Fernsehsendung „Jetzt red i“.
Als der Bayerische Rundfunk in Marktredwitz Station
machte, legte sich Christine Medick für die
Einführung des Schulfaches Alltagskompetenzen ins
Zeug. Nicht ohne Erfolg, wie es scheint, denn erst
vor kurzem hatte Ministerpräsident Markus Söder
wieder Hoffnung gemacht, dass das Fach doch noch
kommt.
Neben der Ehrung stand das Jubiläum 75 Jahre Landfrauenarbeit im BBV im Mittelpunkt des Tages. Das klassische Rollenbild Kinder, Küche, Kirche, das gebe es zwar immer noch, doch längst nicht mehr so oft. Die Landfrau von heute sei alles in einem: Betriebsleiterin, Unternehmerin, Mittelpunkt und Anlaufstation der Familie, Pflegerin, Macherin und stille Heldin. „Wir lassen uns schon lange nicht mehr aufs Tortenbacken reduzieren, sondern tragen Mitverantwortung“, so Kreisbäuerin Karin Reichel. Nun sei es wichtig, gegenüber Politik und Gesellschaft selbstbewusst aufzutreten und Flagge für den Berufsstand zu zeigen. Nur so könne es gelingen genug junge Leute zu finden, um die Betriebe weiterzuführen.
Bei der kleinen Andacht in den Räumen des Evangelischen Bildungszentrums stellte Andrea Marth aus Hildenbach bei Wunsiedel die Jahreslosung „Du bist ein Gott, der mich sieht“ in den Vordergrund. Andrea Marth gehört seit den letzten Wahlen der Kreisvorstandschaft der Wunsiedler Landfrauen an. Sie ist Bäuerin, aber auch Prädikantin. Das bedeutet, sie ist ehrenamtliche evangelische Predigerin und darf auch eigene Gottesdienste gestalten. Sie gab den Landfrauen viel Selbstvertrauen mit auf den Weg und sagte: „Ihr alle seid Powerfrauen“. Andrea Marth rief dabei auch dazu auf, sich nicht vom Perfektionismus von TV-Sendungen wie Landfrauenküche blenden zu lassen. „Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, gut inszeniert und perfekt in Szene gesetzt“, sagte sie.
Bild:
1. Bezirksbäuerin Beate Opel und Kreisbäuerin Karin
Reichel (von links) sowie Kreisobmann Harald Fischer
und die stellvertretende Kreisbäuerin Nicole
Orschulok (von rechts) ernannten Christine Medick
zur Ehrenkreisbäuerin von Wunsiedel.
2. In Wunsiedel trägt er den Spitznamen „Sechsämter-Moila“:
Der Landfrauenchor unter der Leitung von Elke
Hofmann.
Beitragserhöhung beschlossen, Betriebshelfer gesucht / Maschinenring Bayreuth-Pegnitz: Bäuerliche Selbsthilfeeinrichtung bietet breites Dienstleistungsangebot
Bayreuth.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring
Bayreuth-Pegnitz sieht sich für die Zukunft gut
aufgestellt. Zwar war der Verrechnungswert, also die
Summe aller überbetrieblich erbrachten Leistungen
von knapp 8,2 auf gut 7,8 Millionen Euro
zurückgegangen, doch war dies vor allem dem
fortschreitenden Strukturwandel und der gesamten
Corona-Thematik geschuldet. Um auch weiterhin die
breite Dienstleistungspalette aufrechterhalten zu
können, wurden bei der Jahresversammlung in der
Tierzuchtklause die Mitgliedsbeiträge angehoben.
Der Grundbeitrag pro Mitglied und Jahr liegt künftig bei 50 Euro und damit um zehn Euro höher als bisher. Dazu kommt die Umlage, pro Hektar landwirtschaftlicher Fläche werden künftig 1,50 Euro fällig, bisher war es ein Euro. Außerdem gibt es verschiedene Preissteigerungen bei einzelnen Dienstleistungen. Belege, beispielsweise, die per Post und nicht per E-Mail verschickt werden, kosten künftig 2,50 Euro.
Die letzte Beitragserhöhung liege mehr als zehn Jahre zurück, sagte Vorsitzender Reinhard Sendelbeck aus Gottsfeld. Allein um die inflationsbedingten Steigerungen abzudecken seien pro Jahr 10.000 Euro an Mehreinnahmen notwendig, wenn das umfangreiche Dienstleistungsangebot des Maschinenrings aufrechterhalten werden soll. Schon jetzt sei das Arbeitsaufkommen mit dem bisherigen Personalstand kaum noch zu bewältigen.
Im Zentrum der Arbeit des Maschinenringes steht traditionell die Vermittlungen von landwirtschaftlichem Gerät. Zwei John-Deere-Schlepper, sechs Pflüge, alle mit hydraulischer Schnittbreitenverstellung und Steinsicherung, sowie mehrere Kurzscheibeneggen und Grubber hat der Ring als Mietmaschinen im Angebot. Während die Auslastung der Schlepper mit 1.192 Stunden rückläufig war, sind die Einsatzstunden der Bodenbearbeitungsgeräte stabil geblieben. Über 100 Nutzer zählt der Jahresbericht auf, pro Betrieb bis zu sechs Einsätze. „Damit bieten wir auch für kleine Betriebe die Möglichkeit, schlagkräftige Technik einzusetzen“, sagte Geschäftsführer Johannes Scherm.
Zweites Standbein in der Arbeit des MR Bayreuth-Pegnitz ist die Betriebshilfe. „Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Kräften“, sagte Geschäftsführer Johannes Scherm. Er versprach eine abwechslungsreiche Tätigkeit, mit täglich neuen Herausforderungen, neuen Maschinen und dankbaren Einsatzbetrieben. Aktuell sind 13 haupt- und 20 nebenberufliche Kräfte für den Maschinenring tätig. Sie alle haben im zurückliegenden Jahr insgesamt 23.391 Stunden soziale Betriebshilfe geleistet, das heißt, sie wurden in Krankheitsfällen, bei Klinik- oder Reha-Aufenthalten oder schlimmstenfalls bei Todesfällen auf landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt, denn dort muss die Arbeit ja stets weitergehen. Bei der sozialen Betriebshilfe war die Zahl der geleisteten Stunden sogar angestiegen, im Jahr zuvor waren es noch 21.711 Stunden. Keine so große Rolle spielt dagegen mehr die wirtschaftliche Betriebshilfe, etwa zur Abdeckung von Arbeitsspitzen, mit nur noch 9.309 Arbeitsstunden.
Zum weiteren Dienstleistungsangebot des Maschinenrings gehören die biologische Maiszünslerbekämpfung durch die Ausbringung von Schlupfwespen per Drohnen, Seilwindenprüfungen, Beratungsleistungen aller Art, vor allem rund um die Düngeverordnung, sowie alle möglichen Sammelbestellungen. In der MR Oberfranken Mitte GmbH hat der Maschinenring Bayreuth zusammen mit den Nachbarringen aus Kulmbach und aus der Fränkischen Schweiz seine gewerblichen Aktivitäten gebündelt. Hier sind beispielsweise drei staatlich geprüfte Klauenpfleger tätig. Ganz neu werden Futteranalysen angeboten. Über die MR-Agrarservice ist der Maschinenring außerdem für mehrere Biomasseheizwerke zuständig.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Bayreuth-Pegnitz hat aktuell 1.282 Mitglieder, fünf weniger als im Jahr zuvor. Sie alle zusammen bewirtschaften eine Fläche von 41.419 Hektar, rund 500 mehr als im Vorjahr.
Bild: Geschäftsführer Johannes Scherm (links) und Vorsitzender Reinhard Sendelbeck (rechts) haben den Betriebshelfer Julius Seebach aus Tressau ausgezeichnet, der seit zehn Jahren hauptberuflich ununterbrochen für den Maschinenring Bayreuth tätig ist.
Käfer hat Waldbesitzer fest im Griff / WBV Hollfeld: Neuer Rekord in der Holzvermarktung
.jpg) Hollfeld.
Dem Käfer und der Trockenheit zum Trotz: Für die
Waldbesitzervereinigung Hollfeld war 2022 ein gutes
Jahr. „Unser Jahresabschluss ist sehr positiv“,
sagte der Vorsitzende Christian Dormann bei der
Jahresversammlung in der Stadthalle. Die Mitglieder
der WBV Hollfeld kommen aus den drei Landkreisen
Bamberg, Bayreuth und Kulmbach.
Hollfeld.
Dem Käfer und der Trockenheit zum Trotz: Für die
Waldbesitzervereinigung Hollfeld war 2022 ein gutes
Jahr. „Unser Jahresabschluss ist sehr positiv“,
sagte der Vorsitzende Christian Dormann bei der
Jahresversammlung in der Stadthalle. Die Mitglieder
der WBV Hollfeld kommen aus den drei Landkreisen
Bamberg, Bayreuth und Kulmbach.
Nach den Worten von Stefanie Blumers von der Geschäftsstelle wurden im zurückliegenden Jahr exakt 104.481 Festmeter Holz vermarktet, so viel wie noch nie zuvor. „Sogar den Rekord vom zurückliegenden Jahr haben wir noch einmal übertroffen“, sagte Stefanie Blumers. Damals waren es rund 82.000 Festmeter Holz. Ursache für die riesige Menge ist natürlich der Käferholzeinschlag. Bis 2020 sei alles noch ganz normal gewesen, dann habe der Käfer zugeschlagen. Von den über 104.000 Festmetern Holz waren über 97.000 Festmeter Fichten, gut 7.000 Festmeter Kiefern und nur 200 Festmeter Laubholz. Während der Schnittholzmarkt weiter stabil geblieben sei und man auch das Rundholz weiter gut habe absetzen können, sei Industrieholz sehr gefragt und auch preislich interessant gewesen.
„Der Käfer hat uns nach wie vor fest im Griff“, sagte Vorsitzender Christian Dormann. Ein Satz, den man so oder ähnlich derzeit landauf landab hört. Die Kalamitätslage habe zwischenzeitlich das gesamte Vereinsgebiet erreicht. Einmal mehr appellierte Dormann an die Waldbesitzer: „Kontrollieren Sie ihre Bestände“.
.jpg) Für
Unverständnis bei allen Waldbauern sorgten die
Überlegungen aus Brüssel, nach denen Holz als nicht
mehr nachhaltig eingestuft werden soll. „Dagegen
müssen wir mobil machen“, sagte Christian Dormann.
Er frage sich schon, was in den Köpfen derer
vorgeht, die sich so etwas ausdenken. „Holz, dass
man im eigenen Wald, vor der eigenen Haustür selbst
schlägt, soll plötzlich nicht mehr nachhaltig sei?“,
so der Vorsitzende. Hier müsse Druck von der Basis
kommen, denn die Situation nehme langsam bedrohliche
Züge an.,
Für
Unverständnis bei allen Waldbauern sorgten die
Überlegungen aus Brüssel, nach denen Holz als nicht
mehr nachhaltig eingestuft werden soll. „Dagegen
müssen wir mobil machen“, sagte Christian Dormann.
Er frage sich schon, was in den Köpfen derer
vorgeht, die sich so etwas ausdenken. „Holz, dass
man im eigenen Wald, vor der eigenen Haustür selbst
schlägt, soll plötzlich nicht mehr nachhaltig sei?“,
so der Vorsitzende. Hier müsse Druck von der Basis
kommen, denn die Situation nehme langsam bedrohliche
Züge an.,
Der Vorsitzende musste bei der Versammlung den Mitgliedern eine weitere negative Botschaft vermelden. Mit dem bereits im vergangenen Jahr beschlossenen und geplanten Neubau einer neuen Geschäftsstelle sei man noch nicht weitergekommen. „Mit unserem großen richtungsweisenden Projekt sind wir noch nicht viel weiter“, sagte Christian Dormann. Wie berichtet gab es noch keine Festlegung auf ein konkretes Grundstück. Fest stehe allerdings, dass die bisherige Geschäftsstelle in Treppendorf aus allen Nähten platzt. Deshalb hatten sich die Verantwortlichen nun entschieden, bereits im April in der Forchheimer Straße in Hollfeld ein Interimsquartier zu beziehen. Der Neubau sei damit aber keinesfalls vom Tisch.
Die WBV Hollfeld hat aktuell 1.697 Mitglieder. 81 Neuaufnahmen standen 34 Austritte gegenüber. Alle Mitglieder zusammen bewirtschaften eine Waldfläche von 13.010 Hektar.
Bei der Jahresversammlung machte Christian Kölling, der Bereichsleiter Forsten am Landwirtschaftsamt Fürth-Uffenheim, den Mitgliedern noch einmal deutlich vor Augen, wie wichtig es ist, den Waldumbau zügig anzugehen. „Der alte Wald geht dahin, das Klima werde südlicher, unser Wald hier wird nicht mehr zur Klimazukunft passen“. Als Problembaumart definierte Christian Kölling wenig überraschend die Fichte, die wohl nur noch bis zum Jahr 2040 durchhalten wird. Der Kiefer gab der Fachmann eine höhere Erwartung aber auch die Kiefer werde ab 2060, spätestens 2080 hierzulande nicht mehr vorkommen. „Das Klima erzwingt einen Zukunftswald mit teilweise neuen Baumarten.“ Die heißen dann beispielsweise Mann-Esche, Flaumeiche, oder für Christian Kölling ein „echter Renner“, die Edelkastanie. Ihr könne für die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts eine sehr gute Prognose gegeben werden.
Bild: „Der Käfer hat uns nach wie vor fest im Griff“: Vorsitzender Christian Dormann.
Mehr Betriebshilfe, weniger Maschinen / Trotz leicht gesunkenem Verrechnungswert: Maschinenring Wunsiedel wieder im gewohnten Rhythmus
Höchstädt.
„Es bleibt spannend auf den Höfen.“ Das sagt Martin
Goldschald, der Vorsitzende des Maschinen- und
Betriebshilfsrings Wunsiedel. Bei der
Jahresversammlung in Höchstädt war die Freude groß,
dass der Zusammenschluss nach der Corona-bedingten
Pause wieder in den gewohnten Rhythmus zurückkehren
konnte. Das Auf und Ab auf den Märkten und die
geradezu explodierenden Preise vor allem für
Betriebsmittel und Treibstoff habe den Bauern im
Landkreis jedoch erhebliches Kopfzerbrechen
bereitet.
„Auch wenn die Preise immer Moment wieder etwas nach unten gehe, Dünger und Diesel kosten immer noch das Doppelte als vor dem Krieg in der Ukraine“, sagte Goldschald. Vor allem Veredler und Ackerbauern hätten abermals das Nachsehen. Die unruhigen Zeiten hätten natürlich auch dafür gesorgt, dass der Arbeitsaufwand in der Geschäftsstelle des Maschinenrings nicht gerade weniger wird. Ob Agrardieselanträge, Mehrfachantrag, Düngebedarfsermittlung oder KULAP: Die Arbeit geht dem Ring nicht aus.
Die beiden wichtigsten Säulen in der Ringarbeit sind nach wie vor die Vermittlung von Maschinen und die Betriebshilfe. Insgesamt seien 17590 Stunden Betriebshilfe geleistet worden, über 2000 mehr als noch im Jahr zuvor, so Geschäftsführer Andreas Hager. 12183 Stunden entfielen dabei auf die soziale Betriebshilfe, also bei Krankheit oder sonstigen Ausfällen auf dem Hof, nur 5407 Stunden seien der wirtschaftlichen Betriebshilfe zuzuordnen, also etwa zur Abdeckung von Arbeitsspitzen.
Zweites Standbein des Rings ist die Vermittlung von Maschinen und landwirtschaftlichem Gerät. Der verrechnete Wert alles Maschineneinsätze war dabei geringfügig um vier Prozent auf 2,15 Millionen Euro nach unten gegangen. Während beispielsweise die Bereiche Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz, Körnermais bei der Nachfrage teilweise um bis zu 25 Prozent zulegten, nahmen die Sparten Futterbau und Strohernte, sowie Schlepper und Transport um jeweils bis zu 20 Prozent ab. Als Gründe dafür nannte der Geschäftsführer die Tatsache, dass ein Silageschnitt aufgrund der Trockenheit ausgefallen ist und weniger Grünfutter gefahren werden musste.
Unter anderem deshalb ist auch der Verrechnungswert, also die Summe aller erbrachten Leistungen, geringfügig von 3,2 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 3,04 Millionen Euro im zurückliegenden Jahr gesunken.
Der gewerbliche Bereich ist beim Maschinenring in die MR Hochfranken GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft ausgelagert. Der Maschinenring Münchberg, der zuletzt 50 Prozent gehalten hatte, ist seit 2022 kein Teilhaber mehr, man arbeite aber auch weiterhin gut zusammen, so der Vorsitzende Martin Goldschald. Hauptumsatzträger der GmbH sei der Winterdienst, so dessen Geschäftsführer Reinhard Rasp. Ein weiterer wichtiger Bereich sei die Baumpflege. Im Auftrag des Straßenbauamtes führe die GmbH unter anderem auch insektenschonende Mäharbeiten durch, kümmere sich um die Sportplatzpflege und sei an der Holzenergie Hochfranken, die in Weißenstadt dien Therme beheizt beteiligt.
Nach den Worten des Geschäftsführers hat der Maschinenring Wunsiedel aktuell exakt 603 Mitglieder. Drei Neuzugängen standen sieben Austritte gegenüber. Alle Mitglieder zusammen bewirtschaften eine Fläche von 22418 Hektar, was nahezu komplett der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Landkreis entspreche. Mit Sandra Dornhöfer, Simon Regnet und Toni Zeitler wurden bei der Jahresversammlung auch die drei Betriebshelfer geehrt, die am meisten Stunden geleistet hatten.
Bild: Der Maschinen- und Betriebshilfsring Wunsiedel hat seine stundenstärksten Betriebshelfer geehrt. Im Bild von links: Vorsitzender Martin Goldschald, Sandra Dornhöfer, Geschäftsführer Andreas Hager, Toni Zeitler, 2. Vorsitzender Michael Groschwitz, Simon Regnet und Matthias Benker, der in der Geschäftsstelle für die Organisation der Betriebshilfe zuständig ist.
Ein dickes Lob allen Landfrauen / Ministerpräsident Markus Söder beim Kulmbacher Landfrauentag
Stadtsteinach.
Da tanzen sogar die Puppen, wenn der bayerische
Ministerpräsident Markus Söder nach Stadtsteinach
kommt. Zumindest in Gestalt des „Weiber-Balletts“
aus Stadtsteinach unter der Leitung von Verena
Ramming. „Heute ist ein ganz besonderer Tag unter
ganz besonderen Umständen“, wird die Kulmbacher
Kreisbäuerin und oberfränkische Bezirksbäuerin Beate
Opel aus Neufang später sagen. Und mit seiner
launigen Rede, gespickt mit jeder Menge Gags, die
noch vom Aschermittwoch übrig waren, gelingt es
Markus Söder sofort, die Herzen der Landfrauen zu
gewinnen.
Gemunkelt wurde ja schon länger, doch erst drei Tage vorher kam die offizielle Bestätigung: der bayerische Ministerpräsident besucht am Sonntagnachmittag den Kulmbacher Landfrauentag in Stadtsteinach. Pünktlich um 13 Uhr trifft er ein, die Sicherheitsleute halten sich im Hintergrund und Markus Söder fühlt sich in der nicht ganz voll besetzten Steinachtalhalle sichtlich wohl.
Zwei
Versprechen gibt der Ministerpräsident an diesem
Nachmittag ab, eines davon ist den Landfrauen
besonders wichtig: Sollten die entsprechenden
Projektwochen an den Schulen nicht erfolgreich sein,
soll ab dem kommenden Schuljahr doch noch das
Schulfach „Lebens- und Alltagskompetenzen“
eingeführt werden. „Damit soll den jungen Leuten
vermittelt werden, wie wichtig in Bayern die
Ernährungsproduktion, die Arbeit der Landwirte und
der ländliche Raum sind“, so Söder. Diese Forderung
nach einem eigenen Schulfach ist so neu nicht. Die
stattdessen eingeführten Projektwochen haben bislang
nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Söders zweites Versprechen dürfte speziell die Kulmbacher freuen: „Ich komme auch heuer wieder zur Bierwoche“, ruft er in die Halle und spannt einen Bogen vom Starkbieranstich auf dem Nockherberg zwei Tage zuvor bis zum Loblied für Bayern und besonders Franken. „Bayern ist schön, aber Franken ist halt doch was ganz Besonderes.“
Schließlich
kennt auch sein Lob für die Landfrauen kaum Grenzen:
„Sie sind Managerinnen, Finanzministerinnen,
Seelsorgerinnen und tragen ein hohes Maß an
politischem Engagement mit sich. Natürlich sind die
Landfrauen am Ende begeistert. Die Rede sei schon
sehr optimistisch gewesen, sagt Elke Browa,
Kreisbäuerin aus dem Nachbarlandkreis Hof. Nun hoffe
sie auch auf die Umsetzung, schließlich hätten die
Landfrauen stets für mehr Regionalität geworben.
Angelika Seyferth, Kreisbäuerin aus Bayreuth, die
sich schon lange für das Fach „Lebens- und
Alltagskompetenzen“ einsetzt, freut sich, dass Söder
ein entsprechendes Schulfach favorisiert. „Wir legen
Wert darauf, dass das auch umgesetzt wird, sagt sie.
Das Schulfach sei wichtig und auch die Umsetzung der
Forderung, dass in den Kantinen 50 Prozent des
Angebots aus regionaler Produktion kommen soll,
ergänzt die stellvertretende Bayreuther Kreisbäuerin
Doris Schmidt. Gut sei es, dass der
Ministerpräsident den Wert einer ausgewogenen
Ernährung sie in den Mittelpunkt gestellt habe und
nicht auf vegetarisch oder vegan setze.
In
ihren Grußworten versichern sämtliche Mandatsträger
aus Stadt und Land, dass sie fest an der Seite der
Landwirtschaft stehen. Ein großes Kompliment für
Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel haben Landrat
Klaus Peter Söllner und die Bundestagsabgeordnete
Emmi Zeulner im Gepäck. Auch der Landtagsabgeordnete
Martin Schöffel, lobt Beate Opel, die sich stets mit
aller Kraft für die Landwirtschaft und die
bäuerliche Kultur einsetze. Landtagskollege Rainer
Ludwig nennt Beate Opel eine „emsige, fleißige und
echte Powerfrau“. Ludwig wird aber auch ein wenig
politisch, indem er auf die Diskriminierung von
Bioenergie durch die Europäische Union eingeht: „Wer
den Rohstoff Holz ausbremst und als nicht mehr
nachhaltig anerkennt, der ist auf dem Holzweg“, sagt
Ludwig.
Bei solch geballter Politprominenz geht der eigentliche Vortag zum diesjährigen Motto der Landfrauenarbeit im Bauernverband „Mit uns leben die Dörfer“, den die stellvertretende bayerische Landesbäuerin Christine Reitelshöfer aus Petersaurach im mittelfränkischen Landkreis Ansbach hält, fast ein wenig unter. Schade auch um die hörenswerten Lieder von Silvia Wachter aus Marktrodach, sie ist „Singbegleiterin für heilsames und gesundheitsförderndes Singen“ und begleitet ihren Gesang ganz alleine auf der Gitarre.
Bilder oben:
1.
Markus Söder.
2.
„Weiber-Ballett“
Stadtsteinach.
3.
Söder auf dem Weg in die
Halle.
4.
Gruppenbild mit den
Mandatsträgern vor der Halle.
5.
Von links: Kreisbäuerin
Beate Opel, MdL Martin Schöffel, Markus Söder,
MdL
Rainer Ludwig.
Von der Aussaat bis zur Ernte: Landfrauen feiern 75-jährigen Bestehen / Prominenteste Gratulantin beim Landfrauenabend war die Kabarettistin Lizzy Aumeier
Köditz.
„Vom Bauernhof auf die Bühne.“ So lautete diesmal
das Motto des Hofer Landfrauenabends. Eine neue
Kreisvorstandschaft machte es möglich. Nicht nur,
dass es überhaupt wieder eine große
Landfrauenveranstaltung in der Göstrahalle gab,
erstmals fand der Landfrauentag in einem neuen
Format am Abend statt. Als Krönung hatten sich die
Verantwortlichen mit der Kabarettistin Lizzy Aumeier
einen prominenten Gast eingeladen. Mit viel
Spontanität und ihren teilweise derben Witzen sorgte
die aus der Oberpfalz stammende Künstlerin für so
manchen Schenkelklopfer.
Wenig zu lachen hatte Bürgermeister Matthias Beyer, der von Anfang an in das Programm von Lizzy Aumeier einbezogen wurde. Da war es unvermeidlich, dass er irgendwann auf die Bühne kommen musste, um mit der Kabarettistin eine Szene aus dem Film „Titanic“ nachzuspielen. Mit jeder Menge zweideutigen Anspielungen und viel Humor versteht sich. Den brauchte man als Mann bei Lizzy Aumeier auch, denn sie versteht sich als die Frau mit „Hang zum Herrenwitz“. Da ist Schlagfertigkeit gefragt und wegducken angesagt, wenn sie sich mal wieder ein „Opfer“ aus dem Publikum sucht. Alles in allem war der Auftritt von Lizzy Aumeier eine willkommene Abwechslung nach drei Jahren Corona-Pause und ein Beweis dafür, was Landfrauen so alles auf die Beine stellen können.
Weil die Landfrauen im Bauernverband in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiern, galt es diesmal auch, ihre Leistungen besonders herauszustellen. Dafür war nicht nur die Kreisbäuerin Elke Browa aus Hirschberglein zuständig, sondern auch die gesamte neue Vorstandschaft. „Wir haben den abwechslungsreichsten Beruf, den es gibt“, sagte beispielsweise Sandra Puchta aus Großlosnitz. Katrin Kießling aus Edlendorf beschrieb die Landfrauen als eine starke und lebendige Gesellschaft und Stefanie Schmidt aus Isaar meinte, dass vor allem die Landfrauen nach getaner Arbeit auch sehen könnten, was sie geleistet haben, und das „von der Aussaat bis zur Ernte“. Nicht zuletzt lerne man auch immer wieder nette Menschen kennen, so Lisa Sachs aus Straas und Christine Schmidt aus Selbitz ergänzte: „Wer sonst, wenn nicht die Landfrauen, sollten die Landwirtschaft Familien und Kindern nahe bringen“.
Landfrau
zu sein, das bedeute unter anderem: Verantwortung zu
übernehmen, überwiegend optimistisch zu sein, für
jedes Problem eine Lösung zu finden und gern in
geselliger Runde zu sein, so Kreisbäuerin Elke Browa.
„Wir sind das Beste, was dem Land und was den
Männern passieren kann“, sagte sie augenzwinkernd.
Ihre Vorgängerin Karin Wolfrum, die erst kürzlich
zur Ehrenkreisbäuerin ernannt wurde, wünschte der
Vorstandschaft viel Glück und Erfolg für die sicher
leichter werdenden Zeiten, die auf uns alle
zukommen. Allen Vorstandsmitgliedern überreichte sie
deshalb eine Hoffnungskerze.
Ganz von der Bühne trat Karin Wolfrum allerdings nicht ab. Zusammen mit dem Landfrauenchor unter der Leitung von Helmut Lottes sang sie nicht nur Traditionelles wie „Nimm die Stunden“ oder „Ich bin an Dorfkind“, sondern auch eine Choradaption des Abba-Hits „Dancing Queen“.
Eines hätten die Landfrauen ihren Männern auf jeden Fall voraus, so Bürgermeister Matthias Beyer zuvor in seinem Grußwort. Sie hätten den Generationswechsel vollzogen und wieder genügend Aktive gefunden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Er spielte damit auf die Tatsache an, dass für den ausgeschiedenen Kreisobmann Hermann Klug noch immer kein Nachfolger gefunden wurde.
Bilder:
1. Kabarettistin Lizzy Aumeier nahm sich beim Hofer
Landfrauenabend unter anderem den Köditzer
Bürgermeister Matthias Beyer vor.
2.
Von
Volksliedern bis zu Popsongs: der Hofer
Landfrauenchor steht für Tradition und Moderne.
Ohne Bauern keine Industrie / Regierung von Oberfranken verabschiedete 13 frischgebackene Meister der Landwirtschaft
Bayreuth.
13 junge Leute aus allen Teilen Oberfrankens haben
ihre Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister
erfolgreich bestanden. Aus den Händen von
Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz erhielten
die zwölf Männer und mit Marisa Döhla aus Sparneck
im Landkreis Hof auch eine Frau ihre Zeugnisse. „Sie
sind auf der höchsten Stufe der Fortbildung im
praktischen Bereich angekommen“, sagte die
Regierungspräsidentin. Alle 13 seien in ihrem
Traumberuf angekommen, sie müssten sich aber auch
darüber im Klaren sein, dass sie vor einer Zukunft
mit großen Herausforderungen stehen.
Heidrun Piwernetz bezeichnete die Landwirtschaft als Schlüsselbranche des 21. Jahrhunderts. Deshalb wünsche sie sich auch mehr Verständnis von Seiten der Gesellschaft für die Situation der Bauern. Zumal das Thema Nahrungsmittelsicherheit mit dem Krieg in der Ukraine wieder in den Focus geraten sei. Doch die Landwirte könnten noch viel mehr, als wertvolle Lebensmittel erzeugen. Sie stünden für den Erhalt und die Pflege des ländlichen Raumes, für ein aktives Dorfleben und für die Erzeugung regenerativer Energien. „Sie haben uns auf ihrer Seite, wenn es darum geht, die Landwirtschaft realistisch darzustellen“, sagte Heidrun Piwernetz im Namen der Regierung von Oberfranken.
In seinen „Anmerkungen zur Innovationskraft der oberfränkischen Landwirte“ nannte der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Günther Dippold Bildung als das sicherste Mittel, um die Zeiten des Wandels zu bestehen. „Wissen und Können bleiben“, so Dippold, der in seine Ausführungen einen weiten Bogen über die Geschichte der Landwirtschaft in Oberfranken in den zurückliegenden Jahrhunderten spannte. Die Landwirtschaft sei dabei immer Veränderungen ausgesetzt gewesen und habe stets die Kraft gehabt sich immer wieder neu zu erfinden.
Ausgehend vom bisher bekannten frühesten Kartoffelanbau um 1647 in Pilgramsreuth im heutigen Landkreis Hof zog Bezirksheimatpfleger Dippold den Schluss, dass es ohne die Kartoffel keine industrielle Revolution gegeben hätte, denn die Kartoffel sei schnell ein beliebtes und weit verbreitetes Nahrungsmittel geworden. Für Dippold war deshalb auch klar: „Ohne Bauern keine Industrie“.
Fleiß, Wissen, Einsatz und Talent, das alles bescheinigte der Hofer Landrat Oliver Bär den erfolgreichen jungen Leuten, von denen einige künftig als Betriebsleiter tätig sein werden. „Wer sich in der Landwirtschaft engagiert, der engagiert sich auch in der Gesellschaft“, so der Landrat. Kaum eine Branche sei so entwicklungsaffin wie die Landwirtschaft und kaum eine Branche decke so viele Bereiche ab,.
Die folgenden frischgebackenen Landwirtschaftsmeister haben ihre Urkunden erhalten: Heinrich Ott aus Hirschaid im Landkreis Bamberg, Jochen Albrecht aus Haag, Manuel Arnold aus Pegnitz, Lukas Haberberger, ebenfalls aus Pegnitz, und Christian Schirbel aus Bad Berneck (alle Landkreis Bayreuth). Ferner Adrian Becker aus Coburg, Jakob Wunder aus Wiesenttal im Landkreis Forchheim, Matthias Bär aus Selbitz, Marisa Döhla aus Sparneck, Arnold Köppel aus Schwarzenbach an der Saale und Fabian Langheinrich aus Schauenstein (alle Landkreis Hof), Peter Hübner (in Abwesenheit) aus Kasendorf im Landkreis Kulmbach sowie Felix Reisenweber aus Untermerzbach im unterfränkischen Landkreis Hassberge.
Bilder: Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz überreichte die Meisterbriefe an 13 junge Leuten aus allen Teilen Oberfrankens.
Betriebshelfer händeringend gesucht / Gute Zahlen trotz leichtem Abwärtstrend: Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach als verlässlicher Partner der Landwirtschaft
Kulmbach, Die allgemeine Personalnot geht auch an den Maschinen- und Betriebshilfsringen nicht spurlos vorüber. „Wir brauchen dringend Leute, sonst können wir unsere Aufgaben nicht mehr bewältigen“, sagte Geschäftsführer Horst Dupke bei der Jahresversammlung des Maschinenrings Kulmbach.
Trotz Helferrückgangs habe der MR Kulmbach im zurückliegenden Jahr immer noch rund 17500 Stunden abdecken können. Der weitaus größte Teil davon entfällt auf die sozialen Betriebshilfe, die immer dann notwendig wird, wenn zum Beispiel ein Betriebseiter erkrankt, einen Unfall hat, wegen einer Operation außer Gefecht ist oder zur Kur muss. Im Jahr 2021 waren es noch 22500 Stunden. Der Maschinen- und Betriebshilfsring verstehe sich dabei als der Ansprechpartner, der sämtliche Formalitäten erledigt und die Verhandlungen mit dem Sozialversicherungsträger führt. Kaum noch Nachfrage gebe es im Kulmbacher Land nach wirtschaftlicher Betriebshilfe, etwa zur Abdeckung von Arbeitsspitzen.
Die Tätigkeit als Betriebshelfer für den Maschinenring sei eine gute Möglichkeit, wenn es darum geht, Geld hinzuzuverdienen, sagte der Geschäftsführer. Auch für landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Beschäftigten in weniger arbeitsintensiven Zeiten nicht auslasten können. Gesucht seien aber auch Betriebshelfer in Festanstellung, sei es in Teilzeit oder in Vollzeit.
Auch die Maschinenring Oberfranken Mitte (OMI) ist auf der Suche nach Personal. In der GmbH haben die drei Ringe Bayreuth-Pegnitz, Fränkische Schweiz und eben Kulmbach ihre gewerblichen Aktivitäten ausgelagert. Wie Alexander Hollweg berichtete, seien vor allem Mitarbeiter für den Winterdienst, aber auch zur Grünflächen und Gehölzpflege gesucht. Von den drei Ringen seien zwar zusammen rund 170 Mitarbeiter im Einsatz, doch um weitere gewerbliche Aufträge annehmen zu können, seien auch weitere Arbeitskräfte notwendig. Auch ein Nachfolger für einen ausscheidenden Klauenpfleger werde händeringend gesucht.
„Unser gemeinsames Ziel ist es, die Betriebshilfe im Landkreis Kulmbach auch künftig zu organisieren und sicherzustellen“, sagte der Vorsitzende Andreas Textores. Wenn auch der Trend leicht nach unten zeigt, so könne man auf die vorliegenden Zahlen dennoch stolz sein, so Geschäftsführern Horst Dupke. Dern Verrechnungswert aller erbrachten Leistungen bezifferte er auf 3,96 Millionen Euro, im Vorjahr waren es mit 4,04 Millionen Euro nur geringfügig mehr. Der Maschinenring Kulmbach hat aktuell 834 Mitglieder, 16 weniger als im Jahr zuvor.
Zweiter wesentlicher Aufgabenbereich des MR Kulmbach ist die Vermittlung von Maschinen. Hier schlugen im Wesentlichen die Futter- und Strohernte, das weite Feld der Landschaftspflege, die Körnerernte und –aufbereitung sowie der Verleih von Schleppern zu Buche. Darüber hinaus sieht sich der Maschinenring als verlässlicher Partner, wenn es um die Mehrfachanträge, um Gasölanträge oder um Düngedokumentationen geht.
Wie in jedem Jahr wurden auch diesmal wieder die drei Betriebshelfer mit den meisten Einsatzstunden besonders geehrt: Thomas Kraß aus Guttenberg, Dominic Hofmann aus Buchau und Karl Ludwig Hain aus Schwärzleinsdorf bei Stadtsteinach. Alle drei hatten im zurückliegenden Jahr jeweils mehre als 1000 Stunden geleistet. Nur Karl Ludwig Hain konnte die Ehrung persönlich entgegennehmen, die anderen beiden waren verhindert.
Bei der Jahresversammlung referierten Thomas Ludwig vom AGCO-Fendt-Konzert und Stefan Sack von CNH-Industrial-Konzern, zu dem die Marken Fendt und Steyr gehören, über Antriebssysteme der Zukunft. Beide kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass man im Bereich großer Traktoren nach wie vor nicht auf den Dieselmotor verzichten kann. Mittel- und langfristig sahen sie die Zukunft bei dezentral zu erzeugbaren Energien wie Methan, Methanol oder Wasserstoff. Auch synthetische Kraftstoffe, die auf chemischer Basis erzeugt werden, könnten eine Rolle spielen. Beide Konzerne steckten derzeit große Anstrengungen in entsprechende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Den klassischen Elektroantrieb stuften die beiden Experten zumindest für den landwirtschaftlichen Bereich aufgrund der dort herrschenden außergewöhnlichen Anforderungen als eher unwahrscheinlich ein.
Mikroorganismen für das Klimas / Sobac Deutschland GmbH zeigte Landwirten neue Wege zu fruchtbaren Böden – Infoveranstaltung in Alladorf
Alladorf. Für Düngemittel müssen die Bauern seit geraumer Zeit tief in die Tasche greifen, wenn sie überhaupt noch mineralische Dünger bekommen. Oft sind Düngemittel gar nicht mehr verfügbar und wenn, dann sind sie den hohen Preisen hilflos ausgeliefert. Dazu kommt der Ärger um die Gelben und Roten Gebiete, deren Ausweisung betroffenen Landwirten das Wirtschaften deutlich schwerer bis unmöglich macht.
„Wir sind an einem Wendepunkt, wo wir nach neuen Möglichkeiten suchen müssen“, so der für Oberfranken zuständige Fachberater Michael Ohlmann vom Unternehmen Dehner Agrar bei einer Informationsveranstaltung der Sobac Deutschland GmbH in Alladorf bei Thurnau. „Die Landwirte sind bereit umzudenken“ sagte Ohlmann. Wie sehr das Thema den Bauern unter den Nägeln brennt, zeigte der Besuch. Rund 120 Landwirte aus dem Kulmbacher Raum aber auch aus den Nachbarlandkreis Bamberg und Bayreuth waren ins neue Alladorfer Dorfhaus gekommen.
Bei der Sobac Deutschland GmbH handelt es sich um ein französischen Unternehmen, das einen Spezialdünger produziert, der auf pflanzlichen Komposten basiert und der den Humusaufbau im Boden deutlich verbessert. Der Einsatz von Mineraldünger wird dabei deutlich reduziert, was sich wiederum positiv auf die Bodenwerte auswirkt. Die Erträge bleiben trotzdem stabil, steigen im besten Fall sogar.
 „Wir bauen in
Ihren Böden Humus auf und erhöhen ihre
Fruchtbarkeit. Sie reduzieren die mineralische
Düngung und sind bestens gerüstet um den roten
Gebieten die Stirn zu bieten“, sagte Anne-Christine
von Mülmann (Bild), Chefin der Sobac Deutschland. Ihren
Worten zufolge basiert das Konzept auf ausgewählte
Kulturen sowie pflanzliche Mikroorganismen und deren
Trägerstoffen. Es ist einsetzbar bei allen denkbaren
Kulturen, wie Mais, Raps oder Weizen, aber auch bei
Sonderkulturen wir Obst, Gemüse oder Kattoffeln und
sogar im Grünland.
„Wir bauen in
Ihren Böden Humus auf und erhöhen ihre
Fruchtbarkeit. Sie reduzieren die mineralische
Düngung und sind bestens gerüstet um den roten
Gebieten die Stirn zu bieten“, sagte Anne-Christine
von Mülmann (Bild), Chefin der Sobac Deutschland. Ihren
Worten zufolge basiert das Konzept auf ausgewählte
Kulturen sowie pflanzliche Mikroorganismen und deren
Trägerstoffen. Es ist einsetzbar bei allen denkbaren
Kulturen, wie Mais, Raps oder Weizen, aber auch bei
Sonderkulturen wir Obst, Gemüse oder Kattoffeln und
sogar im Grünland.
„Unser Ziel ist es, die mineralische Düngung zu reduzieren“, so Anne-Christine von Mülmann. Vor dem Hintergrund zunehmender Trockenphasen müssten die Böden in Zukunft flexibler werden, um beispielsweise mehr Wasser und Nährstoffe speichern zu können. Mikroorganismen seien dafür unverzichtbar, denn sie ermöglichte es, dass die Böden mehr Humus produzieren und damit von besserer Qualität sind. Die Landwirte stellten damit nicht nur ihre Verantwortung gegenüber der nächsten Generation unter Beweis, sondern verbesserten auch die Rentabilität ihres Betriebes.
In den obersten 30 Zentimetern des Bodens befinden sich im Schnitt pro Hektar rund vier Tonnen Kalium, fünf Tonnen Phosphor und zwischen zwei und acht Tonnen Stickstoff, rechnete die Sprecherin vor. „Warum nutzen wir diese Nährstoffe nicht aus?“ Möglich sei dies durch den Einsatz verschiedenster Mikroorganismen wie Bakterien, Hefen, Algen oder Pilzen. Mit deren Einsatz sei es möglich, pro Jahr und Hektar im Schnitt fünf Tonnen Kohlenstoff und 250 Kilogramm Stickstoff zu speichern.
As Unternehmen Sobac hat 150 Beschäftigte und erzielt einen Jahresumsatz von im Schnitt 40 Millionen Euro. Hergestellt wird der Spezialdünger im französischen Bourre, rund 150 Kilometer südlich von Paris. Vertrieben wird er unter dem Namen Quaterna Terra und Quaterne Aktiva.
Trotz negativer Rahmenbedingungen: WBV auf Wachstumskurs / Borkenkäfer hat Waldbesitzer nach wie vor im Griff – Kritik an europäischen Beschlüssen zur Holzverbrennung
 Bayreuth.
„Wir müssen beim Waldumbau deutlich zulegen.“ Das
hat Michael Schmidt, Chef des Amtes für
Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg gefordert. Bei der
Jahresversammlung der Waldbauernvereinigung Bayreuth
in der Tierzuchtklause sprach Schmidt von einer sehr
ausgeprägten Dürre in ganz Oberfranken. Am
schlimmsten sei die Situation im Frankenwald, wo es
mehr als 10.000 Hektar Kahlflächen gebe. Über eine
Million Festmeter Schadholz seien allein im
zurückliegenden Jahr angefallen, mancher
Waldbesitzer habe buchstäblich alles verloren.
Bayreuth.
„Wir müssen beim Waldumbau deutlich zulegen.“ Das
hat Michael Schmidt, Chef des Amtes für
Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg gefordert. Bei der
Jahresversammlung der Waldbauernvereinigung Bayreuth
in der Tierzuchtklause sprach Schmidt von einer sehr
ausgeprägten Dürre in ganz Oberfranken. Am
schlimmsten sei die Situation im Frankenwald, wo es
mehr als 10.000 Hektar Kahlflächen gebe. Über eine
Million Festmeter Schadholz seien allein im
zurückliegenden Jahr angefallen, mancher
Waldbesitzer habe buchstäblich alles verloren.
Auch auf dem Gebiet der WBV Bayreuth habe der Borkenkäfer den Waldbesitzern im angelaufenen Jahr jede Menge Schadholz beschert. „Der Borkenkäfer hat uns nach wie vor im Griff“, sagte der Vorsitzende Hans Schirmer. Die Aufarbeitung der Schadhölzer laufe auf Hochtouren, teilweise seien vier Harvester gleichzeitig im Einsatz. Auch wenn die Rahmenbedingungen derzeit nicht optimal sind, so seien die Preise glücklicherweise auf gutem Niveau geblieben. Um den gestiegenen Holzmengen Herr zu werden, habe die WBV zwischenzeitlich ihr Team um eine Bürokraft und um Förster Sebastian Kaufmann verstärkt.
Den Unmut des Vorsitzenden hatte ein EU-Beschluss zur Holzverbrennung hervorgerufen. Dem Beschluss vom Herbst zufolge soll die energetische Nutzung von Holz verringert und langfristig ausgebremst werden. „Das ist ja wohl der Gipfel“, schimpfte Vorsitzender Schirmer. Er sprach von einer „Riesensauerei“, wenn Holz tatsächlich nicht mehr als erneuerbare Energie gelten soll. Da könne man sich nur noch wundern, was in diesen Köpfen vorgeht, sagte Schirmer. Seinen Worten zufolge ist Holz der beste Klimaschützer, den man sich vorstellen könne. Deshalb müssten sich die Waldbauern gegen derartige Beschlüsse massiv zur Wehr setzen.
Laut Geschäftsführer Gerhard Potzel hat die WBV Bayreuth aktuell 1750 Mitglieder, 65 mehr als vor einem Jahr. Sie alle zusammen bewirtschaften eine Waldfläche von 9388 Hektar Wald, 641 Hektar mehr als im Vorjahr. Insgesamt hatte die WBV 2022 für ihre Mitglieder 60.391 Festmeter Holz vermarktet. Im Jahr zuvor waren es noch 40.120 Festmeter. Mit über 50.000 Festmetern war die Fichte die mit großem Abstand häufigste Baumart. Der Rest setzt sich im Wesentlichen aus Kiefern und aus Brennholz zusammen. Größte Abnehmer sind die Sägewerke Ziegler in Plößberg und Gelo in Weißenstadt, beziehungsweise Wunsiedel.
Die WBV sei deshalb von großer Bedeutung, da die Bayreuther Region wesentlich von der Forstwirtschaft geprägt ist und negativen Naturereignisse eher noch zunehmen werden, sagte Landrat Florian Wiedemann bei der Versammlung. Gegen weitere Stilllegungen von Waldflächen sprach sich die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer aus. „Wir wollen weder Stilllegungen, noch Ausweitungen von Großschutzgebieten“, sagte sie. Dem pflichtete auch Karl Lappe, zweiter Vorsitzender der WBV und zugleich BBV-Kreisobmann bei. „Wald ist Natur und Natur wächst, man kann sie nicht stilllegen“, richtete er seine Worte an die Politik. Seinen Worten zufolge sei der Wald ein Zukunftswald, weil er immer mehr zum Energiewald wird und immer mehr Holz in die energetische Verwertung gehen muss.
Bei den turnusmäßigen Neuwahlen gab es wenig Veränderungen in der Vorstandschaft der WBV Bayreuth. Vorsitzender bleibt Hans Schirmer, 2. Vorsitzender der BBV-Kreisobmann Karl Lappe, dritter Vorsitzender und Geschäftsführer Gerhard Potzel. Stellvertretende Geschäftsführerin und Protokollführerin Anja Steinlein, Beisitzer Klaus Wunderlich. Neu gewählt wurden die weiteren beiden Beisitzer: Jonas Hartmann aus Bernreuth und Julian Hammon aus Weidenberg.
Bild: Der neue und alte Vorsitzende der WBV Bayreuth Hans Schirmer (rechts) überreichte dem Referenten Michael Schmidt, dem Leiter des zuständigen Amtes für Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg einen Korb voller landwirtschaftlicher Produkte als Präsent.
Wie das Schnitzel auf den Teller kommt / Schule auf dem Bauernhof: Landfrauen wollen verstärkt für Projektwochen werben
 Bayreuth.
Wo kommt eigentlich das Fleisch auf dem Burger her?
Wie ist das mit der Milch? Was ist eine
Biogasanlage? Auf all diese Fragen haben Landwirte
Antworten. Deshalb wollen sie sich verstärkt
einbringen, wenn es gilt, Schülern
Alltagskompetenzen zu vermitteln. Die Umsetzung des
Projektes „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“
ist deshalb meist in Form einer Projektwoche an
allen staatlichen Schulen verpflichtend. So richtig
funktioniert das allerdings noch nicht. Zum einen
gibt es zu wenige landwirtschaftliche Betriebe im
Landkreis, die dabei mitmachen. Zum anderen scheuen
viele Schulen den Besuch auf einem Bauernhof.
Bayreuth.
Wo kommt eigentlich das Fleisch auf dem Burger her?
Wie ist das mit der Milch? Was ist eine
Biogasanlage? Auf all diese Fragen haben Landwirte
Antworten. Deshalb wollen sie sich verstärkt
einbringen, wenn es gilt, Schülern
Alltagskompetenzen zu vermitteln. Die Umsetzung des
Projektes „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“
ist deshalb meist in Form einer Projektwoche an
allen staatlichen Schulen verpflichtend. So richtig
funktioniert das allerdings noch nicht. Zum einen
gibt es zu wenige landwirtschaftliche Betriebe im
Landkreis, die dabei mitmachen. Zum anderen scheuen
viele Schulen den Besuch auf einem Bauernhof.
Auf Vermittlung der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer trafen sich deshalb Vertreter der Landfrauen mit Martin Richter vom Staatlichen Schulamt im Landkreis, um Wege zu finden, damit die Landwirtschaft bei den Alltagskompetenzen wieder eine Rolle spielt. Das sei auch dringend notwendig, sagte Kreisbäuerin Angelika Seyferth. Große Teile der Gesellschaft hätten den Bezug zur Landwirtschaft komplett verloren. „Wir müssen bei den Kindern ansetzen, um zu vermitteln, wo die Milch und das Schnitzel herkommen“, sagte sie. Die Projektwochen kämen nicht so recht in die Gänge, weil sich die Akteure offensichtlich nicht finden, so Gudrun Brendel-Fischer. Hier gebe es Optimierungsbedarf.
Ursprüngliches Ziel der Landfrauen sei ein eigenes Schulfach „Alltagskompetenzen“ gewesen, erinnerte Kreisbäuerin Angelika Seyferth. Doch auch mit den Projektwochen könne man Kinder und Jugendliche erreichen. Ihrer Ansicht nach wäre es optimal, wenn sowohl dritte, als auch siebte Jahrgangsstufen jeweils einen Tag auf einem Bauernhof verbringen würden und das Erlebte tags darauf nacharbeiten könnten. Immerhin gebe es bereits an die zehn Betriebe im Landkreis Bayreuth, die daran teilnehmen.
Von den Schulen im Raum Bayreuth nannte sie konkret die Gesamtschule Hollfeld, die Johannes Kepler-Realschule und das Richard-Wagner-Gymnasium, beide in Bayreuth. Bei diesen Schulen gebe es bereits erfolgreiche Ansätze für eine Zusammenarbeit. Bei vielen anderen Schulen scheitere die Projektwoche auf dem Bauernhof zum einen am Lehrermangel, zum anderen am Unterrichtsausfall in der Folge von Corona. Viele Schulen würden sich für die Projektwochen gegen die Landwirtschaft entscheiden und beispielsweise mit dem Bayerischen Roten Kreuz zusammenarbeiten.
Die Landwirtschaft stehe dabei in einem gewissen Konkurrenzverhältnis, gab Schulrat Martin Richter zu bedenken. Gerade wenn die Schüler in höheren Klassen den Inhalt der Projektwoche mit entscheiden könnten, stehe die Landwirtschaft oft nicht gerade an erster Stelle. Er empfahl den Landfrauen, gezielte Pakete auszuarbeiten und die Schulen darauf hinzuweisen.
Eine Bäuerin, die bislang nur gute Erfahrungen mit Schulklassen auf dem Bauernhof gemacht hat, ist Tanja Strobl vom Fischlhof in Heroldsreuth bei Pegnitz. Viele Schüler seien sehr interessiert gewesen, die Lehrkräfte hätten das Angebot dankbar angenommen. Gerade jetzt, wo es so viele Vorurteile gegen die Bauern gibt, sei es wichtig, die Betriebe zu öffnen und die Realität zu zeigen. Das Angebotsspektrum sei dabei riesig. Es reiche von Energie und Ernährung über Holz und Wald bis hin zu Geologie und Imkerei.
Als Ergebnis des Gesprächs vereinbarten die Beteiligten, dass sie bei einer der kommenden Schulleiter-Dienstbesprechungen spätestens zu Beginn des nächsten Schuljahres das Projekt persönlich vorstellen. Dabei solle nicht nur um die breite Themenvielfalt gehen, die ein Bauernhof für die Durchführung einer Projektwoche bietet. Auch die Kostenseite soll beleuchtet werden, um festzustellen zu können, ob eventuell eine Beteiligung eines Fördervereins notwendig ist.
Bild: Wollen mehr Schulklassen auf landwirtschaftliche Betriebe einladen: Bäuerin Tanja Strobl aus Pegnitz, die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer, Kreisbäuerin Angelika Seyferth und Bäuerin Petra Lodes aus Leups (von links).
Die Positionen der Landwirtschaft klar vertreten / Bauernverband vergab rund 100 Urkunden und Ehrenzeichen für langjährige aktive Ortsobleute – Karin Wolfrum zur Ehrenkreisbäuerin, Hermann Klug zum Ehrenkreisobmann ernannt
Saalenstein.
Fast 100 Ortsbäuerinnen und Ortsobmänner aus dem
Hofer Land hat der Bauernverband am Freitagabend in
Saalenstein für ihren teils jahrzehntelangen Einsatz
geehrt. Urkunden und Ehrennadeln gab es auch für
ausgeschiedenen Mitglieder des Kreisvorstandes, der
sich vor wenigen Monaten neu konstituiert hatte. Dem
bisherigen Kreisobmann Hermann Klug wurde außerdem
der Titel Ehrenkreisobmann verliehen, die bisherige
Kreisbäuerin Karin Wolfrum wurde zur
Ehrenkreisbäuerin ernannt.
Karin Wolfrum aus Gattendorf wurde 2002 als Nachfolgerin von Helga Schörner zur Kreisbäuerin gewählt. Bereits seit 1996 ist sie als Gemeinde- und als Kreisrätin politisch aktiv. Ihr wichtigstes Steckenpferd sei allerdings der Hofer Landfrauenchor, so Bezirksbäuerin Beate Opel. Sie überreichte Karin Wolfrum die Ernennungsurkunde. Mit dem Chor habe Karin Wolfrum viele Auslandsreisen absolviert und sei unter anderem schon in Italien, Finnland, Frankreich, Polen und Schweden aufgetreten. Landrat Oliver Bär hatte Karin Wolfrum zuvor als „extrem wortgewaltig“ beschrieben. Sie habe inhaltlich stets den Finger in die Wunde gelegt und die Positionen der Landwirtschaft klar vertreten.
Hermann Klug sei für den gesamten Verband ein stets verlässlicher Partner gewesen, sagte der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif, der Klug als Mann des Ausgleichs beschrieb, dessen Wort stets Gewicht hatte. Hermann Klug wurde 1986 zum Ortsobmann von Isaar in der Gemeinde Töpen gewählt. Von 2003 bis 2022 gehörte er dem Kreisvorstand an, von 2002 bis 2007 war er stellvertretender Kreisobmann, von 2007 bis 2022 Kreisobmann in der Nachfolge von Heinz Bauer. Er gehörte unter anderem dem „Landesfachausschuss Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien“ an, war Mitglied im Prüfungsausschuss, im Vorstand des Rinderzuchtverbandes und in der Jagdgenossenschaft.
Der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif war zuvor in seiner Rede vor allem mit den Wasserwirtschaftsämtern hart ins Gericht gegangen. Durch die Neuabgrenzung der Roten und Gelben Gebiete, die den Bauern aufgrund zahlreicher Auflagen das Wirtschaften auf den betreffenden Flächen erschweren bis praktisch unmöglich machen, würden viele Landwirte an ihre Existenzgrenzen gedrückt, sagte er. „Es geht ums Eingemachte“, so Greif. Nicht selten könnten betroffene Bauern nachweisen, dass es über Jahrzehnte hinweg leine Probleme gegeben habe, trotzdem würden sie aufgrund gemessener Werte an der nächsten Messstelle in Sippenhaft genommen. „Wir müssen mit dem Blödsinn aufräumen, der da mit uns gemacht wird, sagte der BBV-Bezirkschef. Allerdings machte er seinen Berufskollegen keine Illusion, es könne noch Jahre dauern, „bis wir aus der Show wieder raus sind“.
Landrat Oliver Bär pflichtete dem Verbandspräsidenten in Sachen Rote und gelbe Gebiete bei. Es sei rechtlich wenig haltbar, aus wenigen Daten eine Verpflichtung für viele zu machen. Absolut schwer nachvollziehbar sei es, dass daraus eine Existenzgefahr für jene Bauern herauskommt, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Bär nannte die Landwirtschaft einen absolut prägenden Faktor in der Region, die landwirtschaftlichen Betriebe stünden maßgeblich dafür, wie sich ein Dort entwickelt. Der Landrat würdigte auch die Verbundenheit der Bauern zu ihrer Heimat und bedankte sich bei allen Aktiven, die über so viele Jahre die Fahne der Landwirtschaft im Landkreis hoch gehalten hätten.
Die Personen, die am längsten als Ortsobleute in ihren Dörfern aktiv waren sind: Rainer Findeiss (Maierhof), Hannelore Klug (Isaar), Günter Martin (Wurlitz) und Erika Streitberger (Töpen). Sie alle haben 35 Jahre lang mitgewirkt. Für 40 Jahre wurden Inge Dötsch aus Schönlind und Alfred Lottes aus Fleisnitz geehrt. 50 Jahre war Herbert Michl aus Löhmar dabei und 55 Jahre Erika Munzert aus Marlesreuth. Noch aktiv ist die Ortsbäuerin Gerda Roßberg aus Kautendorf, die für 40 Jahre geehrt wurde. Alle anderen Ehrungen erfolgten für 15, 20, 25 und 30 Jahre aktive Mitgliedschaft. Eine besondere Ehrung gab es für die ausgeschiedenen Kreisvorstandsmitglieder Roland Kießling, Uli Köppel, Irene Puchta-Döhler, Christina Martin-Kleiner, Christine Hohberger-Puff, Rainer Horn, Klaus-Dieter Bäger und Reinhard Köhler.
Bild: Hohe Ehrung: Karin Wolfrum wurde zur Ehrenkreisbäuerin und Hermann Klug zum Ehrenkreisobmann ernannt (von links): BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif, stellvertretender Kreisobmann Andreas Wolfrum, Karin und Reinhard Wolfrum, Hermann und Hannelore Klug, Bezirksbäuerin Beate Opel, Kreisbäuerin Elke Browa und Landrat Oliver Bär.
„Denkfabrik für die Gesellschaft“ / BBV-Präsident Felßner fordert neues Selbstverständnis für den Bauernstand
.jpg) Hirschaid.
„Umparken im Kopf“, das fordert der neue
BBV-Präsident Günther Felßner von seinen
Berufskollegen. Dem Verband will er dabei ein völlig
neues Selbstverständnis geben: „Wir sind nicht nur
für die zwei Prozent der Bevölkerung, also für die
Landwirte, da, wir haben vielmehr Zukunftslösungen
für alle Menschen, also für 100 Prozent“, sagt
Felßner bei der Bezirksversammlung des
oberfränkischen Bauernverbandes in Hirschaid.
Hirschaid.
„Umparken im Kopf“, das fordert der neue
BBV-Präsident Günther Felßner von seinen
Berufskollegen. Dem Verband will er dabei ein völlig
neues Selbstverständnis geben: „Wir sind nicht nur
für die zwei Prozent der Bevölkerung, also für die
Landwirte, da, wir haben vielmehr Zukunftslösungen
für alle Menschen, also für 100 Prozent“, sagt
Felßner bei der Bezirksversammlung des
oberfränkischen Bauernverbandes in Hirschaid.
Die Bauern müssten nicht zurück in die Mitte der Gesellschaft, wie es oft zu hören sei, die Bauern sind die Mitte der Gesellschaft. Was vom Rand kommt seien die Angriffe, etwa durch Tierrechtsaktivisten, die mit fragwürdigen Methoden arbeiteten und beispielsweise in Ställe einbrechen. „Wir liefern die Ideen für die Bevölkerung, wir sind die Denkfabrik der Gesellschaft, wir sind Anpacker“, machte er den Landwirten Mut. Man dürfe die gesellschaftliche Diskussion nicht denen überlassen, die sich auf der Straße ankleben und dann nach Thailand fliegen, so Felßner.
Ob Essen oder Energie, die Landwirtschaft habe für alles die Lösung. Deshalb würden die Bauern in Zukunft noch wichtiger, als in der Vergangenheit. Zumal sich die Weltbevölkerung innerhalb einer Generation verdopple, während der Flächenverbrauch immer mehr zunehme. Mehr Menschen und weniger Fläche: das könne so nicht weitergehen. Deshalb müsse der Verband weg von der reinen Lobbyarbeit und stattdessen neue Ideen entwickeln, die für alle Menschen von Bedeutung sind. „Raus aus der Opferhaltung und selbstbewusst auftreten, das muss unsere knallharte Strategie sein“, so Felßner.
Die Frage, ob es sinnvoll sei, Fleisch zu essen, beantwortete der BBV-Präsident mit einem klaren ja. Die gesamte Wissenschaft komme zu dem Ergebnis, das eine vielfältige und abwechslungsreiche Ernährung die beste Ernährung ist. Damit gehörten tierische Produkte unabdingbar dazu. Felßner räumte dabei auch mit dem Märchen auf, dass Fleisch und Milch dem Klima schade. Man könne doch eine Kuh nicht wie ein Auto mit Auspuff betrachten. Vielmehr sei der landwirtschaftliche Produktionsprozess CO-2-Neutral.
.jpg) Zuvor
hatte BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif Kritik an
der Politik geübt. Ob Pflanzenschutzreduktion oder
zweifelhafte Aussagen zum nachwachsenden Rohstoff
Holz: „Man fragt sich schon, was sich Politik und
Behörden so ausdenken“, sagte Greif. So gehe es
nicht weiter, für die konventionelle Landwirtschaft
sei die derzeitige Situation ohnehin schon ein
halber Todesstoß.
Zuvor
hatte BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif Kritik an
der Politik geübt. Ob Pflanzenschutzreduktion oder
zweifelhafte Aussagen zum nachwachsenden Rohstoff
Holz: „Man fragt sich schon, was sich Politik und
Behörden so ausdenken“, sagte Greif. So gehe es
nicht weiter, für die konventionelle Landwirtschaft
sei die derzeitige Situation ohnehin schon ein
halber Todesstoß.
Bei der Neuabgrenzung der Roten und Gelben Gebiete, die den Bauern aufgrund zahlreicher Auflagen das Wirtschaften auf den betreffenden Flächen erschweren bis praktisch unmöglich machen, ging Greif mit den Wasserwirtschaftsämtern hart ins Gericht. „Wir kämpfen an allen Fronten dagegen“, sagte er. De Erklärungen des Wasserwirtschaftsamtes nannte er mitunter stümperhaft. „Da wird manchmal ein wenig Augenwischerei betrieben“, so Greif. Neben dem Flächenverbrauch stelle die Neuausweisung der Roten und Gelben Gebiete auch das größte Problem in den Landkreisen dar. Mehrere Kreisobmänner berichteten davon, dass die Wasserwirtschaftsämter gar nicht mit sich reden lassen, sondern den Bauern gleich empfehlen, den Klageweg zu beschreiten.
Bei der Bezirksversammlung wurde die langjährige Kreis-, Bezirks- und Landesbäuerin Anneliese Göller aus Wingersdorf im Landkreis Bamberg zur Ehrenbezirksbäuerin ernannt. Urkunden erhielten auch die ausgeschiedenen Kreisobleute Edgar Böhmer (Bamberg), Heidi Bauersachs (Coburg), Rosi Kraus (Forchheim), Karin Wolfrum (Hof), Rosa Zehnter (Kronach), Wilfried Löwinger (Kulmbach) und Bezirksvorstandsmitglied Peter Schlund (Bamberg).
Bilder:
1. BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif,
Bezirksbäuerin Beate Opel (von links) sowie
BBV-Direktor Wilhelm Böhmer und BBV-Präsident
Günther Felßner (von rechts) haben Anneliese Göller
zur Ehrenbezirksbäuerin ernannt.
2.
Ehrung für ausgeschiedene Kreisobmänner und
Kreisbäuerinnen beim BBV Oberfranken (von links):
Peter Schlund, Wilfried Löwinger, Rosa Zehnter,
BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif, Karin Wolfrum,
BBV-Präsident Günther Felßner, Edgar Böhmer, Rosi
Kraus, Heidi Bauersachs, Bezirksbäuerin Beate Opel
und BBV-Direktor Wilhelm Böhmer.
Ökofranken sind pleite / Insolvenz des „Vermarktungszusammenschlusses für ökologisch-regionalen Landbau eG“
Itzgrund. Der Vermarktungszusammenschluss für ökologisch-regionalen Landbau (Ökofranken) mit Sitz in Welsberg, Gemeinde Itzgrund im Landkreis Coburg ist insolvent. Das geht aus einem Schreiben von Rechtsanwalt Gunther Neef von der Kanzlei Schwarzrecht in Hof an ein Ökofranken-Mitglied hervor, das der Redaktion vorliegt. Rechtsanwalt Neef wurde vom Insolvenzgericht Coburg zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. In dem Schreiben macht der Anwalt Forderungen der Insolvenzschuldnerin gegenüber dem Mitglied in mittlerer fünfstelliger Höhe geltend, die binnen zwei Wochen zu begleichen seien.
Das Mitglied, ein Ökolandwirt aus dem Fränkischen, geht fest davon aus, dass die Rückforderungen keine Grundlage haben. Er habe schon lange mit der Insolvenz gerechnet, so der Landwirt. Eigentlich seien die Ökofranken schon vor zwei Jahren erledigt gewesen. „Die hätten schon viel früher Insolvenz anmelden müssen.“ Er habe mittlerweile einen Fachanwalt eingeschaltet, der auch zahlreiche andere Mitglieder vertritt. Die Ökofranken eG müsste nachweisen, dass die Forderungen rechtens sein, was zum größten Teil wohl nicht der Fall ist. Bestätigt sieht sich das Mitglied dadurch, dass ein Gericht vor einiger Zeit die Rückforderungsklage der Ökofranken gegen einen Mitgliedsbetrieb bereits abgewiesen hatte.
Dem Vernehmen nach stehen insgesamt Forderungen in Höhe von rund zwei Millionen Euro im Raum. Wenn Vorstand und Geschäftsführung kein persönliches Verschulden nachzuweisen ist, bleiben die Mitglieder in jedem Fall auf ihren Einlagen sitzen.
Die Erzeugergemeinschaft Ökofranken war bereits in der Vergangenheit immer wieder Vorwürfen des Missmanagements ausgesetzt. Das System hätte so funktionieren sollen, dass die beteiligten Landwirte in einem Vermarktungspool einliefern und entsprechend ihren Lieferungen zunächst Abschlagszahlungen abzüglich der Kosten für Transport und Reinigung bekommen. Je nachdem, wie vermarktet werden konnte, bekamen die Landwirte danach eine Abschlusszahlung. Dabei konnte es allerdings auch passieren, dass die Abschlagszahlungen höher waren als die späteren Vermarktungsergebnisse. In diesen Fällen wurden Gelder aus den Abschlagszahlungen zurückgefordert. Das hatte bei den Betroffenen für erheblichen Ärger gesorgt. Die Verantwortlichen sahen das Hauptproblem darin, dass die Andienungspflicht nicht konsequent umgesetzt wurde. Allerdings wurden auch die Vermarktungspools 2017 und 2018 erst verspätet aufgelöst, wodurch die Ertragssituation nicht besser, sondern schlechter wurde.
Vorstand Roland Schrenker, Landwirt aus Treppendorf bei Hollfeld im Landkreis Bayreuth, hatte noch vor gut einem Jahr gegenüber dem Wochenblatt bestätigt, dass rund 120 von den insgesamt 300 Mitgliedern der Gemeinschaft zusammen rund 900000 Euro Rückzahlungen leisten sollten. Die Mitglieder zweifelten allerdings schon damals an, ob die Rückforderungen rechtens und nicht teilweise längst verjährt sind. Konkret sollten Mitglieder, die zwischen 2017 und 2020 nicht geliefert hatten pro zehn Hektar Fläche, für die sie gezeichnet haben, mit 1500 Euro pro Hektar und Jahr zur Kasse gebeten werden. Die Ordnungsgelder sollen nach Ansicht von Mitgliedern allerdings schon damals eher dazu dienen, eine Insolvenz abzuwenden. „Eine Insolvenz steht im Raum, wenn es hart auf hart kommt, wird sie unvermeidbar sein“, sagte ziemlich genau vor einem Jahr ein Landwirt gegenüber dem Wochenblatt. Nun ist die Insolvenz also Realität geworden.
Damals wie heute sieht der Landwirt, dessen Name der Redaktion bekannt ist, das Problem hauptsächlich in der Person des Geschäftsführers, der von Anfang an nicht in der Lage gewesen sei, seine Aufgaben satzungsgemäß durchzuführen. „Da sind Geschäfte getätigt worden, bei denen nichts verdient wurde“, sagt der Landwirt. Vermutlich sei sogar Vertragsware teuer zugekauft worden, um Lieferverträge zu erfüllen.
Die Ökofranken eG. ist ein Zusammenschluss mit rund 300 Mitgliedern für ökologisch erzeugte landwirtschaftliche Produkte nach diversen Ökostandards. Die Genossenschaft beschäftigte einen hauptamtlichen Geschäftsführer und einen Mitarbeiter für Büro und Lager.
Torsten Gunselmann vom BBV Oberfranken bedauert die Eröffnung des Insolvenzverfahrens. „Wir sind prinzipiell sehr daran interessiert, dass Landwirte ihre Produkte bündeln können“, so Gunselmann, der auch Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps in Oberfranken ist. Gerade der Ökolandbau sei auf diese Bündler angewiesen. Da sei die Ökofranken eG schon ein wichtiger Partner gewesen. Er hoffe nun sehr, dass anderen Erzeugergemeinschaften nicht auch das Vertrauen entzogen werde, „nur weil eine Gruppe weniger Akteure offensichtlich handwerkliche Fehler gemacht hat“. Gerade die Erzeugergemeinschaften seien ein wichtiger Baustein.
Vorstand Roland Schrenker teilte mit, dass er keine Stellung nehmen könne, bestätigte jedoch, dass ein Beschluss des Amtsgerichts Coburg vorliege. Über den Inhalt wollte er zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft geben. Insolvenzverwalter Gunther Neef hatte bis zum Redaktionsschluss nicht auf eine entsprechende Anfrage geantwortet.
Abenteuer Afrika: Ein Beruf – Zwei Welten / Erfolgreiches Partnerschaftstreffen mit Landfrauen aus Kenia – Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel in Afrika: „Wollen Hilfe zur Selbsthilfe geben“
.jpg)
Kulmbach. „Dort lebt man viel entspannter, da könnte man sich schon mal eine Scheibe abschneiden“, sagt Beate Opel. Die Kulmbacher Kreisbäuerin und oberfränkische Bezirksbäuerin ist vor wenigen Tagen aus Afrika zurückgekommen. Mit einer achtköpfigen Delegation bayerischer Landfrauen hatte sie im Rahmen eines ehrgeizigen Austauschprojektes in einigen Gemeinden im Westen Kenias Berufskolleginnen besucht. Das Ganze soll keine Einbahnstraße sein: „Wir wollen unser Wissen weitergeben und dabei selbst auch etwas lernen“, so Beate Opel.
Das Projekt „Internationale Zusammenarbeit“ der bayerischen Landfrauen, das bereits seit einigen Jahren läuft, soll vor allem Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Es gebe bereits einen Interessensverband für kenianische Landfrauen, in dem junge Frauen grundlegende Kenntnisse erwerben können. Ziel sei es, ein nachhaltiges Einkommen zu generieren und damit die Lebensverhältnisse vor Ort zu verbessern.
Für Beate Opel war es vor allem ein Blick über den Tellerrand. Auch dort finde Landwirtschaft statt, allerdings in anderen Verhältnissen, aber sehr vielseitig aufgestellt. Die am häufigsten angebaute Frucht sei der Reis. Aber zum Beispiel auch Bananen spielten eine große Rolle. Ansonsten gebe es Ackerbau, Milchvieh und Geflügel. „Wir haben zwar den gleichen Beruf, leben aber in zwei Welten“, sagt die Kreis- und Bezirksbäuerin, für die es die erste Reise nach Afrika war. Mit dabei waren diesmal unter anderem die neue Landesbäuerin Christine Singer aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen, deren beide Stellvertreterinnen Christine Reitelshöfer aus Mittelfranken und Christiane Ade aus Schwaben sowie Projektleiterin Angelika Eberl von der Gesellschaft „BBV Landfrauen Internationale Zusammenarbeit“.
.jpg)
Seit 2017 bemühen sich Landfrauen in Bayern darum, die Lebensverhältnisse ihrer Berufskolleginnen in West-Kenia durch die Förderung neuer Erkenntnisse und das Anstoßen von Innovationen zu verbessern. Das Projekt findet unter dem Dach einer Sonderinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung statt und wird von dort auch gefördert und finanziert. Grundgedanke ist es, die Ausbildungsmöglichkeiten zu fördern und damit auch zur Gleichstellung von Frauen innerhalb der Familien und der Gesellschaft beizutragen.
Kritischen Stimmen des Afrika-Engagements bayerischer Landfrauen hält Beate Opel entgegen, dass es doch nichts schlechtes sein kann, sein Wissen an andere weiterzugeben. „Auch wir können von den afrikanischen Bäuerinnen lernen, wenn es beispielsweise darum geht, unsere Ansprüche ein wenig zurückzuschrauben.“ Ein Ziel sei durch das Projekt bereits erreicht worden: In West-Kenia, genauer in Siaya, Kakamega und Bungoma gibt es bereits einen Landfrauenverband, die „Woman Farmers Assoziation of Kenya“. Er organisiert Weiterbildungen und veranstaltet sogar einen eigenen Landfrauentag, bei dem sich die Bäuerinnen untereinander austauschen können. „Wenn sie erfolgreich sein wollen, müssen sie sich vernetzen, ehrenamtlich engagieren, untereinander austauschen und den Kontakt zur Politik suchen“, das legten die bayerischen Landfrauen ihren kenianischen Kolleginnen ganz besonders ans Herz.
.jpg) Sprachliche
Probleme habe es nicht gegeben: Mit ein wenig
englisch komme man gut durch, außerdem war ein
Dolmetscher immer dabei. „Man versteht sich auch so,
schließlich sind wir durch die Landwirtschaft eng
miteinander verbunden.“ Um sich gegenseitig besser
kennen zu lernen, haben die Bayerischen Bäuerinnen
Fotos ihrer Familien und ihrer Betriebe mitgebracht.
So könnten auch die afrikanischen Landfrauen sehen,
wie hierzulande gelebt und gewirtschaftet wird. Was
die Kreis- und Bezirksbäuerin besonders schätzt: die
außergewöhnliche Gastfreundschaft. Bei sämtlichen
Zusammenkünften sei gesungen, getanzt und auch
gebetet worden. Überhaupt sei es ein beeindruckendes
Land, so die Kreis- und Bezirksbäuerin.
Sprachliche
Probleme habe es nicht gegeben: Mit ein wenig
englisch komme man gut durch, außerdem war ein
Dolmetscher immer dabei. „Man versteht sich auch so,
schließlich sind wir durch die Landwirtschaft eng
miteinander verbunden.“ Um sich gegenseitig besser
kennen zu lernen, haben die Bayerischen Bäuerinnen
Fotos ihrer Familien und ihrer Betriebe mitgebracht.
So könnten auch die afrikanischen Landfrauen sehen,
wie hierzulande gelebt und gewirtschaftet wird. Was
die Kreis- und Bezirksbäuerin besonders schätzt: die
außergewöhnliche Gastfreundschaft. Bei sämtlichen
Zusammenkünften sei gesungen, getanzt und auch
gebetet worden. Überhaupt sei es ein beeindruckendes
Land, so die Kreis- und Bezirksbäuerin.
Damit das Projekt nicht zur Einbahnstraße wird, waren vor Corona auch acht Bäuerinnen aus Afrika zu Gast auf bayerischen Höfen, konnten hier mitarbeiten und wertvolle Erfahrungen sammeln. Sie sollen in ihrer Heimat als Multiplikatoren wirken und ihre erworbenen Kenntnisse an die Bäuerinnen zuhause weitergeben. Das Projekt habe gute Chancen, fortgesetzt zu werden. Auch diesmal werde es wohl wieder einen Gegenbesuch geben, zeigt sich Beate Opel optimistisch.
Bilder:
1. Auf
einer Farm trafen sich die bayerischen Landfrauen
mit Berufskolleginnen aus Kenia. Mit dabei war auch
die Kulmbacher Kreis- und oberfränkische
Bezirksbäuerin Beate Opel (7. von rechts).
2. Gruppenbild der Vorstandschaften der Counties
Kakamega, Siaya und Mongoma mit der bayerischen
Landfrauendelegation, darunter Kreis- und
Bezirksbäuerin Beate Opel (sitzend links).
3. Das Leben spielt sich auf der Straße ab: Die
Bananenverkäuferin trafen die bayerischen Landfrauen
in Kenia.
Alle Bilder: privat
Premium-Qualität aus Süddeutschland / Vertragsübergabe: Müller Grippe setzt verstärkt auf Haltungsform 3
 Bayreuth.
Für alle Beteiligten war es ein richtungsweisender
Schritt: Die Müller Gruppe setzt künftig bei Rindern
und Jungbullen verstärkt auf die Haltungsform 3.
Dazu wurden am Schlachthof in Bayreuth die
entsprechenden Verträge zwischen Erzeuger, Bündlern
und Vermarktern offiziell übergeben. „Damit setzen
wir künftig auf Premium-Qualität“, sagte Martin
Müller, Geschäftsführer der Müller Fleisch GmbH,
eines der führenden deutschen Unternehmen der
Fleischwirtschaft. Das produzierte Fleisch wird
künftig unter dem Label „Müller´s Landrind ***“
vermarktet.
Bayreuth.
Für alle Beteiligten war es ein richtungsweisender
Schritt: Die Müller Gruppe setzt künftig bei Rindern
und Jungbullen verstärkt auf die Haltungsform 3.
Dazu wurden am Schlachthof in Bayreuth die
entsprechenden Verträge zwischen Erzeuger, Bündlern
und Vermarktern offiziell übergeben. „Damit setzen
wir künftig auf Premium-Qualität“, sagte Martin
Müller, Geschäftsführer der Müller Fleisch GmbH,
eines der führenden deutschen Unternehmen der
Fleischwirtschaft. Das produzierte Fleisch wird
künftig unter dem Label „Müller´s Landrind ***“
vermarktet.
Die Müller Gruppe habe sich schon seit langem zur Initiative Tierwohl bekannt, sagte der Geschäftsführer. Die aktuellen Vertragsbindungen gelten für die drei Standorte Birkenfeld bei Pforzheim, Ulm und Bayreuth. Die nun unter Vertrag stehenden landwirtschaftlichen Betriebe seien durch die Gesellschaft für Qualitätssicherung in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft (QAL) in Vierkirchen auditiert.
Mit der Vertragsbindung honoriere die Müller Gruppe den zusätzlichen Aufwand der Landwirte für die Modifikation der betrieblichen Rahmenbedingungen an die Haltungsform 3. Dazu gehörten unter anderem ein größeres Platzangebot, ein Laufstall, das Angebot von Außenklimareizen und die Fütterung ohne gentechnisch veränderte Organismen. Zusätzlich seien Qualitätsmerkmale wie Alter, Gewicht, Handelsklassen und Rassen bei den Mastbullen vorgegeben. Nach den Worten von Martin Müller sind bereits 50 Landwirtschaftliche Betriebe, im Wesentlichen aus Bayern und Baden Württemberg mit dabei. Sie lieferten in einem ersten Schritt jährlich mehr als 8000 Mastbullen. Sämtliche Verträge hätten eine Laufzeit von ein bis zwei Jahren.
Die Belieferung erfolge bereits seit Jahresbeginn. Der Müller Gruppe und den Partnern lägen bereits zahlreiche positive Rückmeldungen vom Handel in Süddeutschland vor. Parallel dazu würden die bereits seit längerem laufenden Jungbullenverträge der Haltungsform 2 beibehalten. Sie hätten nach wie vor ihre Berechtigung am Markt. Gleichzeitig arbeite die Müller Gruppe an einer Vermarktungsstrategie bei der auch weibliche Rinder der Haltungsform 3 einer besseren Wertschöpfung zugeführt werden.
„Wir wollen mit diesem Schritt darstellen, dass das Ganze in Bewegung ist“, sagte Geschäftsführer Sebastian Brandmeier von der Viehvermarktungsgenossenschaft Oberbayern-Schwaben. Er sprach von einer für die Zukunft wegweisenden Entscheidung. Wichtig sei auch, dass den Betrieben mit den Verträgen eine Perspektive gegeben wird. Josef Ebert von der Viehzentrale Südwest sah einen positiven Impuls, „dass in der Landwirtschaft etwas vorwärts geht“. Nun müsse man sehen, was der Markt hergibt.
Zur Müller Gruppe gehören die Unternehmen Müller Fleisch, Bayreuther Fleisch, Ulmer Fleisch, Ingolstädter Fleisch sowie Süddeutsches Schweinefleischzentrum.
Bild: Die Geschäftsführer Sebastian Brandmeier von der Viehvermarktungsgenossenschaft Oberbayern-Schwaben, Martin Müller von der Müller Fleisch GmbH, Josef Ebert von der Viehzentrale Südwest und Stefan Rossmann von der Ulmer Fleisch GmbH (von rechts) bei der Übergabe der Dreiecksverträge zwischen Erzeugern, Bündlern und Vermarktern im Bayreuther Schlachthof.
Bauern fordern Mehr Toleranz und Wertschätzung / Landwirtschaft in der Region klagt über hohe Belastungen durch überzogene Forderungen
Hof. Umweltvergifter, Luftverpester, Tierquäler: Bauern sehen sich vielen Vorwürfen ausgesetzt. Kaum eine Branche steht so im Kreuzfeuer der Kritik, wie die Landwirtschaft. Doch stimmen die Vorwürfe wirklich? In einigen wenigen Fällen mag dies zutreffen. Der weitaus größte Teil der Betriebe steht genau für das Gegenteil. Denn viele Landwirte in Bayern und auch im Hofer Land haben pfiffige und auch nachhaltige Ideen. Sie setzen auf Klimaschutz und Tierwohl, doch Politik und Gesellschaft stellen dennoch ständig neue Forderungen. Wie gehen sie damit um?
Auch Landwirte haben Forderungen an die Gesellschaft. „Die Bauern fordern vor allem Respekt und Vertrauen. Wir haben bestmöglich ausgebildete Landwirte, die jeden Tag unter Beweis stellen, was sie können“, sagt Thomas Lippert, Geschäftsführer des Bauernverbandes Hof/Wunsiedel. Allerdings sei die Halbwertszeit politischer Ziele mit der Lebenswirklichkeit der Landwirte nicht vereinbar. Richtungsänderung könnten Landwirte erst mitgehen, wenn Investitionen auch abbezahlt sind.
„Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit schließen sich im Moment schon aus“, meint Lippert und macht dies am Beispiel der Tierhaltung fest: Sie sei die beste Alternative, um Grünland zu verwerten, wirtschaftlich sei das derzeit nicht immer. Ganz konkret nennt der BBV-Geschäftsführer eine Pflichtstillegung von Ackerland mit dem Flächenfrass nicht vereinbar. Als große Herausforderungen für die Landwirtschaft bezeichnet Lippert derzeit die Roten Gebiete in der Düngeverordnung und den Bau des Süd-Ost-Links.
„Wer fordert muss auch handeln“, sagt Andreas Wolfrum, stellvertretender BBV-Kreisobmann aus Döberlitz. „Möchte ich beispielsweise ausschließlich regionale Produkte, dann sollte ich auch nur diese kaufen. Denn damit unterstütze ich die heimische Landwirtschaft am meisten.“ Lose Forderungen an Landwirte stellen und letztlich an der Ladenkasse doch wieder das billigste Produkt kaufen, das helfe niemandem. Leider entscheide die Regierung derzeit über die Köpfe der Bauern hinweg, so Wolfrum. Das beste Beispiel dafür sei die neue Ausweisung der Roten Gebiete. „Hier wurde wieder an jeder Realität vorbei entschieden und keine Praktiker mit ins Boot geholt um von Region zu Region Lösungen zu erarbeiten“ Wolfrum zufolge schließen sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht aus. Im Gegenteil: sie gingen auf landwirtschaftlichen Familienbetrieben oft Hand in Hand. Leider brächten politische Entscheidungen dies oft ins Ungleichgewicht. „Wir arbeiten in Generationen, entwickeln und stets weiter. Das wird leider oft verkannt.“
Gerade die neue Agrarreform aus Brüssel werde dazu führen das innerhalb Europas besonders in Deutschland immer weniger Lebensmittel angebaut werden können. Es werde auf bestem Ackerland extensiviert. Oft reichten die Qualitäten des Getreides dann maximal noch als Tierfutter. Wolfrum: „Lebensmittel kommen dann zukünftig aus Südamerika. Die Umweltstandards dort? Fehlanzeige- es gibt keine! Wollen wir das?“ Für Wolfrum das größte Problem: die Bürokratie. „Ich will Landwirt sein, mich um meine Tiere kümmern. Meiner Felder und Wiesen nach bestem Wissen bewirtschaften. Aber bis ich das darf muss ich erst mal Monate lang Anträge stellen, Kontrollen vorbereiten und abarbeiten, Programme mit Düngermengen füllen, weiterbilden und so weiter.“
Für den Nebenerwerbslandwirt Matthias Knöchel aus Konradsreuth ist es die grundsätzliche Frage, ob ein gegenseitiges Fordern von Bauern und Gesellschaft zielführend ist, oder man nicht doch miteinander gemeinsam eine Richtung in gewissen Thematiken einschlagen sollte. Erfreulich wäre es, wenn die Gesellschaft nicht immer direkt die Landwirte verurteilt. Ein Wechsel des Blickwinkels, Aussagen hinterfragen und nicht direkt jede Meldung glauben und Mitläufer, beziehungsweise Stimmungsmacher sein, wäre ein guter Anfang, sagt Knöchel.
Gefühlt wisse jeder besser Bescheid als die vom Staat ausgebildeten Landwirte. „Aber niemand traut sich zu fragen warum und wieso machst du das so wie es gemacht wird.“ Viele Meldungen beruhten nun mal leider nicht mehr auf einer neutralen Berichterstattung und schadeten damit auch in großen Maßen dem Image. Auf im eigenen Land erzeugte Produkte sollte mehr Wert gelegt werden, zumal diese Branche auch Wirtschaftsmotor in jeder Region ist und das Geld vor Ort bleibt.
Die Regierung sei primär wegweisend durch Gesetze, Maßnahmen und Förderung. Verbände und Zusammenschlüsse arbeiteten konstruktiv mit, dass umsetzbare Lösungsansätze entstehen. Jedoch fruchte dies nicht immer und bei einem Wechsel der Regierung seien plötzlich ganz andere Themen wieder wichtig und das bisher gelernte komplett hinfällig. Knöchel: Die Landwirtschaft ist so vielfältig, schnelllebig und komplex wie nie: Boden, Natur, Technik, Niederschlag.“ Selbst innerhalb eines Landkreises gebe es oft starke Unterschiede. Die Entscheidungskraft und Ermessensspielraum sollte wieder etwas weiter in Richtung der Landwirtschaftsämter vor Ort gerückt Was man oft hört, dass die Förderung ein „Bonus“ für gute Landwirte sei, so ist dem nicht. Ohne Förderung ist die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit nicht gegeben.
Auch Knöchel meint, dass man gleichzeitig nachhaltig und auch wirtschaftlich produzieren und arbeiten könne. Die Frage sei aber doch, in welchem Rahmen man das betrachtet. Bei globalen Märkten habe man schlichtweg keine Chance, wenn man die höchsten Qualitäts-, Umwelt- und Tierwohlstandards und Mindestlohn hat. Dann sei das ausländische Produkt mit Transport unterm Strich einfach billiger. Hier sei man schlichtweg nicht auf einem Nenner, „Äpfel und Birnen kann man nicht vergleichen.“
Knöchel gibt auch zu bedenken, dass der Landwirt nicht mit einer 40-Stunden-Woche rechnet, sondern das macht, was gemacht werden muss. Defizite würden durch mehr Arbeit ausgeglichen, mit einem zweiten Standbein oder einfach damit, dass man in ein Anstellungsverhältnis geht und der Betrieb so nicht weitergeführt wird. Außerdem sei die Bürokratie mittlerweile nicht praktikabel. Der Landwirt spricht von „Unmengen an Meldungen und Dokumentation, teilweise mit Sinn oder nicht“. Auch hier gelte wieder, wer bezahlt die Mehrarbeit?
In erster Linie fordert Knöchel von der Bevölkerung mehr Toleranz und Wertschätzung. „Wir haben Greening und Cross Compliance erfüllt, das Volksbegehren „Rettet die Bienen“, Gewässerschutzstreifen angelegt, überall Schutzgebiete, Verbote und Einschränkungen bei der Düngung und so weiter. Regelmäßig stellen wir uns neu auf. „Im Privatgarten aber darf gemacht werden, was man will. In der Industrie sieht man hinter der schönen Glasfassade nicht was passiert. Eine Entschärfung im Ton mancher Leute wäre einfach für das Gemüt gut.
„Mit Herz und Hand smart fürs Land“ / Landwirtschaftlicher Berufswettbewerb auf Kreisebene gestartet
 Bayreuth.
Sie sind aktuell die besten Junglandwirte aus den
Landkreisen Bayreuth und Kulmbach: Alexander Gahn
aus Burgkunstadt, der seine Ausbildung auf dem
Betrieb von Gerhard Reif in Gössmannsreuth macht,
Luca Eckert aus Waischenfeld und Nicolas Trapper aus
Peesten. Sie landeten beim landwirtschaftlichen
Berufswettbewerb auf Kreisebene auf den ersten drei
Plätzen. Nachdem sich die ersten sieben von
insgesamt 45 Teilnehmern für den Bezirksentscheid
qualifizierten, dürfen sich auch Rene Hampel aus
Neuenmarkt (4. Platz), Alexandra Winkler aus
Großhaberdorf (5. Platz), Lucas Hirschmann aus
Thurnau (6. Platz) und Alina Sendelbeck aus
Gottsfeld bei Creußen (7. Platz) über ihr
erfolgreiches Abschneiden beim Berufswettbewerb
freuen.
Bayreuth.
Sie sind aktuell die besten Junglandwirte aus den
Landkreisen Bayreuth und Kulmbach: Alexander Gahn
aus Burgkunstadt, der seine Ausbildung auf dem
Betrieb von Gerhard Reif in Gössmannsreuth macht,
Luca Eckert aus Waischenfeld und Nicolas Trapper aus
Peesten. Sie landeten beim landwirtschaftlichen
Berufswettbewerb auf Kreisebene auf den ersten drei
Plätzen. Nachdem sich die ersten sieben von
insgesamt 45 Teilnehmern für den Bezirksentscheid
qualifizierten, dürfen sich auch Rene Hampel aus
Neuenmarkt (4. Platz), Alexandra Winkler aus
Großhaberdorf (5. Platz), Lucas Hirschmann aus
Thurnau (6. Platz) und Alina Sendelbeck aus
Gottsfeld bei Creußen (7. Platz) über ihr
erfolgreiches Abschneiden beim Berufswettbewerb
freuen.
Die Wettbewerbsaufgaben zeichneten sich auch diesmal wieder durch Praxisnähe und einen starken Bezug zum beruflichen Alltag aus. Nachdem er im zweijährigen Turnus stattfindet und beim letzten Mal Corona-bedingt ausgefallen war, nahmen diesmal Absolventen des Berufsgrundschuljahres sowie des ersten und zweiten Praxisjahres daran teil.
Gefragt
waren fachliche Kenntnisse, handwerkliche
Fertigkeiten, ein gutes Allgemeinwissen, dazu
Sozialkompetenz und Redegewandtheit. Da ging es
beispielsweise um Fragen aus den Bereichen Politik,
Zeitgeschichte, Geographie und Sport. Die Teilnehmer
sollten fünf Disziplinen des
Leichtathletik-Wettkampfes benennen und mussten
wissen, welches Nicht-EU-Land an Deutschland grenzt
(die Schweiz).
Im Praxisteil sollten sich Auszubildende in der Landwirtschaft mit Futtermitteln, mit Saatgut und mit einzelnen Werkstoffen gut auskennen. Auch technisches Geschick war gefragt, etwa als es darum ging, einen Flaschenöffner aus Metall herzustellen. Außerdem lautete eine Aufgabe, den eigenen Betrieb, beziehungsweise den Lehrbetrieb in Form eines Kurzreferates vorzustellen.
Der
Berufswettbewerb der Landjugend steht diesmal unter
dem Motto „Mit Herz und Hand – smart fürs Land“.
Bundesweit nehmen daran insgesamt rund 10000,
bayernweit rund 2000 junge Nachwuchskräfte im Alter
teil und stellen ihr berufliches Wissen und
praktisches Können unter Beweis. In Bayern findet
der Wettbewerb an 45 Schulstandorten statt.
Ziel ist es, aufzuzeigen, dass die Ausbildung in einem Grünen Beruf das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft ist und Perspektiven zur Mitgestaltung eröffnet. „Wer hier sein Können unter Beweis stellt, kann nicht nur beim Berufswettbewerb punkten, sondern schafft sich auch für das spätere Berufsleben beste Grundlagen und ein berufliches Netzwerk mit Gleichgesinnten“, heißt es von Seiten des Bauernverbandes.
Im
Zuge der Corona-Lockdowns seien die Leistungen der
heimischen Landwirtschaft wieder mehr ins
öffentliche Bewusstsein gerückt, sagte der
Bayreuther Landrat Florian Wiedemann. Der Wettbewerb
soll dazu beitragen, der Öffentlichkeit vor Augen zu
führen, welche interessante und abwechslungsreiche
Berufe der Wirtschaftszweig Landwirtschaft zu bieten
habe, so Bayreuths 3. Bürgermeister Stefan Schuh.
„Der Wettbewerb ist auch ein stückweit Werbung für
unseren bäuerlichen Berufsstand“, sagte die
oberfränkische Bezirksbäuerin Beate Opel. Sie
schrieb den jungen Leuten ins Stammbuch: „Ihr seid
die Zukunft, lasst uns gemeinsam den Bauernstand
hochhalten.“
Für die besten jungen Frauen und Männer auf Kreisebene geht es am 28. März beim Bezirksentscheid weiter. Die Bezirkssieger treffen sich am 3. und 4. Mai in Weiden in der Oberpfalz zum Landesentscheid. Die Entscheidung, wer zu Deutschlands Besten in den Sparten Landwirtschaft, und Hauswirtschaft gehört, fällt vom 19. bis 23. Juni 2023 in Echem in Niedersachsen.
Bilder:
1. Eingerahmt von der Gratulanten präsentierten die
sieben Erstplatzierten ihre Urkunden. Alle sieben
nehmen Ende März am oberfränkischen Bezirksentscheid
teil.
2. - 4. Beim Landwirtschaftlichen Berufswettbewerb
war auch jede Menge technisches Geschick gefragt.
Fischotter bedroht oberfränkische Teichwirtschaft / Beutegreifer gefährden Existenz vieler Betriebe – Jahresversammlung der Teichgenossenschaft Oberfranken
.jpg) Himmelkron.
Oberfrankens Teichwirte klagen über immense Schäden
durch eine extrem angestiegene Fischotterpopulation.
„Wir können unsere Fische doch nicht als Vogelfutter
entwerten lassen“, sagte der Vorsitzende Dr. Peter
Thoma aus Thiersheim bei der Jahreshauptversammlung
der Teichgenossenschaft Oberfranken in Himmelkron.
Er hatte einen seiner Teiche eigens für die
Eröffnung der Karpfensaison im September mit rund
100 Karpfen besetzt, fünf davon hatten die
Fischotter übrig gelassen. Ein Grund dafür, dass dem
bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder damals
bei den Eröffnungsfeierlichkeiten Schweineschäufele
statt Karpfen serviert werden musste, was bayernweit
für Aufsehen gesorgt hatte.
Himmelkron.
Oberfrankens Teichwirte klagen über immense Schäden
durch eine extrem angestiegene Fischotterpopulation.
„Wir können unsere Fische doch nicht als Vogelfutter
entwerten lassen“, sagte der Vorsitzende Dr. Peter
Thoma aus Thiersheim bei der Jahreshauptversammlung
der Teichgenossenschaft Oberfranken in Himmelkron.
Er hatte einen seiner Teiche eigens für die
Eröffnung der Karpfensaison im September mit rund
100 Karpfen besetzt, fünf davon hatten die
Fischotter übrig gelassen. Ein Grund dafür, dass dem
bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder damals
bei den Eröffnungsfeierlichkeiten Schweineschäufele
statt Karpfen serviert werden musste, was bayernweit
für Aufsehen gesorgt hatte.
Notfalls müsse man seine Teiche auch mal leer lassen, schlug Thoma vor. Vielleicht könne man so der Bevölkerung klar vor Augen führen, wie wichtig eine funktionierende Teichwirtschaft ist. Wo sollten Frösche oder Insekten hin, wenn es keine Uferrandstreifen mehr gibt, sagte er. „Wir erwarten von der Regierung, dass sie reagiert, wenn Gefahr in Verzug ist“, so der oberfränkische Bauernverbandspräsident Hermann Greif. Es könne nicht angehen, dass man derartige Beutegreifer kommen und überhand nehmen lässt und erst dann etwas unternimmt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Greif: „Wenn wir das nicht endlich begreifen, dann war es das mit dem Kulturgut Teich“.
„Die Zeit drängt“, warnte auch Alexander Horn, Fischotterberater für das östliche Oberfranken und die nördliche Oberpfalz. Er ging davon aus, dass der Otter die Teichwirte noch einige Zeit im Atem halten werde. Alexander Horn wies aber auch darauf hin, dass der Fischotter kein bayerisches und auch kein deutsches, sondern ein internationales Problem ist. Deshalb bedürfe es einer internationalen Zusammenarbeit, um das Problem zu lösen.
Auch die anderen Beutegreifer seien noch nicht vom Tisch, sagte Vorsitzender Thoma. Vor allem beim Silberreiher stelle man zunehmende Populationen fest. Weniger Probleme mache dagegen im Moment der Kormoran. Einiges getan habe sich auch beim Biber. Nicht sein dürfe es allerdings, dass neue Naturschutzgebiete wie derzeit in Nassanger bei Trieb im Landkreis Lichtenfels ausgewiesen werden sollen, in denen ein generelles Jagdverbot herrscht. Im Falle der Ausweisung rechnen wird dort über kurz oder lang mit neuen Brutkolonien des Kormoran.“
.jpg) Doch
auch über die Problematik durch den Fischotter
hinaus hat es die Teichwirtschaft derzeit gerade
nicht leicht. Geschäftsführer Otto Norbert Grußka
musste berichten, dass zwei Teichbetriebe im
zurückliegenden Jahr wegen Wassermangels aufgegeben
haben. Der Wassermangel werde uns in den kommenden
Jahren noch verstärkt treffen, sagte er. „Wir
steuern dabei auf Verhältnisse zu, wie im Libanon“,
so Grußka. Ein weiterer Betrieb hatte wegen der
ebenfalls zunehmenden Starkregenereignisse einen
Totalschaden erlitten.
Doch
auch über die Problematik durch den Fischotter
hinaus hat es die Teichwirtschaft derzeit gerade
nicht leicht. Geschäftsführer Otto Norbert Grußka
musste berichten, dass zwei Teichbetriebe im
zurückliegenden Jahr wegen Wassermangels aufgegeben
haben. Der Wassermangel werde uns in den kommenden
Jahren noch verstärkt treffen, sagte er. „Wir
steuern dabei auf Verhältnisse zu, wie im Libanon“,
so Grußka. Ein weiterer Betrieb hatte wegen der
ebenfalls zunehmenden Starkregenereignisse einen
Totalschaden erlitten.
Bei der Politik sei die Problematik längst angekommen, versicherte Martin Schöffel, agrarpolitischer Sprecher der CSU im Bayerischen Landtag. „Wir brauchen einen rechtssicheren Beschluss, dass der Fischotter ebenfalls erlegt werden kann“, sagte er. Hintergrund sei, dass die Naturschutzverbände bereits Klage gegen eine solche Entscheidung angekündigt hatte. Es werde kein Weg daran vorbeiführen, den Fischotter zu dezimieren, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm. Bei 650 Fischotterpärchen in der Region würden die Fischereibestände weiter geplündert. Man dürfe sich nicht von angeblichen städtischen Eliten vorschreiben lassen, was zu tun ist, sagte der Kulmbacher Landrat Klaus Peter Söllner. Teichwirtschaft bedeute nicht nur die Erzeugung gesunder Lebensmittel, sondern auch einen wichtiger Beitrag zu Ökologie und Artenschutz.
Bei den turnusmäßigen Neuwahlen der Teichgenossenschaft wurde der Vorsitzende Dr. Peter Thoma einstimmig für weitere vier Jahre in seinem Amt bestätigt. Neuer Stellvertreter ist der Forellenteichwirt Michael Gahn aus Neustadt bei Coburg. Weiterer Stellvertreter bleibt Karl-Peter Schwegel aus Wüstenstein. Geschäftsführer ist Otto Norbert Grußka aus Rödental. Zu Beiräten wurden für die kommenden vier Jahre gewählt: Gerhard Rudolf (für den Landkreis Bamberg), Karl-Heinz Herzing (Bayreuth), Martin Heilmann (Forchheim), Christian Holoch (Kronach), Edwin Hartmann (Kulmbach), Alexander Krappmann (Lichtenfels) und Roland Medick (Wunsiedel). Die Stelle des Beirats für den Landkreis Coburg bleibt unbesetzt. Kassenprüfer sind Simon Abt aus Hirschaid und Alfred Rippl aus Thiersheim.
Eine besondere Würdigung erfuhr der nicht mehr zur Wahl angetretene Manfred Popp aus Benk (72), der sich seit Jahrzehnten mit vollem Einsatz um die Teichwirtschaft verdient gemacht hatte. Popp war unter anderem Betriebsleiter der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß, er war in der Fischereifachberatung des Bezirks Oberfranken tätig und hatte selbst mehrere Teiche bewirtschaftet.
Bilder:
1. Glückwünsche
zur wieder-, beziehungsweise Neuwahl: der
Landtagsabgeordnete und agrarpolitische Sprecher der
CSU-Fraktion im Landtag Martin Schöffel (rechts)
wünschte dem Vorsitzenden Dr. Peter Thoma und seinen
beiden Stellvertretern Karl-Peter Schwegel und
Michael Gahn alles Gute für die nächsten vier Jahre.
2. Der
Vorsitzende Dr. Peter Thomas und sein Stellvertreter
Karl-Peter Schwegel ehrten Manfred Popp (von links)
für seinen jahrzehntelangen Einsatz um die
Teichwirtschaft in Oberfranken.
„Landfrauen stehen ihren Mann“ / Landfrauen fordern verlässliche und realistisch Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft der Zukunft
.jpg) „Mit
uns leben die Dörfer“, lautet in diesem Jahr das
Motto der Landfrauenarbeit im Bayerischen
Bauernverband. Mit Kathrin Riedel vom Amt für
ländliche Entwicklung Oberfranken hatten sich die
Landfrauen dabei eine Expertin eingeladen, die für
zahlreiche Projekte in den Dörfern des Bayreuther
Landes zuständig ist.
„Mit
uns leben die Dörfer“, lautet in diesem Jahr das
Motto der Landfrauenarbeit im Bayerischen
Bauernverband. Mit Kathrin Riedel vom Amt für
ländliche Entwicklung Oberfranken hatten sich die
Landfrauen dabei eine Expertin eingeladen, die für
zahlreiche Projekte in den Dörfern des Bayreuther
Landes zuständig ist.
Bayreuth. „Wir sorgen für ein schönes Dorf“, sagte Kreisbäuerin Angelika Seyferth und machte damit unmissverständlich klar, dass die Landfrauen so wie niemand anders für das Jahresmotto stehen. Die Landfrauen seien es, die entscheidend dazu beitragen, dass Tradition und Brauchtum erhalten bleiben und somit Leben in den Dörfern herrscht. Vom Gemeinderat über die Feuerwehr bis hin zur Landjugend: „Unsere Aufgaben sind sehr vielfältig“, sagte sie. Doch auch auf den Höfen und Betrieben stünden die Landfrauen ihren Mann. Zumal mit den Landfrauen nicht nur die Dörfer, sondern auch die Städte lebten, denn schließlich seien es die Landwirte, die hochwertige Lebensmittel erzeugten und die in den Discountern für volle Regale sorgten.
Der Blick in die Zukunft fiel allerdings weniger optimistisch aus. „Landwirtschaft wird es in Zukunft mit Sicherheit auch noch geben, die Frage ist nur wie und wo“, so Angelika Seyferth. Gestiegene Betriebskosten, immer mehr Auflagen und Reglementierungen und immer höhere Anforderungen an Tierwohl und Umweltschutz: „Immer mehr Betriebe geben auf und schließen ihre Hoftore für immer“, sagte die Kreisbäuerin. Wenn aber Rindfleisch aus Argentinien und Schweinefleisch aus China importiert werden müssten, dann frage dort niemand mehr nach Haltungsbedingungen.
„Was wir brauchen sind verlässliche und auch realistische Rahmenbedingungen“, so Angelika Seyferth. Auch auskömmliche Preise seien notwendig, denn „vom Draufzahlen können auch wir nicht leben“. Nur wenn diese Forderungen erfüllt werden können, dann werde auch die nächste Generation noch sagen können: „Mit uns leben die Dörfer“.
Kathrin Riedel, als Abteilungsleisterin vom Amt für Ländliche Entwicklung für die Landkreise Bayreuth, Hof, Kulmbach und Wunsiedel zuständig, kümmert sich ebenfalls um die Fortentwicklung lebendiger Dörfer. „Ziel unserer Arbeit ist die Förderung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den ländlichen Regionen“, sagte sie.
.jpg) Doch
was machen lebendige und vitale Dörfer aus? Die
Referentin sprach unter anderem von Nahversorgern,
Handwerksbetrieben Bäckereien und Metzgereien,
Freizeitanlagen, einer intakten Natur und auch von
Landwirten in den Dörfern. Von den rund 350
Projekten, die aktuell bearbeitet werden, entfielen
über 100 auf den Landkreis Bayreuth. „Damit ist
Bayreuth ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit“, so
die Abteilungsleiterin. Ziel der meisten Projekte
sei es, wieder Leben ins Dorf zu bringen.
Doch
was machen lebendige und vitale Dörfer aus? Die
Referentin sprach unter anderem von Nahversorgern,
Handwerksbetrieben Bäckereien und Metzgereien,
Freizeitanlagen, einer intakten Natur und auch von
Landwirten in den Dörfern. Von den rund 350
Projekten, die aktuell bearbeitet werden, entfielen
über 100 auf den Landkreis Bayreuth. „Damit ist
Bayreuth ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit“, so
die Abteilungsleiterin. Ziel der meisten Projekte
sei es, wieder Leben ins Dorf zu bringen.
Dazu komme außerdem die klassische Flurbereinigung. „Hier wollen wird die Landwirte behutsam unterstützten.“. Flurbereinigung beruhe dabei stets auf Freiwilligkeit. Das Image, dass wir mit eiserner Hand durch die Flur gehen, stimme schon lange nicht mehr.“ Das Amt für ländliche Entwicklung Oberfranken hat seinen Sitz in Bamberg und ist eines von sieben derartigen Ämtern in Bayern. Im zurückliegenden Jahr wurden nach den Worten von Kathrin Riedel rund 28 Millionen Euro an die verschiedensten Projekte ausbezahlt.
Der Landfrauentag wurde in diesem Jahr wieder einmal mit einer ökumenischen Andacht eröffnet. Passend zum Lichtmesstag hatten sich der evangelische Pfarrer Christian Parchent aus Lindenhardt und der katholische Diakon Roland Huppmann von der Pfarrei Heilig Kreuz des Themas „Licht“ angenommen. Mit vielen Dutzend kleinen Kerzen visualisierten die Landfrauen das Thema kreativ und brachten das Licht stimmungsvoll von Tisch zu Tisch, so dass in der Tierzuchtklause die passende festliche Stimmung entstanden war.
Bilder:
1. „Licht
der Liebe, Lebenslicht“: Der Bayreuther
Landfrauenchor umrahmte die ökumenische Andacht beim
Landfrauenchor.
2. Der
stellvertretende Kreisobmann Harald Galster, die
stellvertretende Kreisbäuerin Doris Schmidt (von
links) und Kreisbäuerin Angelika Seyferth (rechts)
bedankten sich bei Kathrin Riedel die den Landfrauen
einen Einblick in die Arbeit des Amtes für ländliche
Entwicklung gegeben hatte.
Milchpreis unter Druck / „Zuerst wird an Lebensmittel gespart“: Gestiegene Kosten fressen Mehreinnahmen auf – Verteuerung im Supermarkt für Landwirte nicht nachvollziehbar
.jpg)
Kulmbach. Noch nie war der Milchpreis so hoch, wie zum Jahresende 2022. Der durchschnittliche Auszahlungspreis lag bei mindestens 60 Cent pro Kilogramm Milch. Im Dezember 2019 waren es noch 34 Cent. Doch für die Bauern ist das Rekordhoch alles andere als ein Grund zum Jubeln. Zum einen fressen die Kosten die Mehreinnahmen auf, zum anderen ist der Preis schon wieder im Sinken.
Mit 60 Cent, vereinzelt sogar noch darüber, war ein Niveau erreicht, das man noch vor wenigen Jahren für völlig unmöglich gehalten hätte. Grund dafür war, dass die Milchmenge auf dem Markt kontinuierlich abgenommen hatte, unter anderem deshalb, weil viele Betriebe ihre Hoftore für immer zusperrten. Bis vor wenigen Jahren war dagegen noch zu viel Milch am Markt. Dazu kommt, dass vor allem die Nachfrage nach Milchpulver und Butter auf dem Weltmarkt enorm gestiegen war.
 „Der
Milchpreis ist zur Zeit auf einen Rekordhoch und
unsere Milchbauern können ihre sehr hohen Kosten bei
Energie, Treibstoff, Futtermitteln und bei den
Maschinenkosten gut kompensieren“, sagt der
Kulmbacher Kreisobmann des Bauernverbandes Harald
Peetz aus Himmelkron. Der Preisanstieg kommt seiner
Meinung nach, weil eine geringe verfügbare Menge auf
gestiegene Nachfrage nach Milchprodukten und Käse
vor allem aus Asien getroffen ist. Natürlich spiele
auch der Krieg in der Ukraine und die dadurch zurück
gegangene Milchproduktion in dem wichtigen Agrarland
eine Rolle.
„Der
Milchpreis ist zur Zeit auf einen Rekordhoch und
unsere Milchbauern können ihre sehr hohen Kosten bei
Energie, Treibstoff, Futtermitteln und bei den
Maschinenkosten gut kompensieren“, sagt der
Kulmbacher Kreisobmann des Bauernverbandes Harald
Peetz aus Himmelkron. Der Preisanstieg kommt seiner
Meinung nach, weil eine geringe verfügbare Menge auf
gestiegene Nachfrage nach Milchprodukten und Käse
vor allem aus Asien getroffen ist. Natürlich spiele
auch der Krieg in der Ukraine und die dadurch zurück
gegangene Milchproduktion in dem wichtigen Agrarland
eine Rolle.
„Ich bin zwar kein Hellseher aber meiner Meinung nach hat der Milchpreis seinen Höchststand erreicht, beziehungsweise überschritten und wird wieder sinken“, so Harald Peetz. Erste Anzeichen seien schon zu sehen. Der Preis für Milch auf dem Spotmarkt, das ist Milch die nicht mit Verträgen an Molkereien gebunden ist, stehe jetzt schon nur noch bei 40 Cent, dem Preisniveau vor dem Anstieg. Auch würden jetzt schon vom Lebensmitteleinzelhandel neue Verträge nur noch zu geringeren Preisen gemacht, vor allem bei der weißen Linie, also bei Frischmilch und Jogurt. Bei Käse gebe es dagegen meist längerfristige Lieferverträge, da komme der Preisrückgang etwas später aber er werde auch dort kommen.
„Die Bauern haben natürlich durch die hohen Milchpreise eine gut Einnahme und haben auch die Produktion gesteigert, aber auf der anderen Seite stehen die hohen Kosten die sie tragen müssen, dadurch wird mehr Geld umgesetzt und das Risiko für den einzelnen Betrieb steigt“, so Kreisobmann Peetz. Es sei leider auch zu erwarten, dass bei wieder sinkenden Milchpreisen die Ausgaben der Betriebe für Energie, Diesel, Futtermittel und dergleichen nicht zurückgehen. „Im Gegenteil, sie werden weiter steigen, so dass sich die Lage für die Betriebe sehr schnell ins Negative umkehren kann.“
Schon vor dem Milchpreisanstieg habe eine große Zahl an Kuhbetrieben vor der Aufgabe ihrer Produktion gestanden. Das sei durch den guten Milchpreis nur etwas verschoben worden. „Ich bin mir sicher, dass sobald der Milchpreis wieder sinkt, das Zusperren der Ställe weiter gehen wird. Das habe aber vor allem seinen Ausgangspunkt bei den übertriebenen und einseitigen Auflagen und Anforderungen an die Betriebe in Deutschland. Es habe auch etwas mit der Akzeptanz und der Wertschätzung der Landwirte in der Gesellschaft zu tun: „Wer viele Stunden hart arbeitet und für die Versorgungssicherheit der Bürger auf Freizeit und Urlaub für das Wohl seiner Tiere verzichtet und dann als Tierquäler, Umweltvergifter oder Klimakiller dargestellt wird, dem ist nicht zu verdenken wenn er keine Lust mehr hat.“
 Norbert
Erhardt, Milchviehhalter aus Motschenbach bei
Mainleus (Bild links), bestätigt ebenfalls, dass der
Milchpreis bereits wieder sinkt. Der Milchpreis
werde aber auch „runter geredet“ weil seiner Ansicht
nach gewisse Gewerke zu wenig daran verdienen.
Erhardt gibt zu bedenken, dass Angebot und Nachfrage
den Preis regeln. Milch sei nicht viel auf den
Markt, schließlich hörten immer mehr
Milchviehbetriebe auf, weil sie keine Aussicht
sehen, wie sie die ganzen Auflagen, Stichwort
Tierwohl, erfüllen sollen. Neu investieren sei für
die meisten unmöglich.
Norbert
Erhardt, Milchviehhalter aus Motschenbach bei
Mainleus (Bild links), bestätigt ebenfalls, dass der
Milchpreis bereits wieder sinkt. Der Milchpreis
werde aber auch „runter geredet“ weil seiner Ansicht
nach gewisse Gewerke zu wenig daran verdienen.
Erhardt gibt zu bedenken, dass Angebot und Nachfrage
den Preis regeln. Milch sei nicht viel auf den
Markt, schließlich hörten immer mehr
Milchviehbetriebe auf, weil sie keine Aussicht
sehen, wie sie die ganzen Auflagen, Stichwort
Tierwohl, erfüllen sollen. Neu investieren sei für
die meisten unmöglich.
Durch die gestiegenen Kosten von Gas, Öl, Diesel, Kraftfutter, Strom, Lohnkosten für Reparaturen, Ersatzteile und den dreifach gestiegen Düngerpreisen bleibe von den „Rekordpreis“ nicht viel übrig. Wären die aufgeführten Posten beim „normalen Preis“ geblieben, hätten die Landwirte etwas verdient. „Derzeit geht es aber ziemlich null auf null.“ Was die Bio-Schiene angeht entscheide der Verbraucher. Wenn das andere Produkt billiger ist, werde eben kein Bio gekauft. Da alles andere, vor allem die Energiekosten, teurer geworden ist, wird seiner Meinung nach zuerst an den Lebensmittel gespart.
.jpg) „Der
Milchpreis ist bei uns noch stabil“, sagt Hermann
Grampp (Bild rechts) aus Melkendorf. Der 54-Jährige
bewirtschaftet seinen Betrieb nach den Kriterien des
Bioland-Anbauverbandes. Grund dafür ist, dass die
Molkerei Coburg die Milch als Käse veredelt.
„Dadurch sind wir den Schwankungen am Milchmarkt
weniger stark ausgesetzt.“ Nachteil sei es aber,
dass die vergangenen Preissteigerungen bei der Milch
immer erst einige Monate später an die Bauern
weitergegeben werden konnten, als bei Milchhöfen,
die sich stärker auf nicht veredelte Milchprodukte
konzentrieren. Ob der Milchpreis weiterhin stabil
bleibt ist nach den Worten von Hermann Grampp
fraglich. Für die kommenden Monate erwartet er
leicht sinkende Milchpreise, da es zurzeit eine
steigende Milchproduktion gibt.
„Der
Milchpreis ist bei uns noch stabil“, sagt Hermann
Grampp (Bild rechts) aus Melkendorf. Der 54-Jährige
bewirtschaftet seinen Betrieb nach den Kriterien des
Bioland-Anbauverbandes. Grund dafür ist, dass die
Molkerei Coburg die Milch als Käse veredelt.
„Dadurch sind wir den Schwankungen am Milchmarkt
weniger stark ausgesetzt.“ Nachteil sei es aber,
dass die vergangenen Preissteigerungen bei der Milch
immer erst einige Monate später an die Bauern
weitergegeben werden konnten, als bei Milchhöfen,
die sich stärker auf nicht veredelte Milchprodukte
konzentrieren. Ob der Milchpreis weiterhin stabil
bleibt ist nach den Worten von Hermann Grampp
fraglich. Für die kommenden Monate erwartet er
leicht sinkende Milchpreise, da es zurzeit eine
steigende Milchproduktion gibt.
Erhöht hätten sich die Preise deshalb, weil neben der allgemeinen Inflation die Nachfrage nach Milch europaweit gesehen um rund vier Prozent größer war, als das Angebot. Das Angebot habe nicht mit der Nachfrage mithalten können, da steigende Produktionskosten den Landwirten zu schaffen machen. Das sei auch der Grund, warum die Bauern recht wenig von dem gestiegenen Milchpreis haben, weil eben die Produktionsausgaben so stark gestiegen sind. Die enormen Preissteigerungen für Milchprodukte im Supermarkt seien für uns Landwirte aber nicht ganz nachvollziehbar, da sich der Preis mancher Produkte oft verdoppelt hat. „Wir als Milchlieferant haben für unsere Milch hingegen nur eine Erhöhung von zirka ein Drittel bekommen.
Stark rückläufig sei der Absatz mit Biomilch, weil es das Einkommen des Verbrauchers oft nicht mehr zulässt, Bio-Produkte zu kaufen. Der schlechtere Absatz von Bio-Produkten habe dazu geführt, dass die Erzeugerpreise von Biomilch und konventioneller Milch jetzt oft gleich hoch sind. „Wir als Biomilch-Erzeuger haben jetzt nur noch einen Preisunterschied von vier Cent zur konventionellen Milch und bei anderen Milchhöfen ist es oft noch weniger.“
Info:
Der Grundpreis der Milch bezieht sich in allen Regionen Deutschlands, auf einen Fettgehalt von 4,0 Prozent und einen Eiweißgehalt von 3,4 Prozent. Jede Molkerei hat aufgrund ihrer Struktur ihren „eigenen Milchpreis“, saisonal und regional schwankend. Der Milchpreis wird in Cent je Kilogramm berechnet. Der Umrechnungsfaktor von Liter zu Kilogramm beträgt 1,03. Ein Liter Milch entspricht somit 1,03 Kilogramm. Wie viel Geld ein Bauer für seine Milch genau bekommt, hängt von der gelieferten Rohmilchmenge, vom Fett- und Eiweißgehalt der Rohmilch und von weiteren Qualitätsmerkmalen wie der Keimzahl, der Zellzahl und den enthaltenden Hemmstoffen der Rohmilch ab.
Emotionen, Eye-Catcher und Aha-Erlebnisse / Oberfränkischer Direktvermarktertag: Marketing im Focus
.jpg) Trieb.
„Das Auge isst immer mit.“ Das sagt Daniel
Kükenhöhner, vom Planungsbüro Petzinger aus München.
Er berät inhabergeführte Hofläden, Bioläden,
Unverpackt-Läden und Reformhäuser über alles, was
mit Warenpräsentation und Marketing zu tun hat. Beim
Oberfränkischen Direktvermarktertag in Trieb bei
Lichtenfels gab er den exakt 55 Teilnehmern aus
allen Teilen des Regierungsbezirks wertvolle Tipps
dazu, wie sie erfolgreicher auftreten und sich gegen
die scheinbar übermächtige Konkurrenz des
Lebensmitteleinzelhandels behaupten können.
Trieb.
„Das Auge isst immer mit.“ Das sagt Daniel
Kükenhöhner, vom Planungsbüro Petzinger aus München.
Er berät inhabergeführte Hofläden, Bioläden,
Unverpackt-Läden und Reformhäuser über alles, was
mit Warenpräsentation und Marketing zu tun hat. Beim
Oberfränkischen Direktvermarktertag in Trieb bei
Lichtenfels gab er den exakt 55 Teilnehmern aus
allen Teilen des Regierungsbezirks wertvolle Tipps
dazu, wie sie erfolgreicher auftreten und sich gegen
die scheinbar übermächtige Konkurrenz des
Lebensmitteleinzelhandels behaupten können.
Obwohl, gerade von den Supermärkten und Discountern könnten die landwirtschaftlichen Direktvermarkter auch lernen. Denn viele Tipps, die der Referent den (potentiellen) Direktvermarktern mit auf dem Weg gab, sind von den „Großen“ längst erfolgreiche umgesetzt worden. Doch s manches, was der kleine Hofladen kann, geht beim Discounter eben nicht, denn, so Daniel Kükenhöhner: „Auch in einem kleinen Laden kann man eine Erlebniswelt aufbauen.“
Kunden würden nicht nur Produkte, sondern auch Emotionen und Geschichten kaufen. Gerade da habe die Landwirtschaft viel zu erzählen. „Schaffen die ein Aha-Erlebnis“, appellierte Kükenhöhner an die Bauern. „Stellen sie ihre Arbeit realistisch dar, zeigen sie, was sie tun und lassen sie die Kunden daran teilhaben.“
Im Idealfall „shoppen“ die Kunden Lebensmittel, so wie sie Kleidung oder Elektronikartikel „shoppen“. Doch erst einmal muss man die Kunden in den Laden bekommen. Kreative Hinweisschilder, ein einheitlich aufeinander abgestimmtes Design, Wareninszenierungen schon vor der Ladentür, das alles gehört dazu. Was die Inszenierung angeht, so stellen für den Fachmann der Ladenbau und die richtige Beleuchtung das A und dar. Ladenbau sei wie Kulissenbau, man schafft eine Bühne für die Inszenierung der Ware.
Die regale seien dabei nicht so wichtig sagte Daniel Kükenhöhner, der eigentlich gelernter Schreiner ist. Von Ikea sollten sie nicht unbedingt sein, denn das passe nicht zur Philosophie eines Hofladens. Ansonsten aber seien Beleuchtung, Konzept und Strategie viel wichtiger. Und natürlich Kreativität. Ein alter, schön restaurierter Traktor sei als Eyecatcher beispielsweise hervorragend geeignet. Wenn sich Kinder dann auch noch draufsetzen dürfen, von den Eltern fotografiert werden und die Bilder in den sozialen Medien wieder auftauchen, dann könne dem Hofladenbetreiber nichts Besseres passieren.
.jpg) Was
einen Hofladen noch nach vorne bringen kann? Nach
den Worten von Daniel Kükenhöhner könnten das
Aktionen, Workshops, Vorträge, Veranstaltungen,
Events und Sponsoring-Maßnahmen sein. „Warum nicht
mal das Buffet für den Elternabend liefern, wenn man
dafür ganz kurz seinen Laden vorstellen kann“, so
der Referent. Hilfreich könnten auch verschiedene
Kooperationen sein, etwa wenn der Imker einmal im
Monat einen Vormittag lang in den Laden kommt und
seine Produkte persönlich vorstellt.
Was
einen Hofladen noch nach vorne bringen kann? Nach
den Worten von Daniel Kükenhöhner könnten das
Aktionen, Workshops, Vorträge, Veranstaltungen,
Events und Sponsoring-Maßnahmen sein. „Warum nicht
mal das Buffet für den Elternabend liefern, wenn man
dafür ganz kurz seinen Laden vorstellen kann“, so
der Referent. Hilfreich könnten auch verschiedene
Kooperationen sein, etwa wenn der Imker einmal im
Monat einen Vormittag lang in den Laden kommt und
seine Produkte persönlich vorstellt.
Noch einen wichtigen Tipp hatte der Referent für alle Betreiber von Hofläden, die gleichzeitig auch Warenautomaten vorhalten: „Schalten sie zu den Ladenöffnungszeiten die Automaten einfach aus, sonst kommt der Kunde erst gar nicht in den Laden rein.“
„Wichtig bei der Werbung für Direktvermarkter ist die Überlegung vorher, denn Positionierung ist die Basis allen Marketings“, so Praktikerin Marion Deinlein aus Hollfeld von der Initiative „HeimatEntwickler Oberfranken“. Dabei sollte man sich immer wieder die Frage stellen: „An welche Zielgruppe will ich mich richten?“ Bei Werbemaßnahmen sei es ratsam, nicht nach dem Gießkannenprinzip zu werben, sondern zielgerichtet die Personen anzusprechen, die man erreichen will. Idealerweise auch dort, wo man sie antrifft , zum Beispiel bei Familien mit Kindern in Kitas. Wichtig sei es auch, die eigene Positionierung immer zu überdenken und sich selbst immer wieder Fragen zu stellen: Wer bin ich? Was mache ich? Was ist mir wichtig? Was haben andere davon, dass es mich und mein Produkt gibt? Eine ganz wichtige Rolle spiele auch das „Storytelling“: „Die Leute wollen auch immer die Geschichte und die Menschen hinter den Produkten kennenlernen.“
Zuvor hatte Sophia Gossner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft die gesetzlichen Anforderungen in Sachen Verpackung vorgestellt. Mit dem Ziel, die Umwelt zu schützen, einen fairen Wettbewerb zu fördern und vor allem den Anteil von Mikroplastik aus den Weltmeeren einzudämmen, gibt es da auch für Betreiber von Hofläden viele neue Gesetze und Auflagen zu beachten. Ob Registrierungspflicht oder Datenmeldepflicht: „Nehmen sie die Vorgaben wirklich ernst“, riet die Sprechern allen Hofladenbetreibern. Verpackungen seien aber auch die Visitenkarte eines jeden Unternehmens und hier könne jeder Direktvermarkter beim Verbraucher punkten.
Bilder:
1. Behördenleiter Harald Weber und Simone Vetter vom
Landwirtschaftsamt Coburg-Kulmbach konnten zum
Oberfränkischen Direktvermarktertag Daniel
Kükenhöhner (von rechts) vom Planungsbüro Petzinger
aus München begrüßen, das sich auf die Beratung von
Hofläden spezialisiert hat.
2. Sie kümmern sich um die Direktvermarkter in
Oberfranken (von links): Simone Vetter (Coburg),
Tina Langenscheidt (Kulmbach), Marcel Lortz
(Bamberg) und Andrea Eckl (Bayreuth-Münchberg).
Preise galoppieren davon – Immer mehr Bauern schließen ihre Hoftore für immer / Dramatische Entwicklung im Bayreuther Land war Thema beim Betzensteiner Bauerntag
Betzenstein.
Wie kann das Landwirtschaftsamt die Bauern am besten
unterstützten? Beim Bauerntag in Betzenstein
(Landkreis Bayreuth)
.jpg) warf
der neue Chef des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg,
Michael Schmidt, die Frage in die Runde und die
Antwort war eindeutig: Indem es bei der Gesellschaft
mehr Verständnis für die Landbewirtschaftung und die
Nutztierhaltung weckt.
warf
der neue Chef des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg,
Michael Schmidt, die Frage in die Runde und die
Antwort war eindeutig: Indem es bei der Gesellschaft
mehr Verständnis für die Landbewirtschaftung und die
Nutztierhaltung weckt.
Michael Schmidt war nach Betzenstein, dem südlichsten Bereich seines Amtsgebietes, gekommen, um sich und die Arbeit der Behörde vorzustellen. Schnell kamen die Bauern in der Diskussion darauf, dass die Gesellschaft den Bezug zur Landwirtschaft nahezu gänzlich verloren hat. „Wir müssen rein in die Schulen“, war man sich einig. Lehrer sollten Praktika auf Bauernhöfen machen, um mit der Praxis konfrontiert zu werden. Ganz so einfach sei das freilich nicht, wusste Kreisbäuerin Angelika Seyferth zu berichten. Ihrer Bemühungen hatten ergeben, dass nur ganz wenige Schulen über entsprechende Möglichkeiten und Angebote Bescheid wüssten. Gleichwohl sei es unverzichtbar, das Thema in die Schulen zu tragen.
Zuvor hatte Kreisobmann Karl Lappe beklagt, dass derzeit so viele Betriebe aufhören. Aufgrund der extrem schlechten Lage für Schweinehalter hätten gleich mehrere große Betriebe aus dem Landkreis Bayreuth aufgegeben. „Es tut schon weh, wenn der Lebensmitteleinzelhandel mit Schäufele wirbt und gleichzeitig riesige Betriebe im Ausland aufkauft, während wir uns hier mit allen möglichen Auflagen herumschlagen müssen“, sagte Lappe dazu. Doch damit nicht genug. Obwohl mit der Milchviehhaltung derzeit gute Preise zu erzielen seien, hörten ebenfalls viele Bauern auf, weil ihnen die Kosten davon galoppierten. „Viele Bauern treiben derzeit große Sorgen um“, so Lappe.
Amtschef Michael Schmidt konnte die Aussagen des Kreisobmanns nur bestätigen. Während es 2016 noch 293 Schweinemäster im Landkreis Bayreuth gegeben habe, sind es aktuell nur noch 184. Das bedeutet: In gut sechs Jahren hätten über 100 Betriebe ihre Hoftore für immer geschlossen. Oberfrankenweit seien die Zahlen noch dramatischer: 2016 waren es noch rund 1800 Schweinebauern, aktuell sind es 1100.
.jpg) Der
Behördenleiter appellierte trotz allem an die
Landwirte, nicht zu verzweifeln, sondern den Wandel
anzunehmen und zu versuchen damit umzugehen. „Es
wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht
wird“, sagte er. Und weiter: „Manchmal sind die
Emotionen höher als die Betroffenheit.
Der
Behördenleiter appellierte trotz allem an die
Landwirte, nicht zu verzweifeln, sondern den Wandel
anzunehmen und zu versuchen damit umzugehen. „Es
wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht
wird“, sagte er. Und weiter: „Manchmal sind die
Emotionen höher als die Betroffenheit.
Michael Schmidt steht seit 1. Oktober als Nachfolger von Georg Dumpert an der Spitze des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg. Das Amt ist für die drei Landkreise Bayreuth, Hof und Wunsiedel zuständig, hat gut 150 Mitarbeiter und ist Ansprechpartner für rund 3300 Betriebe. Zwei Drittel davon werden im Nebenerwerb geführt. Michael Schmidt war zuletzt als Bereichsleiter Forst beim Landwirtschaftsamt in Kulmbach tätig. Zuvor bekleidete der 45-Jährige verschiedene Stationen unter anderem im Bayerischen Landwirtschaftsministerium und in der Staatskanzlei. Er hatte er Forstwissenschaften studiert und an der TU München über Holzbau promoviert. Geboren wurde Michael Schmidt in Bayreuth, aufgewachsen ist er in Stadtsteinach im Kulmbacher Land.
Für das Bayreuther Land ist Landrat Florian Wiedemann zuständig. „Bayreuther Land“ heißt auch die Dachmarke, die unter dem Dach des Landratsamtes vor einigen Jahren gegründet wurde und die seitdem eine echte Erfolgsgeschichte hinter sich hat. Ziel ist es beim Verbraucher das Bewusstsein für regionale Lebensmittel zu schaffen und den Erzeugern tatkräftig bei der Vermarktung zu helfen. So gibt es in einem neuen Edeka-Markt in der Stadt Bayreuth einen „Laden im Laden“ nur mit Produkten aus dem „Bayreuther Land“, ein weiterer derartiger Laden ist bereits in Planung.
Beim Betzensteiner Bauerntag zeichnete Kreisobmann Karl Lappe die folgenden drei langjährigen Mitglieder mit Urkunden und Ehrenzeichen aus: Klaus Lothes aus Bronn für 15 Jahre, Werner Steger vom Ortsverband Leupoldstein-Ottendorf für 25 Jahre und Willi Kalb aus Bernheck für 35 Jahre.
Bilder.
1.
Beim Betzensteiner Bauerntag stellte sich Michael
Schmidt (rechts), der neue Leiter des
Landwirtschaftsamtes Bayreuth Münchberg vor.
Kreisobmann Karl Lappe bedankte sich mit einem
Präsentkorb aus dem „Bayreuther Land“.
2. Kreisobmann Karl Lappe (rechts) zeichnete die
langjährigen Mitglieder Klaus Lothes, Werner Steger
und Willi Kalb (von links) aus.
Hanf statt Mais und Weizen/ Nachwachsende Rohstoffe von oberfränkischen Feldern für Auto-, Bau-, Papier- und Textilindustrie – Thurnauer Unternehmen sucht Hanfbauern
.jpg) Kulmbach.
Als nachwachsender Rohstoff bietet Hanf zahlreiche
Möglichkeiten der Nutzung. Hanf ist die älteste
Nutzpflanze der Welt, ihre Fasern können vielseitig
verwendet werden, aus den Samen, Blüten und Blättern
wird Öl hergestellt. Damit könnte Hanf für Landwirte
in der Region mehr als nur eine Alternative sein.
Keine Rolle spielt dabei allerdings die Erzeugung
von Haschisch und Marihuana aus den getrockneten
Hanfblättern, -blüten und -blütenständen. In der
Regel werden Hanfsorten angebaut, die auf einen ganz
schwachen THC-Gehalt (Tetrahydrocannabis) gezüchtet
wurden und die zur einer Verarbeitung als
Rauschdroge völlig ungeeignet sind.
Kulmbach.
Als nachwachsender Rohstoff bietet Hanf zahlreiche
Möglichkeiten der Nutzung. Hanf ist die älteste
Nutzpflanze der Welt, ihre Fasern können vielseitig
verwendet werden, aus den Samen, Blüten und Blättern
wird Öl hergestellt. Damit könnte Hanf für Landwirte
in der Region mehr als nur eine Alternative sein.
Keine Rolle spielt dabei allerdings die Erzeugung
von Haschisch und Marihuana aus den getrockneten
Hanfblättern, -blüten und -blütenständen. In der
Regel werden Hanfsorten angebaut, die auf einen ganz
schwachen THC-Gehalt (Tetrahydrocannabis) gezüchtet
wurden und die zur einer Verarbeitung als
Rauschdroge völlig ungeeignet sind.
Ein junges Unternehmen, das sich intensiv mit der Rekultivierung von Nutzhanf beschäftigt, ist die Natuvalis GmbH mit Sitz in Thurnau. Die beiden Gründer Marc Töpfer und Fernando Reinl suchen derzeit intensiv nach Landwirten, die auf ihren Flächen Hanf anbauen würden. In spätestens zwei Jahren möchten die beiden eine entsprechende Anlage zur Gewinnung von Kurz- und Langfasern, sowie Schäben (Teile des Pflanzenstängels) errichtet haben. Nun suchen die beiden Landwirte, die bereit sind, auf ihren Flächen Hanf anzubauen.
Nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit der Natur ist das Gebot der Stunde. Dazu biete Hanf alle Möglichkeiten, sind sich die beiden Gründer einig. Ursprünglich wollten sie aus dem Hanf medizinische Wirkstoffe gewinnen, doch trotz angekündigter Lockerungen durch die Politik habe man schnell gemerkt, dass die gesetzlichen Regelungen alles andere als klar sind. Daraufhin hatten sich Marc Töpfer und Fernando Reinl auf Hanf für industrielle Zwecke konzentriert.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig. Sie reichen vom Einsatz der Fasern in der Automobilindustrie, in Dämmstoffen, in der Textil- und Papierindustrie bis zur Herstellung von Baustoffen wie Hanfkalk oder Hanfbeton. „Die Hanfpflanze birgt unglaubliches Potenzial in sich“, sagt Marc Töpfer, der zuvor als Ingenieur in der Industrie tätig war. Es gebe kaum eine Pflanze, die dermaßen innovativ ist.
.jpg) In
jedem Auto seien fünf bis zehn Kilogramm Naturfasern
verbaut, sagt Unternehmenssprecherin Katrin Witt.
Sie fänden sich unter anderem in Sitzauflagen,
Hutablagen, Türverkleidungen und in vielen anderen
Form – und Pressteilen. Derzeit seien es oft noch
Kohle- und Glasfasern, vereinzelt aber auch schon
Flachsfasern, doch schon bald könnten es Hanffasern
von oberfränkischen Feldern sein. Weitere
Einsatzmöglichkeiten seien etwa bei ökologischen
Sanierungsmaßnahmen denkbar, indem Dämmmaterial aus
mineralischen und fossilen Stoffen gegen Hanf
ausgetauscht wird.
In
jedem Auto seien fünf bis zehn Kilogramm Naturfasern
verbaut, sagt Unternehmenssprecherin Katrin Witt.
Sie fänden sich unter anderem in Sitzauflagen,
Hutablagen, Türverkleidungen und in vielen anderen
Form – und Pressteilen. Derzeit seien es oft noch
Kohle- und Glasfasern, vereinzelt aber auch schon
Flachsfasern, doch schon bald könnten es Hanffasern
von oberfränkischen Feldern sein. Weitere
Einsatzmöglichkeiten seien etwa bei ökologischen
Sanierungsmaßnahmen denkbar, indem Dämmmaterial aus
mineralischen und fossilen Stoffen gegen Hanf
ausgetauscht wird.
Die Natuvalis-Gründer gehen sogar soweit, dass sie sich eine Wiederbelebung der oberfränkischen Textilindustrie vorstellen könnten. Gestiegene Anforderungen an die Produktionsbedingungen in den meist asiatischen Ursprungsländern sowie Änderungen in den Lieferkettengesetzen könnten die Textilproduktion hierzulande durchaus wieder attraktiver machen. Größter Abnehmer von Hanffasern ist nach wie vor die Papierindustrie. Nicht zuletzt seien sogar schon die erste Bibel und die Unabhängigkeitserklärungen der Vereinigten Staaten von Amerika auf Hanfpapier gedruckt worden.
Viele Märkte würden derzeit noch mit künstlichen Stoffen bedient, der Bedarf könnte aber leicht mit natürlichen Stoffen gedeckt werden, was dem gesellschaftliche geforderten und politisch gewünschten Zielen einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft entsprechen würde.
Oberfranken sehen die beiden Natuvalis-Gründer hervorragend für den Hanfanbau geeignet. Die Anbautests der zurückliegenden beiden Jahre auf verschiedenen Flächen von Landwirten in den Landkreisen Kulmbach, Kronach und Coburg hätten positive Ergebnisse gebracht. Selbst die Trockenheit des zurückliegenden Sommers habe der Hanfpflanze weniger geschadet als den meisten anderen Feldfrüchten. „Unsere Erwartungen haben sich zu 80 Prozent erfüllt“, so Fernando Reinl. Pestizideinsätze seien nicht nötig gewesen. Aufgrund des Humusaufbaus habe die Folgefrucht auf den entsprechenden Böden sogar bis zu 20 Prozent mehr Ertrag gebracht.
.jpg) Konkret
sollen in den kommenden Monaten ein Lager und eine
entsprechende Anlage entstehen, in der das Stroh
gebrochen, die Fasern aufgeschlossen und separiert
werden. Aktuell gebe es bundesweit nur drei
Hersteller von Hanffasern, Frankreich oder die
Niederlande seien dagegen führend. Die Anbaufläche
in Deutschland liege aktuell bei 4500 Hektar.
Konkret
sollen in den kommenden Monaten ein Lager und eine
entsprechende Anlage entstehen, in der das Stroh
gebrochen, die Fasern aufgeschlossen und separiert
werden. Aktuell gebe es bundesweit nur drei
Hersteller von Hanffasern, Frankreich oder die
Niederlande seien dagegen führend. Die Anbaufläche
in Deutschland liege aktuell bei 4500 Hektar.
Gute Chancen für den Anbau von Hanf in unseren Breiten sieht auch Harald Köppel, der Geschäftsführer des Bauernverbandes für Bayreuth, Kulmbach und Kronach. Der Hanfanbau könne auf jeden Fall eine Möglichkeit für den einen oder anderen Landwirt sein, zum einen die Fruchtfolge auszuweiten, zum anderen auch, um Geld zu verdienen und Fuß zu fassen. Die klimatischen Gegebenheiten seien für den Hanfanbau in Ordnung. Die beiden Pioniere im Landkreis Kronach. kämen trotz des rauen Klimas gut zurecht. Hanfanbau führe derzeit noch ein komplettes Nischendasein. Nicht vorstellbar sei es dagegen, dass Hanf mit entsprechend hohem THC-Gehalt auf dem freien Feld angebaut werden könnte, auch wenn die Regierung entsprechende Cannabis-Freigaben plant. „Da müssten die Felder ja eine Rund-um-Bewachung haben.“
Nach den Worten von Arno Eisenacher vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach wurden in Oberfranken heuer von 21 Betrieben 47 Hektar Hanf angebaut, vier Betriebe beschäftigen sich im Landkreis Kulmbach mit Hanf. Die Anbaufläche liegt bei knapp 10 Hektar. Einer der Betriebe ist der Biohof Distler in Esbach bei Kirchleus/Lösau.
„Wir bauen schon seit 2016 Hanf an“, sagt Manfred Distler. Bei ihm werden die Samen nach dem Dreschen zu Öl verarbeitet und im eigenen Hofladen vermarktet. Seine Erfahrungen mit dem Anbau bezeichnet der Biolandwirt als sehr gut. Die Hanfpflanze benötige wenig Wasser und sei relativ hitzeresistent. Dem Anbau von Hanf als nachwachsender Rohstoff gibt Manfred Distler vor dem Hintergrund der Energiekrise, der Rohstoffkrise mit Lieferproblemen in unseren Breiten gute Chancen, vor allem deshalb, weil Hanf so extrem vielseitig verwendbar sei. Selbst eine Hanf-Jeans, Made in Bavaria, habe es schon mal gegeben. Leider sei sie vom Markt nicht so angenommen worden.
Bilder: So sieht die Hanfpflanze auf den Feldern des Biohofs Distler in Esbach bei Kirchleus/Lösau aus. (Fotos: Biohof Distler)
Kein Aufruf zum Fleischverzicht / Kirche trifft Landwirtschaft: Evangelische Jugend stellte umstrittene Äußerungen klar
 Motschenbach.
Die Berichterstattung über einen Beschluss der
Evangelischen Jugend in Kulmbach hatte in den
zurückliegenden Tagen und Wochen hohe Wellen
geschlagen. „Zur Bewahrung der Schöpfung“ möchte die
evangelische Jugend fortan komplett auf Fleisch
verzichten, wurde Diakon Stefan Ludwig im lokalen
Radiosender und in einem Internet-Portal zitiert.
Auf Freizeiten sollte es künftig nur noch
vegetarische Gerichte geben.
Motschenbach.
Die Berichterstattung über einen Beschluss der
Evangelischen Jugend in Kulmbach hatte in den
zurückliegenden Tagen und Wochen hohe Wellen
geschlagen. „Zur Bewahrung der Schöpfung“ möchte die
evangelische Jugend fortan komplett auf Fleisch
verzichten, wurde Diakon Stefan Ludwig im lokalen
Radiosender und in einem Internet-Portal zitiert.
Auf Freizeiten sollte es künftig nur noch
vegetarische Gerichte geben.
Bei den Landwirten im Raum Kulmbach hatte diese Aussage für „Empörung, Enttäuschung und Fassungslosigkeit“ gesorgt. Der Bauernverband lud kurzerhand Diakon Stefan Ludwig, Dekan Friedrich Hohenberger und weitere Vertreter der Evangelischen Jugend auf den landwirtschaftlichen Betrieb von Norbert Erhardt in Motschenbach ein, um den Vertretern der Kirche zu zeigen, wie Landwirtschaft tatsächlich aussieht.
Ergebnis: Man wolle künftig miteinander und nicht übereinander reden. Ganz so, wie es rübergekommen ist, sei das auch gar nicht gemeint gewesen. Vielmehr habe man mit dem Beschluss ausdrücken wollen, künftig auf Billigfleisch vom Discounter zu verzichten, das aus Massentierhaltung stammt. Man wolle fortan auf Regionalität und Saisonalität setzen, erklärten Eileen Hempfling und Moritz Mertel von der Evangelischen Jugend. Da dies aber das Budget speziell bei drei bis viertägigen Jugendfreizeiten hergebe, wolle man dort aber lieber ganz auf Fleisch verzichten, als Billigfleisch zu nehmen. „Was wir nicht wollten ist, die Landwirtschaft als böse darzustellen“, so Eileen Hempfling.
Die Landwirtschaft habe nichts gegen vegetarische Lebensmittel, stellte BBV-Kreisobmann Harald Peetz klar. Die Bauern produzierten sowohl tierische als auch pflanzliche Nahrungsmittel. Wenn es aber heiße, dass Tierhalter die Schöpfung mit Füßen treten, dann könne man das so nicht stehen lassen. „Dass uns viele Organisationen immer wieder gerne in die Pfanne hauen, sind wir gewohnt. Dass sich aber die Kirche auch daran beteiligt, das ist neu“, so der Kreisobmann. Er erinnerte vor allem auch daran, dass die Bauern traditionell eine enge Verbindung zur Kirche hätten.
Das Ganze sei schief rüber gekommen, sagte Katrin Geyer von der Evangelischen Kirche. Die grundsätzliche Überlegung sei es vielmehr gewesen, die heimische Landwirtschaft zu stärken, so Dekan Friedrich Hohenberger. Nach den Worten des Dekans sei der Wurm über die Medien reingekommen. Man sollte deshalb miteinander reden und nicht über die Medien übereinander. „Es war nie unsere Absicht, einen ganzen Berufszweig in die Ecke zu stellen“, sagte Diakon Stefan Ludwig, der in den Veröffentlichungen als der Verantwortliche für die Aussagen dargestellt wurde. Christina Flauder, stellvertretende Landrätin im Landkreis Kulmbach und Mitglied der evangelischen Landessynode war sichtlich um ein gutes Miteinander bemüht und bescheinigte den heimischen Bauern, dass sie einen ganz großen Beitrag für die Lebensgrundlagen von uns allen leisten.
Wenn tatsächlich falsch rüber gekommen ist, hätte man das ja auch klarstellen können, entgegnete Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel. Die Bauern seien sich ihrer Verantwortung sehr wohl bewusst. Jeder könne sich ernähren wie er will, so Beate Opel. Sie gab aber auch zu bedenken, dass bei Kindern eine reine vegetarische Ernährung fraglich sei.
Bild: Kirche und Landwirtschaft: Auf dem Betrieb von Norbert Erhardt in Motschenbach bei Mainleus trafen sich Vertreter der Evangelischen Kirche mit den Verantwortlichen des Bauernverbandes zur Aussprache.
Kompetent, konsequent und klar: Führungswechsel bei der Agrar-Technik in Franken / Christian Firsching löst Günter Schuster als Geschäftsführer der Agrar-Technik-Sparte in Franken ab
.jpg) Bamberg.
Nach 46 Jahren bei der BayWa, davon 35 Jahre als
Geschäftsführer, hat der Konzern den Chef der
Agrar-Technik-Sparte in Franken Günter Schuster in
den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde sein
bisheriger Stellvertreter Christian Firsching als
Nachfolger in sein Amt eingeführt. Mit der internen
Neubesetzung dieser wichtigen Funktion möchte die
BayWa gegenüber ihren Kunden und Lieferanten ihre
Verlässlichkeit und Kontinuität unter Beweis
stellen.
Bamberg.
Nach 46 Jahren bei der BayWa, davon 35 Jahre als
Geschäftsführer, hat der Konzern den Chef der
Agrar-Technik-Sparte in Franken Günter Schuster in
den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde sein
bisheriger Stellvertreter Christian Firsching als
Nachfolger in sein Amt eingeführt. Mit der internen
Neubesetzung dieser wichtigen Funktion möchte die
BayWa gegenüber ihren Kunden und Lieferanten ihre
Verlässlichkeit und Kontinuität unter Beweis
stellen.
Nach den Worten von Günter Schuster hatte sich die BayWa-Agrarsparte in Franken während der zurückliegenden Jahre überaus erfreulich entwickelt. Die Techniksparte sei unter seiner Verantwortung in den letzten 20 Jahren zum Marktführer in ihrem Segment geworden. Die Zahl der Arbeitsplätze bei Agrar und Technik in Franken gab er mit 1100 an, den Jahresumsatz bezifferte er auf 600 Millionen Euro. Im Bereich Smart Farming habe die Region sogar bundesweit Akzente setzen können. Auch im Gebrauchtmaschinenmarkt sei die Sparte in der Region sehr erfolgreich. So betreibe die BayWa in Bamberg ihr größtes Gebrauchtwagenzentrum, das stark international ausgerichtet sei. Nachfolger Christian Firsching hatte 2005 seine Ausbildung bei der BayWa begonnen. Set 2015 war er kaufmännischer Leiter und seit 2020 stellvertretender Spartengeschäftsführer.
.jpg) Zahlreiche
namhafte Gäste aus der Agrarbranche waren zum
Führungswechsel in das Bamberger Welcome-Hotel
gekommen, um dich bei Günter Schuster zu bedenken
und seinem Nachfolger viel Glück zu wünschen. Der
neue Bauernverbandspräsident Günther Felßner nannte
Schuster einen gestandenen Manager und bot dessen
Nachfolger die Zusammenarbeit mit dem Bauernverband
an. An seine Berufskollegen appellierte Felßner:
„Wir müssen raus aus der Opfer- und Vorwurfsrolle“,
auch wenn die Stimmung teilweise unsäglich sei. „Wir
sind Mutmacher, wir schaffen Lebensgrundlagen und
wir werden existentiell gebraucht.“
Zahlreiche
namhafte Gäste aus der Agrarbranche waren zum
Führungswechsel in das Bamberger Welcome-Hotel
gekommen, um dich bei Günter Schuster zu bedenken
und seinem Nachfolger viel Glück zu wünschen. Der
neue Bauernverbandspräsident Günther Felßner nannte
Schuster einen gestandenen Manager und bot dessen
Nachfolger die Zusammenarbeit mit dem Bauernverband
an. An seine Berufskollegen appellierte Felßner:
„Wir müssen raus aus der Opfer- und Vorwurfsrolle“,
auch wenn die Stimmung teilweise unsäglich sei. „Wir
sind Mutmacher, wir schaffen Lebensgrundlagen und
wir werden existentiell gebraucht.“
Zur seiner großartigen Lebensleistung gratulierte Franz Josef Lutz, der Vorstandsvorsitzende der BayWa AG, dem scheidenden Geschäftsführer. Er nannte Günther Schuster einen Mann des Mutes, der Franken im besten Sinne des Wortes aufgemischt und dabei sämtliche Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen habe. „Günter Schuster ist als harter Hund bekannt, aber er war immer konsequent, berechenbar und damit stets zuverlässig“, so Franz Josef Lutz.
.jpg) Gregor
Scheller, Präsident des Bayerischen
Genossenschaftsverbandes, beschrieb Günther Schuster
ebenfalls als konsequent, aber auch als überaus
kompetent und klar. Er habe die BayWa vom
traditionellen Unternehmen hin zum modernen
Dienstleister mitgestaltet. Zum Abschied überreichte
der Genossenschaftspräsident dem scheidenden Günter
Schuster mit der Goldenen Ehrennadel die höchste
Auszeichnung des Deutschen Genossenschafts- und
Raiffeisenverbandes.
Gregor
Scheller, Präsident des Bayerischen
Genossenschaftsverbandes, beschrieb Günther Schuster
ebenfalls als konsequent, aber auch als überaus
kompetent und klar. Er habe die BayWa vom
traditionellen Unternehmen hin zum modernen
Dienstleister mitgestaltet. Zum Abschied überreichte
der Genossenschaftspräsident dem scheidenden Günter
Schuster mit der Goldenen Ehrennadel die höchste
Auszeichnung des Deutschen Genossenschafts- und
Raiffeisenverbandes.
Von einer Zierde des Wirtschaftsstandortes Bamberg sprach Oberbürgermeister Andreas Starke. Der Bamberger Hafen wäre ohne die BayWa undenkbar. Mit dem Ankauf des ehemaligen Stadtlagerhauses habe die BayWa dort 1992 den Grundstein für den Erfolg gelegt. Insgesamt habe die BayWa in der Domstadt bereits eine annähernd 100-jährige Geschichte, so Andreas Starke.
Bilder:
1. Christian Firsching (links) und Günter Schuster.
2. Günter Schuster, der
Präsident des Bayerischen Genossenschaftsverbandes
Gregor Scheller und Christian Firsching (von links).
3.
Der Bamberger
BBV-Kreisobmann Tobias Kemmer, Günter Schuster, die
bisherige Landesbäuerin Anneliese Göller,
BBV-Direktor Wilhelm Böhmer, Kreisbäuerin Marion
Link, BBV-Geschäftsführer Werner Nützel und
Christian Firsching (von links).
Rollende Lichterketten und leuchtende Traktoren / Weihnachtlich geschmückte Schlepper setzen „Lichter der Hoffnung“
.jpg)
Kulmbach. Tannenzweige, Lichterketten, bunt blinkende LEDs in den riesigen Rädern und Nikolausmützen auf den Köpfen der Fahrer: Nachdem die weihnachtlichen Traktorkorsos in den zurückliegenden Jahren bei Groß und Klein auf großen Anklang gestoßen waren, haben sich auch diesmal wieder Bauern aus Kulmbach zusammengetan. Sie haben ihre Schlepper festlich geschmückt und sich am Freitag vor dem zweiten Adventswochenende auf eine Rundfahrt durch die Stadt gemacht.
.jpg) Nach
der Corona-Pandemie und den vielen schlechten
Nachrichten über den Krieg in der Ukraine, die
Explosion der Kosten und einem drohenden
Energienotstand sollen „Lichter der Hoffnung“
gesetzt werden, waren sich die beiden
Hauptorganisatoren Kathrin Erhardt aus Motschenbach
und Stefan Seidel aus Wacholder vom Zusammenschluss
„Eure Kulmbacher Landwirte“ einig. „Wir wollten ein
Stückweit die Landwirtschaft in die Stadt bringen
und dabei eine weihnachtlichen Atmosphäre schaffen“,
so einer der Fahrer. „Wenn es uns dabei gelingt,
dass der eine oder andere etwas intensiver über die
heimischen Bauern nachdenkt, dann haben wir unser
Ziel schon erreicht“, sagt sein Berufskollege.
Nach
der Corona-Pandemie und den vielen schlechten
Nachrichten über den Krieg in der Ukraine, die
Explosion der Kosten und einem drohenden
Energienotstand sollen „Lichter der Hoffnung“
gesetzt werden, waren sich die beiden
Hauptorganisatoren Kathrin Erhardt aus Motschenbach
und Stefan Seidel aus Wacholder vom Zusammenschluss
„Eure Kulmbacher Landwirte“ einig. „Wir wollten ein
Stückweit die Landwirtschaft in die Stadt bringen
und dabei eine weihnachtlichen Atmosphäre schaffen“,
so einer der Fahrer. „Wenn es uns dabei gelingt,
dass der eine oder andere etwas intensiver über die
heimischen Bauern nachdenkt, dann haben wir unser
Ziel schon erreicht“, sagt sein Berufskollege.
.jpg) Die
Landwirte brachten dabei nicht nur Kinderaugen zum
Funkeln. Trotz der kurzfristigen Ankündigung auf
Facebook sowie in den lokalen Medien und trotz
heftigen Schneeregens säumten viele hundert
Schaulustige die Straßen und ließen sich von der
außergewöhnlichen Aktion verzaubern. Ziel war es,
einen vorweihnachtlichen Farbtupfer in die Stadt und
die Landwirtschaft ins Gespräch zu bringen.
Politische Banner gab es nicht. Bei der Fahrt wurde
aber Geld für einen sozialen Zweck gesammelt.
Die
Landwirte brachten dabei nicht nur Kinderaugen zum
Funkeln. Trotz der kurzfristigen Ankündigung auf
Facebook sowie in den lokalen Medien und trotz
heftigen Schneeregens säumten viele hundert
Schaulustige die Straßen und ließen sich von der
außergewöhnlichen Aktion verzaubern. Ziel war es,
einen vorweihnachtlichen Farbtupfer in die Stadt und
die Landwirtschaft ins Gespräch zu bringen.
Politische Banner gab es nicht. Bei der Fahrt wurde
aber Geld für einen sozialen Zweck gesammelt.
Der Traktorkorso war mit ungefähr 40 Fahrzeugen am Milchviehbetrieb von Hermann Grampp in Melkendorf gestartet. Polizei und Feuerwehr sicherten dabei den Konvoi ab. Nach der Fahrt kreuz und quer durch die Innenstadt, unter anderem durch Weiher, über den Holzmarkt und den Zentralparkplatz machten die Schlepper auf dem Parkplatz des Schwimmbades am Rande der Stadt halt. Dort gab es die Gelegenheit, die Fahrzeuge zu fotografieren, mit den Bauern ins Gespräch zu kommen und den Nikolaus höchstpersönlich zu treffen. Außerdem gab es Glühwein, Früchtepunsch, Tee und selbstgebackene Plätzchen für einen guten Zweck. Die Spenden sollen demnächst der Geschwister-Gummi-Stiftung überreicht werden.
Bilder: Einen vorweihnachtlichen Glanzpunkt setzten zahlreiche Landwirte mit ihren Traktorrundfahrten am zweiten Adventssamstag in Kulmbach. Sämtliche Schlepper waren dabei fantasievoll geschmückt und festlich beleuchtet
..jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Rinderzüchter: „Politik gängelt Bauern“ / Kreiszuchtgenossenschaft Bayreuth traf sich zur Jahresversammlung auf dem Betrieb Färber in Forkendorf
.jpg) Bayreuth/Forkendorf.
Kritik an der Landwirtschaftspolitik der
Bundesregierung hat die Vorsitzende der
Kreiszuchtgenossenschaft Bayreuth Christiane Böhm
aus Neuhaus bei der Jahresversammlung geübt.
„Tierhaltung ist in Deutschland nicht mehr
erwünscht“, sagte sie. Anders könne man sich die
andauernden Gängeleien seitens der Politik nicht
erklären. Der Rinderzuchtverband sei für die Zukunft
gut gerüstet. „Wir hoffen allerdings, dass uns die
Politik auch eine Zukunft gibt“, sagte Christiane
Böhm.
Bayreuth/Forkendorf.
Kritik an der Landwirtschaftspolitik der
Bundesregierung hat die Vorsitzende der
Kreiszuchtgenossenschaft Bayreuth Christiane Böhm
aus Neuhaus bei der Jahresversammlung geübt.
„Tierhaltung ist in Deutschland nicht mehr
erwünscht“, sagte sie. Anders könne man sich die
andauernden Gängeleien seitens der Politik nicht
erklären. Der Rinderzuchtverband sei für die Zukunft
gut gerüstet. „Wir hoffen allerdings, dass uns die
Politik auch eine Zukunft gibt“, sagte Christiane
Böhm.
Auffällig viele Landwirte würden derzeit aufgeben. In erster Linie betroffen davon sei der Schweinebereich. Was die Milchviehhaltung und Rinderzucht angeht seien sowohl Milch- als auch Schlachtviehpreise derzeit „in Ordnung“. Allerdings seien auch die Kosten für Energie und Futter explodiert, so dass von den Mehrerlösen kaum noch etwas übrig bleibt. „Vielleicht sollten wir uns so wie die letzte Generation auch irgendwo festkleben, dann hätten wie Bauern wenigstens die notwendige Publicity“, sagte die Vorsitzende.
Ähnlich argumentierte Kreisbäuerin Angelika Seyferth. „Uns werden immer wieder Steine in den Weg gelegt“, sagte sie und nahm vor allem die Medien in die Pflicht. „Es geht auf keine Kuhhaut mehr, was die Medien manchmal veranstalten“, so die Kreisbäuerin. Ähnlich argumentierte Manfred Neumeister, Kreis- und Bezirksrat von den Grünen. 99 Prozent der Landwirte leisteten hervorragende Arbeit, doch über das übrige eine Prozent werde am meisten berichtet, so seine Wahrnehmung. Manfred Neumeister plädierte für mehr Miteinander und rief zu mehr Regionalität auf. Widerspruch kam dagegen von Veterinärdirektor Dr. Kai Braunmiller von der Stadt Bayreuth. Das schlechte Image liege nicht an der Presse, sondern an denen, die keine gute Arbeit machen, sagte er.
.jpg) Oberfrankenweit
sei die Zahl der Betriebe erstmals unter die 1000er
Marke gefallen, sagte der Zuchtleiter des
Rinderzuchtverbandes Oberfranken Markus Schricker.
Mit 968 Betrieben habe die Zahl um 46 abgenommen.
Die Zahl der Kühe lag bei 63.900, das bedeutet 835
weniger als im Vorjahr. Nicht ganz so dramatisch
stellten sich die Zahlen in Stadt und Landkreis
Bayreuth dar. Hier gebe es immer noch 247 Betriebe
(zwölf weniger als im Vorjahr) mit zusammen 18.288
Kühen. Bei der Kuhzahl konnte dabei sogar eine ganz
kleine Steigerung um immerhin 16 Tiere verzeichnet
werden. Was die Vermarktung durch den
Rinderzuchtverband angeht, so seien die Zahlen zwar
gesunken, aber trotzdem immer noch „ganz
ordentlich“. Insgesamt hatte der Rinderzuchtverband
Oberfranken exakt 28.329 Bullen, Kühe, Zucht- und
Nutzkälber im Auftrag seiner Mitglieder vermarktet.
Im Vorjahr waren es noch 30.968.
Oberfrankenweit
sei die Zahl der Betriebe erstmals unter die 1000er
Marke gefallen, sagte der Zuchtleiter des
Rinderzuchtverbandes Oberfranken Markus Schricker.
Mit 968 Betrieben habe die Zahl um 46 abgenommen.
Die Zahl der Kühe lag bei 63.900, das bedeutet 835
weniger als im Vorjahr. Nicht ganz so dramatisch
stellten sich die Zahlen in Stadt und Landkreis
Bayreuth dar. Hier gebe es immer noch 247 Betriebe
(zwölf weniger als im Vorjahr) mit zusammen 18.288
Kühen. Bei der Kuhzahl konnte dabei sogar eine ganz
kleine Steigerung um immerhin 16 Tiere verzeichnet
werden. Was die Vermarktung durch den
Rinderzuchtverband angeht, so seien die Zahlen zwar
gesunken, aber trotzdem immer noch „ganz
ordentlich“. Insgesamt hatte der Rinderzuchtverband
Oberfranken exakt 28.329 Bullen, Kühe, Zucht- und
Nutzkälber im Auftrag seiner Mitglieder vermarktet.
Im Vorjahr waren es noch 30.968.
Bei den Rinderzüchtern ist das Geschäftsjahr nicht identisch mit dem Kalenderjahr. Das Geschäftsjahr des Rinderzuchtverbandes beginnt immer am 1. Oktober und endet am 30. September. Als die Betriebe mit den besten Jahresleitungen wurden die folgenden vier ausgezeichnet: Christian Popp aus Forthof, Martin Bezold aus Gösseldorf, Holger Popp aus Zettlitz und Udo Meister aus Brüderes.
Bei den turnusgemäßen Neuwahlen der Kreiszuchtgenossenschaft Bayreuth wurde Christiane Popp aus Neuhaus einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Neuer zweiter Vorsitzender ist Christian Engelbrecht aus Lankendorf. Er löst Hans Potzel ab, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Als Bayreuther Vertreter für den Milcherzeugerring Oberfranken wurden Christa Lauterbach aus Tressau und Horst Ponfick aus Unterölschnitz gewählt.
.jpg) Vor
ihrer Jahresversammlung hatten die Mitglieder der
Kreiszuchtgenossenschaft den Betrieb der Familie
Färber zwischen Forkendorf und Mistelbach
besichtigt. In dem 2018/2019 gebauten mehrhäusigen
offenen Laufstall sind 90 Kühe zuhause. Michael und
Maike Färber bewirtschaften zusammen mit ihren
Eltern Christine und Peter Färber rund 90 Hektar
Fläche. Mit ihrem modernen dreireihigen
Boxenlaufstall werden sie vor allem dem von der
Gesellschaft immer wieder gefordertem Wunsch nach
mehr Tierwohl gerecht. Die Tiere haben genügend
Platz, können sich aus dem Weg gehen, profitieren
von Licht und Luft und sind allgemein gesünder.
„Euterprobleme oder Probleme mit Nachgeburten gibt
es nicht“, sagt Michael Färber. Kein Problem sei die
offene Bauweise des Stalls: „Die Kühe friert es
nicht, wenn, dann friert es höchstens den Bauern“,
so Michael Färber scherzhaft.
Vor
ihrer Jahresversammlung hatten die Mitglieder der
Kreiszuchtgenossenschaft den Betrieb der Familie
Färber zwischen Forkendorf und Mistelbach
besichtigt. In dem 2018/2019 gebauten mehrhäusigen
offenen Laufstall sind 90 Kühe zuhause. Michael und
Maike Färber bewirtschaften zusammen mit ihren
Eltern Christine und Peter Färber rund 90 Hektar
Fläche. Mit ihrem modernen dreireihigen
Boxenlaufstall werden sie vor allem dem von der
Gesellschaft immer wieder gefordertem Wunsch nach
mehr Tierwohl gerecht. Die Tiere haben genügend
Platz, können sich aus dem Weg gehen, profitieren
von Licht und Luft und sind allgemein gesünder.
„Euterprobleme oder Probleme mit Nachgeburten gibt
es nicht“, sagt Michael Färber. Kein Problem sei die
offene Bauweise des Stalls: „Die Kühe friert es
nicht, wenn, dann friert es höchstens den Bauern“,
so Michael Färber scherzhaft.
Zweites Standbein auf dem Hof der Familie Färber sind die mittlerweile drei Hühnermobile mit zusammen rund 900 Hühnern. Die Vermarktung funktioniert unter anderem in einem kleinen hofeigenen Eierhäuschen, das mit entsprechenden Automaten bestückt ist
Bilder:
1. Die
Mitglieder der Kreiszuchtgenossenschaft Kulmbach
besichtigten im Vorfeld ihrer Jahresversammlung den
Betrieb der Familie Färber zwischen Forkendorf und
Mistelgau.
2. Michael
Färber (rechts) stellte dem Kreis- und Bezirksrat
Manfred Neumeister, der Vorsitzenden der
Kreiszuchtgenossenschaft Christiane Böhm, dem
Zuchtleiter des Rinderzuchtverbandes Markus
Schricker und Veterinärdirektor Dr. Kai Braunmiller
seinen landwirtschaftlichen Betrieb vor.
3. Vorsitzende
Christiane Böhm und Zuchtleiter Markus Schricker
haben Martin Bezold und Holger Popp (von links) als
beste Betriebe nach Jahresleistung ausgezeichnet.
Werbung für Christbäume aus heimischer Produktion / Amt für Landwirtschaft spendierte der Kita Regenbogen einen Frankenwaldbaum

Losau. Nun stehen sie wieder, entlang der großen Straßen, auf Parkplätzen oder vor Supermärkten: Die Christbaumverkäufer. Doch Baum ist nicht gleich Baum. Darauf weist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hin. Zum Start der Christbaumsaison auf der kleinen Plantage von Hermann und Hildegard Geier in Losau bei Rugendorf warb Revierleisterin Anja Mörtlbauer für Christbäume aus heimischer Produktion.
„Es muss ja nicht immer der Baum vom Baumarkt sein, der meist aus Dänemark kommend schon 1000 Kilometer Transportweg hinter sich hat“, sagte die Försterin. Mit beim Saisonstart dabei waren die Kinder der Kita Regenbogen aus Rugendorf. Ihnen spendierte das Amt einen Weihnachtsbaum für die Tagesstätte. Das Besondere an der Aktion war, dass die Kinder den Baum selbst aussuchen und absägen durften, ehe ihn Hermann Geier gut im Netz verpackt in die Einrichtung brachte.
Auf einem Hang oberhalb von Losau baut Hermann Geier seit rund drei Jahrzehnten Christbäume an. Hobbymäßig, wie er sagt. Früher sei die etwa zwei Tagwerk große Fläche reiner Acker gewesen. Zunächst habe er dort Blaufichten angebaut, mittlerweile nur mehr Nordmann-Tannen. „Uns macht das große Freude“, sind sich Hildegard und Hermann Geier einig. Normalerweise versorgen sie Freunde und Bekannte mit den Bäumen. Alle dürften sich ihre Bäumchen vor Ort selbst aussuchen. Neben dem kommissarischen Abteilungsleiter des Landwirtschaftsamtes Simon Stölzel war auch Bürgermeister Gerhard Theuer gekommen, um den Kindern die Vorzüge von heimischen Christbäumen zu erklären und sie für die Belange des Waldes zu sensibilisieren.
Bild: Kindergärtnerin Waltraud Bauer, Simon Stölzel vom Amt für Landwirtschaft, Hermann Geier, Bürgermeister Gerhard Theuer, Hildegard Geier und Anna Mara Kotschenreuther von der Kindertagesstätte (hinten von links) starteten mit den Kindern der Kita Regenbogen in Losau bei Rugendorf die Christbaumsaison.
Gestiegene Erlöse kommen bei den Bauern nicht an / Kreiszuchtgenossenschaft Kulmbach traf sich zur Jahresversammlung auf dem Betrieb Hartmann in Gössenreuth
.jpg) Gössenreuth.
Trotz relativ guter Marktlage investieren die
landwirtschaftlichen Betriebe derzeit so gut wie
nicht. Grund dafür ist, dass von den gestiegenen
Erlösen aufgrund der Kostenexplosionen an allen
Ecken und Enden kaum etwas bei den Bauern ankommt.
Ein weiterer Grund ist die relativ schwierige
politische Landschaft, die den Landwirten keine
Planungssicherheit gibt. Das alles hat auch
Auswirkungen auf Milchviehhalter und Rinderzüchter.
„Die Tierzahlen gehen überall zurück“, sagte der
Vorsitzende der Kreiszuchtgenossenschaft Kulmbach,
Thomas Erlmann aus Waldau, bei der
Mitgliederversammlung in Gössenreuth.
Gössenreuth.
Trotz relativ guter Marktlage investieren die
landwirtschaftlichen Betriebe derzeit so gut wie
nicht. Grund dafür ist, dass von den gestiegenen
Erlösen aufgrund der Kostenexplosionen an allen
Ecken und Enden kaum etwas bei den Bauern ankommt.
Ein weiterer Grund ist die relativ schwierige
politische Landschaft, die den Landwirten keine
Planungssicherheit gibt. Das alles hat auch
Auswirkungen auf Milchviehhalter und Rinderzüchter.
„Die Tierzahlen gehen überall zurück“, sagte der
Vorsitzende der Kreiszuchtgenossenschaft Kulmbach,
Thomas Erlmann aus Waldau, bei der
Mitgliederversammlung in Gössenreuth.
Auf dem gesamten Regierungsbezirk bezogen sei der Rückgang bei Milchkühen und Milchkuhhaltern geradezu dramatisch, so der Zuchtleiter des Rinderzuchtverbandes Oberfranken Markus Schricker. Nicht ganz so eklatant seien die Zahlen im Landkreis Kulmbach zurückgegangen. Oberfrankenweit ist die Zahl der Milchkühe den Worten Schrickers zufolge im zurückliegenden Jahr erstmals unter 80.000 gesunken. „Das ist relativ rapide gegangen“, so der Zuchtleiter. 2019 seien es noch 85.000 gewesen. Entsprechend habe auch die Zahl der Betriebe auf oberfrankenweit auf 1.600 abgenommen. Das bedeute in den zurückliegenden 13 Jahren praktisch eine Halbierung. Oder anders ausgedrückt: „Jedes Jahr hören 50 bis 60 Betriebe auf.“
.jpg) Während
diese Statistik alle landwirtschaftlichen Betriebe
in Oberfranken betrifft, weist der Zuchtverband die
Zahlen der Kreiszuchtgenossenschaften und ihrer
Mitgliedsbetriebe extra aus. Hier sei
oberfrankenweit die 1000er Grenze mit 968 Betrieben
erstmals unterschritten worden. Das sind 46 weniger
als noch im Vorjahr. Die Zahl der Herdbuchkühe liegt
exakt bei 63852, was einen Rückgang um 835 Tieren
gleichkommt. Im Landkreis Kulmbach gibt es immerhin
noch 92 Zuchtbetriebe mit 5945 Kühen. Was die
Vermarktung angeht, so seien die Zahlen zwar
gesunken, aber trotzdem immer noch „ganz
ordentlich“. Insgesamt hatte der Rinderzuchtverband
Oberfranken exakt 28.329 Bullen, Kühe, Zucht- und
Nutzkälber im Auftrag seiner Mitglieder vermarktet.
Im Vorjahr waren es noch 30.968.
Während
diese Statistik alle landwirtschaftlichen Betriebe
in Oberfranken betrifft, weist der Zuchtverband die
Zahlen der Kreiszuchtgenossenschaften und ihrer
Mitgliedsbetriebe extra aus. Hier sei
oberfrankenweit die 1000er Grenze mit 968 Betrieben
erstmals unterschritten worden. Das sind 46 weniger
als noch im Vorjahr. Die Zahl der Herdbuchkühe liegt
exakt bei 63852, was einen Rückgang um 835 Tieren
gleichkommt. Im Landkreis Kulmbach gibt es immerhin
noch 92 Zuchtbetriebe mit 5945 Kühen. Was die
Vermarktung angeht, so seien die Zahlen zwar
gesunken, aber trotzdem immer noch „ganz
ordentlich“. Insgesamt hatte der Rinderzuchtverband
Oberfranken exakt 28.329 Bullen, Kühe, Zucht- und
Nutzkälber im Auftrag seiner Mitglieder vermarktet.
Im Vorjahr waren es noch 30.968.
„Der Milchpreis passt, doch die Kostenstruktur ist eine andere“, sagte der Chef des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach, Harald Weber. Er wies unter anderem darauf hin, dass 47 Prozent der Betriebe im Landkreis Kulmbach weniger als 20 Kühe hätten. Bei den meisten davon gebe es noch Anbindehaltung, was so keine Zukunft mehr hat. „Das heißt, dort steht eine Umstellung bevor“, so der Behördenleiter.
.jpg) Bei
den Rinderzüchtern ist das Geschäftsjahr nicht
identisch mit dem Kalenderjahr. Das Geschäftsjahr
des Rinderzuchtverbandes beginnt immer am 1. Oktober
und endet am 30. September. Als die Betriebe mit den
besten Jahresleitungen wurden die folgenden vier
ausgezeichnet: Thomas Erlwein aus Waldau, Andrea
Meister aus Schlockenau, Stephan Fuchs aus
Gössenreuth und Dietmar Schmidt aus Reuth. Bei den
turnusgemäßen Neuwahlen der Kreiszuchtgenossenschaft
Kulmbach wurde, Thomas Erlmann aus Waldau als erster
und Bernd Schütz aus Dörfles als zweiter
Vorsitzender jeweils einstimmig bestätigt. Dem
Ausschuss, also der erweiterten Vorstandschaft,
gehören künftig Jochen Bär aus Buch am Sand,
Christian Schoberth aus Waldau und Michaela
Eckardt-Hartmann aus Gössenreuth an. Als Kulmbacher
Vertreter für den Milcherzeugerring Oberfranken
wurde Bernd Täuber aus Berndorf gewählt.
Bei
den Rinderzüchtern ist das Geschäftsjahr nicht
identisch mit dem Kalenderjahr. Das Geschäftsjahr
des Rinderzuchtverbandes beginnt immer am 1. Oktober
und endet am 30. September. Als die Betriebe mit den
besten Jahresleitungen wurden die folgenden vier
ausgezeichnet: Thomas Erlwein aus Waldau, Andrea
Meister aus Schlockenau, Stephan Fuchs aus
Gössenreuth und Dietmar Schmidt aus Reuth. Bei den
turnusgemäßen Neuwahlen der Kreiszuchtgenossenschaft
Kulmbach wurde, Thomas Erlmann aus Waldau als erster
und Bernd Schütz aus Dörfles als zweiter
Vorsitzender jeweils einstimmig bestätigt. Dem
Ausschuss, also der erweiterten Vorstandschaft,
gehören künftig Jochen Bär aus Buch am Sand,
Christian Schoberth aus Waldau und Michaela
Eckardt-Hartmann aus Gössenreuth an. Als Kulmbacher
Vertreter für den Milcherzeugerring Oberfranken
wurde Bernd Täuber aus Berndorf gewählt.
Vor ihrer Jahresversammlung hatten die Mitglieder der Kreiszuchtgenossenschaft den Betrieb von Rainer Hartmann in Gössenreuth besichtigt. Das Besondere an dem Betrieb ist, dass er energiemäßig praktisch autark ist. Möglich machen dies eine 80-kW-Photovoltaikkanlage und ein 100-kW-Hackschnitzelheizwerk, mit dem die Familie nicht nur Stallungen, Melkroboter und Wohnhaus, sondern auch die umliegenden Häuser versorgt. „Das Hackschnitzelheizwerk wird vor allem mit dem Holz aus dem eigenen Wald versorgt. Die Familie bewirtschaftet über 26 Hektar Wald in der Umgebung. Auf den übrigen Flächen baut die Familie Wintergerste, Winterweizen, Kleegras und Silomais an. Den ursprünglichen Milchviehstall hatten die Eltern noch 1995/1996 gebaut. Ein erster Anbau kam 2005, ein zweiter 2019 dazu. Gemolken wird mit gleich drei Melkrobotern.
Bilder:
1. Die
Mitglieder der Kreiszuchtgenossenschaft Kulmbach
besichtigten im Vorfeld ihrer Jahresversammlung den
Betrieb von Rainer Hartmann in Gössenreuth bei
Himmelkron.
2. Sie
führen den Milchviehbetrieb in Gössenreuth: Elke und
Rainer Hartmann, Tochter Michaela Eckardt-Hartmann
und Schwiegersohn Christian Eckardt.
3. 150
Milchkühe sind in den Stallungen der Familie
Hartmann in Gössenreuth zuhause.
Brennholz: Vom Massenprodukt zur Mangelware / Genug Holz ist vorhanden, doch es muss erst getrocknet werden
.jpg)
Kulmbach. Die Nachfrage nach Brennholz ist so hoch wie selten. Immer mehr Menschen wollen sich für den Winter eindecken. Brennholz habe sich vom Massenprodukt zur Mangelware entwickelt, heißt es. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn das Holz muss erst lange trocknen.
Bei der Waldbewirtschaftung würden vor allem die schlecht verkäuflichen Holzsortimente als Brennholz verwertet, erläutert die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft in einer Mitteilung. Bei der Holzverarbeitung anfallende Nebenprodukte würden ebenfalls zu einem großen Teil der energetischen Nutzung zugeführt. Weitere Energieholzquellen seien unter anderem Altholz, Flur- und Schwemmholz. Holz werde vor seiner energetischen Verwendung meist noch aufbereitet für schnellere Trocknung und um die Lagerung und Verbrennung zu vereinfachen.
„Ja, die Nachfrage nach Brennholz ist stark gestiegen“, bestätigt Theo Kaiser, der Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach. Problem sei es aber nicht, dass es kein Brennholz mehr gibt. Vielmehr gebe es nur begrenzt getrocknetes Brennholz. Brennholz müsse mindestens einen Sommer im Freien trocknen oder künstlich getrocknet werden. „Hier fehlt es einfach an Vorräten und Kapazitäten“, so der Geschäftsführer. Seinen Worten zufolge liegen die Preise im Augenblick bei 80 bis 90 Euro pro Raummeter für Weichholz und bei 120 bis 150 Euro pro Raummeter für Hartholz. Die Beurteilung der Qualität erfordere vor allem Erfahrung und könne nicht mit wenigen Worten beschrieben werden. Ein Messgerät, auch darauf weist Theo Kaiser hin, gebe es schon für wenige Euro im Baumarkt.
.jpg) Aus
Sicht von Christian Dormann (Bild), dem Vorsitzender
der Waldbesitzervereinigung Hollfeld, zu der auch
viele Kulmbacher Waldbesitzer gehören, besteht in
den urbanen Bereichen durchaus ein Nachfrageüberhang
nach Brennholz. Dahingehend reagierten auch die
Preise. „Allerdings ist meiner Meinung nach in den
ländlichen Regionen genug Brennholz vorhanden um die
aktuelle Nachfrage zu decken“, sagt Dormann. So
zeige ein Blick in Anzeigenplattformen, dass in der
weiteren Region Hollfeld durchaus ein hohes Angebot
da ist. „Wenn die urbanen Käufer bereit sind, 25
Kilometer aufs Land zu fahren um dort Ihr Brennholz
direkt abzuholen und dafür einen realistischen Preis
zu bezahlen sehe ich überhaupt kein Problem.“
Aus
Sicht von Christian Dormann (Bild), dem Vorsitzender
der Waldbesitzervereinigung Hollfeld, zu der auch
viele Kulmbacher Waldbesitzer gehören, besteht in
den urbanen Bereichen durchaus ein Nachfrageüberhang
nach Brennholz. Dahingehend reagierten auch die
Preise. „Allerdings ist meiner Meinung nach in den
ländlichen Regionen genug Brennholz vorhanden um die
aktuelle Nachfrage zu decken“, sagt Dormann. So
zeige ein Blick in Anzeigenplattformen, dass in der
weiteren Region Hollfeld durchaus ein hohes Angebot
da ist. „Wenn die urbanen Käufer bereit sind, 25
Kilometer aufs Land zu fahren um dort Ihr Brennholz
direkt abzuholen und dafür einen realistischen Preis
zu bezahlen sehe ich überhaupt kein Problem.“
Keine Angabe zu den aktuellen Preisen kann Christof Maar, Revierleiter des Forstrevier Kronach vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach machen. Doch auch er weiß von gestiegenen Preisen. Bei den Waldbesitzern, die Brennholz direkt an den Endverbraucher verkaufen, sei das Preisniveau derzeit unterschiedlich. Manche Waldbesitzer, die vom Borkenkäferbefall fortlaufend mit hohen Massenanfällen besonders betroffen sind, hätten ihre Preise kaum erhöht. Andere versuchten höhere Preise zu erzielen, zum Beispiel durch Verkauf in Regionen mit einem höheren Preisniveau. Auch überregionale Abnehmer kauften Brennholzsortimente in letzter Zeit zur erhöhten Preisen aus der Region.
Schon in den letzten Jahren und auch derzeit werde der überwiegende Anteil an Holz, das üblicherweise zu Brennholz verarbeitet werden kann, in andere Regionen verbracht, da hier das Angebot die Nachfrage bei weitem überschreitet.
Einen gesamtüberblick, ob sich die Menschen bereits eingedeckt haben hat Christof Maar nicht. Doch hätten sich sicher viele mit einem Brennholzvorrat, der über mehrere Jahre reichen dürfte eingedeckt. Problem sei aber doch, dass Holz wegen der Feuchtigkeit länger gelagert werden muss, bevor man es als Brennholz verwenden kann. Und wie kann der Laie die Qualität von Brennholz erkennen? Frisch geschlagenes Holz aus dem Wald hat nach den Worten des Fachmanns einen Wassergehalt um die 50 Prozent, vom Borkenkäfer befallenes dürres Holz weniger. Für eine effiziente und emissionsarme Verbrennung müsse Scheitholz auf einen Wassergehalt von unter 20 Prozent herunter getrocknet werden. Bei optimaler Aufbereitung und Lagerung könne dies in einem Lagerzeitraum von etwa einen Jahr erreicht werden. Die erste Bundesimmissionsschutzverordnung untersage außerdem das Verheizen von Holz mit einem Wassergehalt von über 20 Prozent.
Aus dem Oberland für ganz Deutschland: Auf den Plantagen von Uwe Witzgall hat die Ernte der Christbäume begonnen
 Petschen.
„Den Weihnachtsbaum, den gönnt man sich“, sagt Uwe
Witzgall und blickt zuversichtlich auf die
anstehende Saison. In diesen Tagen hat für den
Landwirt aus Petschen, oberhalb von Stadtsteinach
die heiße Phase begonnen. Seit bald zehn Jahren baut
der 52-Jährige auf rund 30 Hektar Fläche
hauptsächlich Nordmanntannen, in geringerer
Stückzahlen auch Nobilis-Tannen, Blaufichten und
Schwarzkiefern, an und beliefert damit Händler in
ganz Deutschland.
Petschen.
„Den Weihnachtsbaum, den gönnt man sich“, sagt Uwe
Witzgall und blickt zuversichtlich auf die
anstehende Saison. In diesen Tagen hat für den
Landwirt aus Petschen, oberhalb von Stadtsteinach
die heiße Phase begonnen. Seit bald zehn Jahren baut
der 52-Jährige auf rund 30 Hektar Fläche
hauptsächlich Nordmanntannen, in geringerer
Stückzahlen auch Nobilis-Tannen, Blaufichten und
Schwarzkiefern, an und beliefert damit Händler in
ganz Deutschland.
Sogar im oberbayerischen Kloster Seeon steht ein Baum aus dem Kulmbacher Land, oder etwa bei Feinkost Käfer in München. Die Bäume sind längst bestellt. In diesen Tagen rollen die Laster zum Transport an. „Als erstes gehen die Bäume für Firmen, Betriebe und Gemeinden raus“, erläutert Uwe Witzgall, der 2013/2014 die Milchviehhaltung aufgegeben hatte und sich fast gänzlich auf die Weihnachtsbäume konzentrierte. Klar, diese Bäume werden ja auch bereits zum ersten Advent aufgestellt, und der ist extrem früh bereits am 27. November.
Fünf festangestellte Mitarbeiter hat Uwe Witzgall und noch eine Saisonkraft, die in diesen Tagen alles geben müssen. Sie wohnen bis zum Weihnachtsfest sogar in Petschen. „Fast alle sind seit vielen Jahren hier“, sagt der Landwirt aus dem Oberland. Einer sei bereits seit der Grenzöffnung jedes Jahr in Petschen bei der Ernte mit dabei. Und in Spitzenzeiten wird die ganze Familie eingespannt. Ob Patenkind oder Schwager, sie alle verbringen ihre freie Zeit auf dem Hof, der sich direkt auf der Fränkischen Linie auf rund 540 Meter über Normalnull befindet. An die 800 Bäume sind es, die derzeit pro Tag geerntet werden. Im Schnitt sind sie so sechs bis zehn Jahre alt.
Gute Nachrichten hat Uwe Witzgall für alle Kunden. Zum einen werde es, ganz entgegen dem Trend, keine wesentlichen Preiserhöhungen geben, zum anderen seien trotz der extremen Trockenheit in diesem Sommer, genügend Bäume vorhanden. Ein wenig hätten die Bäume schon gelitten, doch gerade der Regen im zurückliegenden Herbst habe einiges wieder gut gemacht. „Die Nordmanntanne ist aber auch extrem widerstandsfähig, sagt er. Die Ausfälle durch die Trockenheit beziffert Uwe Witzgall auf knapp 20 Prozent. Kein Problem sei dagegen der Borkenkäfer, weil die Nordmann-Tanne ein Pfahlwurzler ist, den der Käfer in der Regel links liegen lässt.
Um sich von der Billigkonkurrenz der Baumärkte abzugrenzen, legt Uwe Witzgall allergrößten Wert auf Qualität. Das beweist schon die Tatsache, dass in der Regel rund ein Fünftel aller Bäume als Ausschuss eingestuft und als Schnittgrün vermarktet werden. „Schrott geben wir nicht raus“, macht Uwe Witzgall unmissverständlich klar und ist fest davon überzeugt: Wer einmal einen Qualitätsbaum aus seinen Plantagen hat, der kommt immer wieder. Qualitätsbaum heißt, dass alle Bäume aus Petschen seit 2018 das Siegel „geprüfte Qualität Bayern” tragen dürfen. Das Gütesiegel besagt, dass festgelegte Produktionskriterien eingehalten und auch regelmäßig kontrolliert werden. Dazu gehört zum Beispiel ein später Schnittzeitpunkt ab dem 15. November. Außerdem wurde der Betrieb nach den Standards von GLOBAL G.A.P. zertifiziert, was die Erfüllung noch höherer Standards bedeutet. Sie beginnen von der Anpflanzung über die Produktion bis hin zur Ernte, praktisch in allen Bereichen.
Einen Trend kann Uwe Witzgall aber doch feststellen: viele Abnehmer hätten bereits angekündigt, dass sie heuer aus Energiespargründen zwar nicht auf den Baum, aber auf die Beleuchtung verzichten. Vor allem in den Ämter, aber das kann dem Baumproduzenten egal sein. Freilich wurde auch er von der Preisexplosion getroffen, vor allem beim Dünger. Auch die Lastwagen und Schlepper brauchen ihren Diesel und sogar die Netze seien um 20 Prozent teurer geworden. Für das kommende Jahr werde er die Preise wohl nicht halten können und die Händler vor Ort stellten sich ja auch nicht umsonst hin. Er selbst bezahlt seine Mitarbeiter schon längst über den Mindestlohn.
Einen Tipp hat Uwe Witzgall für alle Christbaumbesitzer: „Der gekaufte Baum sollte drei Wochen schattig und im Freien liegen, dann hält er am längsten“. In der Wohnung sollte anschließend ein kleines Stück abgesägt und der Ständer mit Wasser gefüllt werden. So hat man am längsten seine Freude an den Weihnachtsbäumen aus dem Frankenwald. Als weiteren Trend hat er beobachtet, dass viele Menschen ihren Baum bereits während der Adventszeit aufstellen und schmücken. Nicht erst am Heiligen Abend, so wie früher.
Wer Lust hat, sich seinen Baum selbst auszusuchen und eventuell sogar selbst zu schlagen, der kann am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende, jeweils Samstag und Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr nach Petschen kommen und sich seinen Baum direkt beim Produzenten kaufen. Ansonsten gibt es Verkaufsstände mit den Bäumen von Uwe Witzgall in Kulmbach am Eulenhof bei Samen Hühnlein, aber unter anderem auch in Himmelkron, Stammbach, Wonsees und sogar in der Ludwigstraße am Rathausbrunnen in Hof.
Bild: Uwe Witzgall (links) und seine Mannschaft hat in diesen Tagen mit der Ernte auf den Christbaumplantagen im Oberland begonnen.
„Waldkontroversen“: Verbauen, verbrennen oder verrotten / Fachleute sagen bei Tagung an der Uni Bayreuth dem Holz eine große Zukunft voraus
.jpg) Bayreuth.
Hoffnungsträger Holz: Hinter diesem Titel der
„Waldkontroversen 2022“ an der Universität stand
nicht etwa ein Fragezeichen. Im Gegenteil: Sämtliche
Referenten berichteten von Steigerungen, bei den
Holzvorräten in deutschen Wäldern, beim Einschlag,
bei der Nachfrage nach Bauholz und nach Brennholz.
Bei den „Waldkontroversen“ handelt es sich um eine
Tagung, die vom Bayreuther Zentrum für Ökologie und
Umweltforschung, von der Campus-Akademie für
Weiterbildung und dem Ökologisch-Botanischen Garten
an der Universität veranstaltet wurde. Im Auditorium
saßen dabei nicht nur Studenten und Wissenschaftler,
sondern auch Waldbesitzer, Vertreter der staatlichen
Forstverwaltung, des Naturschutzes und des
Bausektors.
Bayreuth.
Hoffnungsträger Holz: Hinter diesem Titel der
„Waldkontroversen 2022“ an der Universität stand
nicht etwa ein Fragezeichen. Im Gegenteil: Sämtliche
Referenten berichteten von Steigerungen, bei den
Holzvorräten in deutschen Wäldern, beim Einschlag,
bei der Nachfrage nach Bauholz und nach Brennholz.
Bei den „Waldkontroversen“ handelt es sich um eine
Tagung, die vom Bayreuther Zentrum für Ökologie und
Umweltforschung, von der Campus-Akademie für
Weiterbildung und dem Ökologisch-Botanischen Garten
an der Universität veranstaltet wurde. Im Auditorium
saßen dabei nicht nur Studenten und Wissenschaftler,
sondern auch Waldbesitzer, Vertreter der staatlichen
Forstverwaltung, des Naturschutzes und des
Bausektors.
„Holz ist unerlässlich, gestern heute und morgen, brachte es Tobias Götz auf den Punkt. Der Chef der Pirmin Jung GmbH aus Remagen, Deutschlands größtem Planungsbüro, das sich mit Holz beschäftigt, sprach gar von einer Renaissance des Baustoffes Holz. So neu ist das alles allerdings gar nicht. „Holz ist der älteste Baustoff, der sich seit Jahrhunderten bewährt hat“, sagte Tobias Götz und zeigte viele Bilder von Fachwerkbauten aus vergangenen Jahrhunderten.
_goetz.jpg) Jetzt,
wo der Klimawandel direkt vor unserer Haustür
ankommt, habe man Holz endlich wieder als Baustoff
entdeckt. Holzneubauten, wie ein 13-geschossiges
Hochhaus in Amsterdam oder ein 15-geschossiges
Hochhaus in der Schweiz stellten eindrucksvoll unter
Beweis, dass sich Fichte, Tanne und viele andere
Baumarten nicht vor Beton verstecken müssen. Viele
Bauherren hätten die Vorteile des Holzes längst
erkannt, sagte Tobias Götz. Die problemlose
Erfüllung sämtlicher Umweltauflagen und die extrem
genaue Planbarkeit gehörten genauso dazu, wie die
Stabilität, das geringe Eigengewicht und natürlich
die Tatsache, dass es sich um einen nachwachsenden
Rohstoff handelt.
Jetzt,
wo der Klimawandel direkt vor unserer Haustür
ankommt, habe man Holz endlich wieder als Baustoff
entdeckt. Holzneubauten, wie ein 13-geschossiges
Hochhaus in Amsterdam oder ein 15-geschossiges
Hochhaus in der Schweiz stellten eindrucksvoll unter
Beweis, dass sich Fichte, Tanne und viele andere
Baumarten nicht vor Beton verstecken müssen. Viele
Bauherren hätten die Vorteile des Holzes längst
erkannt, sagte Tobias Götz. Die problemlose
Erfüllung sämtlicher Umweltauflagen und die extrem
genaue Planbarkeit gehörten genauso dazu, wie die
Stabilität, das geringe Eigengewicht und natürlich
die Tatsache, dass es sich um einen nachwachsenden
Rohstoff handelt.
Verbauen, verbrennen oder verrotten: Gregor Aas, der Leiter des Ökologisch-Botanischen Gartens an der Universität Bayreuth hatte hinter dem Untertitel der „Waldkontroversen“ noch ein Fragezeichen gesetzt. Eine eindeutige Antwort gab es freilich nicht, doch die Marschrichtung war klar: „Holz ist eine unglaublich wertvolle, vielfach nutzbare und zunehmend begehrte Ressource“, so Gregor Aas.
Pia Bradler und Clarissa Schmelzle, Studentinnen im Master Global Change Ecology, hatten jede Menge Daten und Fakten zusammengetragen, die sie den Teilnehmern präsentierten. Wichtigste Aussage: Der Gesamtverbrauch an Holz in Deutschland ist aktuell größer als die Inlandsproduktion. Während bundesweit knapp 83 Millionen Festmeter Holz pro Jahr in Deutschland eingeschlagen werden, liege der Verbrauch derzeit bei über 127 Millionen Kubikmeter. Der Holzeinschlag nehme aktuell deutlich zu, waren sich die beiden Studentinnen einig. Sie prognostizierten eine weiter steigende Nachfrage nach Bauholz genauso wie nach Brennholz. Bei letzterem sei die Situation besonders dynamisch, wie ein Blick auf den Preis zeigt: Während der Raummeter Buchenholz noch vor Monaten bei 60 bis 80 Euro lag, sei er aktuell bei einem Discounter für sage und schreibe 489 Euro angepriesen worden.
Am zweiten Tag der „Waldkontroversen“ gab es zwei interessante Exkursionen: Geschäftsleiter Wolf-Christian Küspert zeigte den Teilnehmern die GELO-Timber GmbH im Energiepark Wunsiedel. Dort wurden Ansätze der Kreislaufwirtschaft beim Nadelholz aus der Region diskutiert, angefangen vom Schwachholzsägewerk über die WUN Pellet GmbH bis hin zum Leuchtturmprojekt „Wunsiedler Weg“ mit dezentraler Energieversorgung und Wasserstoffhydrolyse. Das Heizwerk des 2021 in Betrieb gegangenen neuen Sägewerks GELO-Timber kann dank eines Zweigasbrenners sowohl mit Erdgas, als auch zukünftig mit Wasserstoff betrieben werden.
Carmen Hombach, Stadtförsterin und Vorsitzende der Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach, startete mit den Teilnehmern zu einem Rundgang durch Schadflächen und Waldumbaumaßnahmen im Bereich der WBV Die Wälder im Frankenwald waren von dem trockenen Sommer und den Käferschäden besonders stark betroffen.
Bilder:
1. Hier
im Frankenwald oberhalb von Stadtsteinach wird
gerade jede Menge Holz eingeschlagen.
2. „Holz
ist unerlässlich, gestern, heute, morgen“: Tobias
Götz, Zimmermann, Bauingenieur und Chef von Pirmin
Jung, Deutschlands größtes Planungsbüro in Sachen
Holz.
Keine CO2-Abgabe auf Holz / Waldbesitzer prangern geplante Energien-Richtlinie der EU an - MdL Martin Schöffel bei der WBV Kulmbach/Stadtsteinach
Oberdornlach. Nach dem Willen der Europäischen Union soll Holz künftig nicht mehr nachhaltig sein. Bei der Informationsveranstaltung der Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach in Oberdornlach sorgten die Pläne der EU für Verwunderung und Kopfschütteln. „Das ist für normal denkende Menschen nicht zu fassen“, sagte die Vorsitzende Carmen Hombach. Doch die Erneuerbare Energien-Richtlinie der EU soll dem Holz tatsächlich seine Nachhaltigkeit absprechen.
In diesem Vorgehen stecke eine ganz große Gefahr, sagte Carmen Hombach. Gehen die Pläne so durch, würden nicht nur bestimmte Förderungen wegfallen, auch müsste auf Holz künftig, genauso wie bei Öl oder Gas, die CO2-Abgabe geleistet werden, obwohl Holz ja bekanntlich CO2 speichert. „Man könnte fast sagen, sie wissen nicht, was sie tun“, so die Vorsitzende. Nun könne man nur noch hoffen, dass dies alles nicht so kommt.
Der Landtagsabgeordnete Martin Schöffel (CSU) nannte die Pläne ein Alarmsignal. Im Bereich der energetischen Nutzung von Holz müsse mehr, und nicht weniger gemacht werden. Derartige Ideen könnten nur von Leuten kommen, die in ihrem Leben weder einen Baum gepflanzt, noch einen Wald bewirtschaftet haben. „Wenn ein Baum verbrannt wird, dann wird nicht mehr CO2 freigesetzt, als der Baum vorher gebunden hat.“
Ziel der bayerischen Forstpolitik werde es deshalb sein, die Holznutzung zu erhöhen. „Wenn wir den Waldumbau weiter betreiben wollen, müssen wir die Holznutzung nach oben fahren“, sagte der Abgeordnete. Schöffel versprach, sich massiv gegen eine CO2-Abgabe zu stemmen. Das seien Entwicklungen, die in die völlig falsche Richtung gehen.
Schöffel beklagte ganz allgemein den Einzug alter Ideologien und neuer gefährlicher Entwicklungen in die Politik. Im Mittelpunkt des europäischen Green Deals sollen Artenvielfalt und Klimaschutz stehen. Doch viele aktuelle politischen Vorhaben und Entscheidungen stünden diesem Ziel entgegen und enthielten grundsätzliche Webfehler.
„Irgendwo muss jetzt mal Schluss sein“, forderte Martin Schöffel und prangerte besonders die geplanten Stilllegungen landwirtschaftlicher Flächen an. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen könne man doch nicht auf weniger Produktion und mehr Importe setzen. Stattdessen sollten Eigenversorgung und Ernährungssicherheit im Mittelpunkt stehen
Im Wald bezeichnete der Parlamentarier die Stilllegungen ohnehin als den „größten Blödsinn“. Ein vernünftiger Waldumbau werde nur mit Waldbewirtschaftung funktionieren. Holz müsse gerodet werden, sonst verfault es, sagte Martin Schöffel. Zur Bewirtschaftung gehöre auch der Einsatz von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln. „Weniger Produktion und Verbote von Pflanzenschutzmittel, das kommt meiner Meinung nach einer Enteignung gleich“, fand Martin Schöffel klare Worte.
Wie bedeutsam der Wald als CO2-Speicher ist, machte WBV-Geschäftsführer Theo Kaiser am folgenden Beispiel deutlich: So speichere jedes Hektar Wald rund 13 Tonnen CO2 pro Jahr. Einen bedeutsamen Beitrag zur Wiederbewaldung müssten aber auch die Jäger leisten, so die Vorsitzende Carmen Hombach. „Die Jäger müssen diesen Weg mitgehen“, sagte sie. Mittlerweile sei das Rehwild nicht einmal mehr auf den Wiesen anzutreffen, sondern bleibe gleich in den Verjüngungen, weil sich dort ein gedeckter Tisch bietet. Um die Abschusszahlen zu steigern sei auch die Vermarktung des Wildbrets von Bedeutung. „Kein Jäger wird rausgehen, wenn die Kühltruhen voll und die Nachfrage gering ist.“ Carmen Hombach sprach sich dafür aus, entsprechende Vermarktungsoffensiven ins Leben zu rufen.Bauern sehen rot / „Landwirte werden unter Sippenhaft gestellt“ - Demo beim Besuch von Ministerpräsident Söder in Mechlenreuth
.jpg) Mechlenreuth.
Über 100 Landwirte aus ganz Oberfranken haben am
Donnerstag in Mechlenreuth bei Münchberg gegen die
stark vergrößerten „Roten Gebiete“ demonstriert. Die
Neuabgrenzung macht den Bauern aufgrund zahlreicher
Auflagen das Wirtschaften auf den betreffenden
Flächen praktisch unmöglich. In Mechlenreuth fand
zeitgleich die offizielle Einweihung eines
Teilabschnitts des Ostbayernrings durch den
bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder statt.
Mechlenreuth.
Über 100 Landwirte aus ganz Oberfranken haben am
Donnerstag in Mechlenreuth bei Münchberg gegen die
stark vergrößerten „Roten Gebiete“ demonstriert. Die
Neuabgrenzung macht den Bauern aufgrund zahlreicher
Auflagen das Wirtschaften auf den betreffenden
Flächen praktisch unmöglich. In Mechlenreuth fand
zeitgleich die offizielle Einweihung eines
Teilabschnitts des Ostbayernrings durch den
bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder statt.
In roten Ganzkörperoveralls und mit zahlreichen Transparenten machten die Bauern auf der Zufahrtsstraße ihrem Unmut Luft. „Wer Bauern quält, wir abgewählt“, stand unter anderem auf den Transparenten zu lesen. Die Fahrzeugkolonne mit dem Ministerpräsidenten hielt kurz an und Söder hörte sich für wenige Minuten die Probleme der Bauern an. Er versprach ihnen für die kommenden zwei Wochen eine Art Runden Tisch zusammen mit Umweltministerium und Bauernverband. Dort soll das Thema noch einmal aufgegriffen werden.
.jpg) Nach
der Veröffentlichung des entsprechenden
Kartenmaterials steht nach den Worten des
oberfränkischen BBV-Bezirkspräsidenten Hermann Greif
fest: Bisher seien 25 Prozent der bayerischen
Flächen in den „Roten Gebieten“ gewesen, dann nach
der sogenannten „Binnendifferenzierung“ und
„Modellierung“ nur noch zwölf Prozent. Da sei aber
immer noch kein Trost für alle, die von den „Roten
Gebieten“ betroffen sind.
Nach
der Veröffentlichung des entsprechenden
Kartenmaterials steht nach den Worten des
oberfränkischen BBV-Bezirkspräsidenten Hermann Greif
fest: Bisher seien 25 Prozent der bayerischen
Flächen in den „Roten Gebieten“ gewesen, dann nach
der sogenannten „Binnendifferenzierung“ und
„Modellierung“ nur noch zwölf Prozent. Da sei aber
immer noch kein Trost für alle, die von den „Roten
Gebieten“ betroffen sind.
Im Gegenteil: Die zwölf Prozent hätten der Europäischen Union nicht ausgereicht, so dass nachjustiert wurde. Ämter und Ministerien hätten die betroffenen Flächen aktuell wieder auf 17 Prozent angehoben. Dabei habe es insbesondere auch die Bauern im Landkreis Hof heftig erwischt. „Unser Problem ist jetzt, dass man uns faktisch unter Sippenhaft nimmt“, sagte Greif. Betriebe, die umweltfreundlich wirtschaften, müssten von der Verordnung ausgenommen werden. Während die EU dies auch zulasse, weigere sich Deutschland, Betriebe raus zu nehmen.
.jpg) Die
Demo richte sich nicht gegen den bayerischen
Ministerpräsidenten, so Greif. „Wir wollen uns nur
bemerkbar machen und fordern Unterstützung von Seite
der heimischen Politik.“ Die Einordnung in Rote
Gebiete müsse definitiv noch einmal überprüft
werden. Wenn es um Phosphat oder Nitrat geht, gebe
es ja schließlich auch andere Einflüsse, als die
Landwirtschaft. Auch die sollten miteinbezogen
werden.
Die
Demo richte sich nicht gegen den bayerischen
Ministerpräsidenten, so Greif. „Wir wollen uns nur
bemerkbar machen und fordern Unterstützung von Seite
der heimischen Politik.“ Die Einordnung in Rote
Gebiete müsse definitiv noch einmal überprüft
werden. Wenn es um Phosphat oder Nitrat geht, gebe
es ja schließlich auch andere Einflüsse, als die
Landwirtschaft. Auch die sollten miteinbezogen
werden.
Als „allergrößten Hammer“ bezeichnete es der BBV-Bezirkspräsident, dass die Gebietsabgrenzung auch teilweise in die Städte hineinreicht. Dort seien beispielsweise auch Golfplätze betroffen, die aber von Auflagen ausgenommen wurden, also auch weiterhin ihre Flächen düngen dürfen. Greif: „Das geht so nicht weiter, da müssen wir dagegen halten.
„Wir werden in Sippenhaft genommen, für etwas, wofür wir nichts können“, sagte der oberfränkische BBV-Vizepräsident Michael Bienlein. Viele Bauern seien in ihrer Existenz gefährdet. „Wir wollen doch auch weiterhin Nahrungsmittel für unsere Mitmenschen produzieren.“ Für die Neuausweisung fehlten jegliche Grundlagen. Doch die Einsicht in die entsprechenden Messungen werde den Landwirten derzeit verwehrt.
.jpg) Ministerpräsident
Söder sagte den Landwirten zeitnah eine Runde mit
Vertretern des Umweltministeriums und dem Präsidium
des Bauernverbandes zu. „Wir müssen schauen, dass
wir einen Weg finden“, sagte Söder. Man habe bewusst
die erste Karte der Roten Gebiete zurückgestellt, um
die Betroffenheit zu verhindern. Dort wo wenig
Wasser ist, sei die Frage der Nitratwerte schneller
ein Thema, weil die Verdünnungswirkung schlechter
ist. Unabhängig davon, dass im Fränkischen aufgrund
der Trockenheit auch Wasser benötigt werde, müssten
auch hier weiterhin Nahrungsmittel produzieren
werden können. „Ich setze mich ja nicht dafür ein,
dass wir Flächen nicht mehr stilllegen, um mehr
Nahrungsmittel produzieren zu können, wenn wir
gleichzeitig die Flächen nicht nutzen können.“
Ministerpräsident
Söder sagte den Landwirten zeitnah eine Runde mit
Vertretern des Umweltministeriums und dem Präsidium
des Bauernverbandes zu. „Wir müssen schauen, dass
wir einen Weg finden“, sagte Söder. Man habe bewusst
die erste Karte der Roten Gebiete zurückgestellt, um
die Betroffenheit zu verhindern. Dort wo wenig
Wasser ist, sei die Frage der Nitratwerte schneller
ein Thema, weil die Verdünnungswirkung schlechter
ist. Unabhängig davon, dass im Fränkischen aufgrund
der Trockenheit auch Wasser benötigt werde, müssten
auch hier weiterhin Nahrungsmittel produzieren
werden können. „Ich setze mich ja nicht dafür ein,
dass wir Flächen nicht mehr stilllegen, um mehr
Nahrungsmittel produzieren zu können, wenn wir
gleichzeitig die Flächen nicht nutzen können.“
Bilder: Der bayerische Ministerpräsident sprach am Rande der Einweihung eines Ostbayernring-Teilstücks in Mechlenreuth bei Münchberg mit Landwirten aus Oberfranken. In rote Ganzkörperanzüge gehüllt, protestierten die Bauern gegen die Neuabgrenzung der „Roten Gebiete“.
Altes Haus - Neuer Stall / Ferkelaufzucht, Mast, Wirtshaus und Ferienwohnungen: Wo andere zusperren haben Katrin und Rainer Markstein kräftig investiert
.jpg) Gumpertsreuth.
Geplant war das alles so nicht, wie es schließlich
gekommen ist. Doch Katrin und Rainer Markstein aus
Gumpertsreuth bei Gattendorf im Landkreis Hof sind
fest überzeugt, den richtigen Weg gegangen zu sein.
Während Schweinehalter landauf landab aufgeben, hat
die Familie am Rande der Ortschaft mit einem
Investitionsvolumen von rund einer Million Euro
einen nagelneuen Schweinestall mit 750 Mastplätzen
errichtet. Die Strohschweine werden hauptsächlich an
zwei größere Metzgereibetriebe in Selb und Dörnthal
vermarktet. Ein weiterer Teil bleibt sozusagen auf
dem Hof und kommt in der eigenen Gastwirtschaft mit
dem Namen „Altes Haus“ auf den Tisch.
Gumpertsreuth.
Geplant war das alles so nicht, wie es schließlich
gekommen ist. Doch Katrin und Rainer Markstein aus
Gumpertsreuth bei Gattendorf im Landkreis Hof sind
fest überzeugt, den richtigen Weg gegangen zu sein.
Während Schweinehalter landauf landab aufgeben, hat
die Familie am Rande der Ortschaft mit einem
Investitionsvolumen von rund einer Million Euro
einen nagelneuen Schweinestall mit 750 Mastplätzen
errichtet. Die Strohschweine werden hauptsächlich an
zwei größere Metzgereibetriebe in Selb und Dörnthal
vermarktet. Ein weiterer Teil bleibt sozusagen auf
dem Hof und kommt in der eigenen Gastwirtschaft mit
dem Namen „Altes Haus“ auf den Tisch.
Lange Jahre wurde der Hof im Nebenerwerb bewirtschaftet. 1995 hatte Rainer Markstein von seinen Eltern übernommen. Der heute 50-Jährige war zuletzt als Kfz-Meister bei den Hofer Stadtwerken beschäftigt, Ehefrau Katrin ist gelernte Bäckerin. „Ein zweites Standbein wollten wir schon immer“, sagt Rainer. So kam das Paar auf die Idee in einem alten Gebäude des Vierseithofes ein Café einzurichten. Als man im Jahr 2015 mit den Umbauarbeiten begann, war noch nicht abzusehen, dass daraus einmal eine Art Geheimtipp im Hofer Land entstehen würde.
.jpg) „Wir
haben damals alles eingeschmissen“, sagt Rainer. Nur
die Außenwände und die Zwischendecken hätten noch
existiert. Dank der immensen Eigenleistung der
Familie mit ihren vier Kindern im Alter zwischen
sieben und 21 Jahren konnte das „Alte Haus“ schon im
Januar 2016 eröffnen, vom Café war man inzwischen
abgekommen und es wurde ein richtiges Dorfwirtshaus
daraus. Schon damals hatte Rainer Mut bewiesen, als
er seine Festanstellung im öffentlichen Dienst gegen
die Selbständigkeit eintauschte.
„Wir
haben damals alles eingeschmissen“, sagt Rainer. Nur
die Außenwände und die Zwischendecken hätten noch
existiert. Dank der immensen Eigenleistung der
Familie mit ihren vier Kindern im Alter zwischen
sieben und 21 Jahren konnte das „Alte Haus“ schon im
Januar 2016 eröffnen, vom Café war man inzwischen
abgekommen und es wurde ein richtiges Dorfwirtshaus
daraus. Schon damals hatte Rainer Mut bewiesen, als
er seine Festanstellung im öffentlichen Dienst gegen
die Selbständigkeit eintauschte.
Der Erfolg gab der Familie Recht. Während andere Gaststätten ringsum zusperrten, wurden die Marksteins regelrecht überrannt. „Das hat eingeschlagen, wie eine Bombe“, so Katrin. In der Regel haben sie drei Tage in der Woche offen, Donnerstag und Freitag mit Abendkarte, Sonntag zum Mittagstisch und nachmittags zu Kaffee und Kuchen. Samstags finden meist geschlossene Veranstaltungen statt, mittwochs gibt es einmal im Monat einen Pizzatag, ein anderes Mal steht die Schlachtschüssel auf dem Plan. Zehn Mitarbeiter beschäftigt die Familie im Service, drei weitere in der Küche, alle auf geringfügiger Basis.
Im alten Stall unmittelbar an der Hofstelle mit Platz für 400 Schweine werden mittlerweile die Ferkel aufgezogen, ehe sie in den neuen Maststall wechseln. Dort wachsen die Schweine innerhalb von vier Monaten auf rund 140 Kilogramm heran. Rainer Markstein fährt die Tiere mit dem eigenen Lkw in den Hofer, beziehungsweise in den Helmbrechtser Schlachthof. Das Fleisch wird in die Traditionsmetzgerei Sandner nach Selb und in die Landmetzgerei Strobel nach Dörnthal bei Selbitz geliefert. „Eine Win-Win-Situation“, wie Rainer sagt. Auf die beiden Betriebe könne man sich verlassen. „Wir arbeiten Hand in Hand zusammen“. Das Fleisch hat aufgrund des hohen Rohfaseranteils, der verfüttert wird, keinerlei Wassereinlagerungen. Außerdem haben die Strohschweine mehr Zeit zum „Reifen“ als Tiere aus konventioneller Haltung.
.jpg) Der
neue Offenfrontstall auf der grünen Wiese vor den
Toren des Dorfes ist 60 mal 16 Meter groß. Direkt
daneben wurde eine eigene Technikhalle errichtet.
Bei der Einweihung vor wenigen Wochen waren rund
1000 Besucher gekommen. „Mit einem solchen Ansturm
hätten wir nie gerechnet“, sagen beide.
Der
neue Offenfrontstall auf der grünen Wiese vor den
Toren des Dorfes ist 60 mal 16 Meter groß. Direkt
daneben wurde eine eigene Technikhalle errichtet.
Bei der Einweihung vor wenigen Wochen waren rund
1000 Besucher gekommen. „Mit einem solchen Ansturm
hätten wir nie gerechnet“, sagen beide.
Daneben bewirtschaften die Marksteins noch 60 Hektar Flächen und 25 Hektar Wald. Angebaut werden Sommer- und Wintergerste, Erbsen und Weizen, ausschließlich zum Eigenbedarf. Und noch ein weiteres Standbein gibt es: über den Gasträumen wurden zwei schmucke, 80, beziehungsweise 85 Quadratmeter große Ferienwohnungen eingerichtet.
„Es ist nicht schlecht, wenn man mehrere Standbeine hat“, ist sich das Paar einig. Vor allem die Corona-Zeit hat den beiden schwere zu schaffen gemacht. „Mit Corona ist alles anders geworden“, so Katrin. Vielen politischen Entscheidungen in Sachen Pandemie stehen die beiden kritisch gegenüber. Nicht nur wirtschaftliche, auch innerhalb der Gesellschaft sei vieles unwiderruflich kaputt gegangen.
Bilder:
1. "Auf
der grünen Wiese" am Ortsrand von Gumpertsreuth hat
die Familie Markstein einen neuen Stall errichtet.
2.
Hier fühlen sich die Strohschweine wohl. Das Fleisch
kann in Ruhe heranreifen.
3. Rainer und Katrin Markstein (rechts) mit ihren
vier Kindern.
Ernährungssicherheit im Focus / Scharfe Kritik an Bund und EU beim Königsfelder Jurabauerntag
.jpg) Königsfeld.
Als „unverantwortlich, ideologisch und gegen das
eigene Volk gerichtet“ hat Martin Schöffel,
Landtagsabgeordneter aus Wunsiedel und Vorsitzender
des CSU-Arbeitskreises Landwirtschaft, die Politik
der Bundesregierung kritisiert. „Wir dürfen bei der
Nahrungsmittelversorgung auf keinen Fall im eine
ähnliche Situation kommen, wie bei der Energie“,
sagte Schöffel beim Königsfelder Jurabauerntag.
Königsfeld.
Als „unverantwortlich, ideologisch und gegen das
eigene Volk gerichtet“ hat Martin Schöffel,
Landtagsabgeordneter aus Wunsiedel und Vorsitzender
des CSU-Arbeitskreises Landwirtschaft, die Politik
der Bundesregierung kritisiert. „Wir dürfen bei der
Nahrungsmittelversorgung auf keinen Fall im eine
ähnliche Situation kommen, wie bei der Energie“,
sagte Schöffel beim Königsfelder Jurabauerntag.
Zum einen profitierten die Bauern mit Ausnahme des Schweinebereichs von der weltweit aktuell riesigen Nachfrage nach Lebensmitteln durch höhere Erzeugerpreise. Zum anderen stünden Auflagen im Raum, die man sich jetzt nicht leisten könne und dürfe. Die geforderten Flächenstilllegungen gehörten genauso dazu, wie das drohende Verbot von Pflanzenschutzmitteln in sensiblen Gebieten. „In einer Zeit von Dürren, Inflation, Unsicherheiten und Krisen auf der ganzen Welt muss es darum gehen, Sicherheit bei der Ernährung herzustellen“, so Schöffel.
Vor allem die Vorschläge des stellvertretenden EU-Kommissionspräsidenten Frans Timmermans ernteten bei Schöffel Kritik. Die Stilllegungspläne würden bedeuten, dass die Produktion hierzulande um 20 Prozent zurückgehen würde und Deutschland auf Importe aus dem Ausland angewiesen sei. „Wer so etwas fordert, der hat den Schlag noch nicht gehört“, sagte Schöffel und forderte die Bauern dazu auf, Timmermans zu stoppen.
Auch in den Wäldern dürfe es keine Stilllegungen geben. „Wir wollen keine Wildnis“, sagte Schöffel. Bewirtschaftete Wälder hätten erwiesenermaßen die gleiche Artenvielfalt aufzuweisen, wie unbewirtschaftete Wälder. „Wir geben unsere Heimat nicht auf und lassen uns nicht alles kaputt machen“, so der Referent.
.jpg) Trotz
aller Krisen und Herausforderungen freute sich der
neue Kreisobmann Tobias Kemmer, dass der
Königsfelder Jurabauerntag nach drei Jahren Pause
überhaupt wieder stattfinden könne. Bei allen
Schwierigkeiten sollte man sich auch über fruchtbare
Böden und regionale Lebensmittel freuen. Gleichwohl
hätten im Bamberger Land besonders der Mais, die
Sonnenblumen, Zuckerrüben und Soja unter der
anhaltenden Trockenheit gelitten.
Trotz
aller Krisen und Herausforderungen freute sich der
neue Kreisobmann Tobias Kemmer, dass der
Königsfelder Jurabauerntag nach drei Jahren Pause
überhaupt wieder stattfinden könne. Bei allen
Schwierigkeiten sollte man sich auch über fruchtbare
Böden und regionale Lebensmittel freuen. Gleichwohl
hätten im Bamberger Land besonders der Mais, die
Sonnenblumen, Zuckerrüben und Soja unter der
anhaltenden Trockenheit gelitten.
Die Bauern bräuchten aber auch Verlässlichkeit, so der oberfränkische BBV-Vizepräsident Michael Bienlein aus Lichtenfels. Jetzt werde gesät, aber niemand wisse, was er ernte und wie viel er davon bekomme, so Bienlein. Er sprach sich gegen die Pläne aus, Pflanzenschutzmittel in sensiblen Gebieten zu verbieten. „Wir schützen die Pflanzen doch deswegen, weil wir sie gesund erhalten wollen und als Nahrungsmittel und Futter für die Tiere brauchen.“ Auch der Königsfelder Bürgermeister Norbert Grasser wusste von den Problemen der Bauern. Die gesamte Bevölkerung habe derzeit Befürchtungen, beispielsweise, dass die Wohnungen im Winter kalt bleiben.
Vor dem Jurabauerntag im Schleuppner-Saal feierten alle Beteiligten einen festlichen Erntedankgottesdienst mit Pfarrer Michael Herrmann in der nahen St.-Jakobus-Kirche. Von dort aus setzte sich nach dem Gottesdienst ein kleiner Festzug zum Schleuppner-Saal in Bewegung, angeführt von der örtlichen Blaskapelle und einigen Helfern mit der stattlichen Erntekrone auf den Schultern.
Bilder:
1. Ein kleiner Festzug bewegte sich vom Gottesdienst
in der St.-Jakobus-Kirche zum Königsfelder
Jurabauerntag im Schleuppner-Saal.
2. Bürgermeister Norbert Grasse, MdL Martin Schöffel,
Kreisobmann Tobias Kemmer, BBV-Geschäftsführer
Werner Nützel und der stellvertretende
oberfränkische BBV-Präsident Michael Bienlein (von
links) vor der Erntekrone beim Königsfelder
Jurabauerntag
Streuobst mit allen Sinnen genießen / Aktionstag zum Thema Streuobst am Kompetenzzentrum für Ernährung
.jpg) Kulmbach.
Streuobstwiesen sind nicht nur wichtig für die
Artenvielfalt, sondern auch durch alte und
regionalspezifische Sorten ein kulinarisches
Geschmackserlebnis. Deshalb hat das Kompetenzzentrum
für Ernährung in Kulmbach die Veranstaltungsreihe
mit dem Namen „Kulminarik“ („Kulinarik in Kulmbach“)
gestartet, Sie soll das Thema Streuobst den
Verbrauchern näherbringen und ihnen das gesamte
Geschmacksspektrum von Streuobst aufzeigen.
Kulmbach.
Streuobstwiesen sind nicht nur wichtig für die
Artenvielfalt, sondern auch durch alte und
regionalspezifische Sorten ein kulinarisches
Geschmackserlebnis. Deshalb hat das Kompetenzzentrum
für Ernährung in Kulmbach die Veranstaltungsreihe
mit dem Namen „Kulminarik“ („Kulinarik in Kulmbach“)
gestartet, Sie soll das Thema Streuobst den
Verbrauchern näherbringen und ihnen das gesamte
Geschmacksspektrum von Streuobst aufzeigen.
Zum Auftakt gab es auf dem Gelände und in den Räumen der Museen im Mönchshof in Kulmbach einen überaus gut besuchten Aktionstag mit Vorträge, Verkostungen, Kochvorführungen, einem Kinderprogramm mit Streuobstpädagoginnen und mit Einblicken in die experimentelle Küche. Es ging dabei nicht nur um Äpfel, sondern auch um Beeren, Birnen, Walnüsse, Weintrauben oder Zwetschgen.
Ziel des aktuellen bayerischen Streuobstpakts ist es, den derzeitigen Streuobstbestand in Bayern zu erhalten und neue Streuobstbäume zu pflanzen. „Wir wollen dem Rückgang der Streuobstbestände in Bayern entgegenwirken“, sagte Ludwig Wanner vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium bei der Eröffnung. Er verwies auf das neue bayerische Förderprogramm für die Abgabe von bis zu einer Million Obstbäumen bis zum Jahr 2035, das vor wenigen Tagen gestartet wurde. Dabei sollte es nicht nur um Pflanzung und Pflege, sondern auch um die Verwertung der Früchte gehen, sagte Wanner. Nicht immer würde das Obst richtig geschätzt, deshalb soll die Aktion des Kompetenzzentrums dem Streuobst einen neuen Schub geben.
„Zur Ernährung gehört auch der Genuss“, so die neue Leiterin des Kompetenzzentrums Christine Röger. Deshalb sollte mit der Veranstaltung vor allem Werbung für das Streuobst und die vielfältigen Produkte daraus gemacht werden. Nicht zuletzt sei Streuobst auch ein Beitrag zum aktiven Naturschutz, indem zahlreiche Insektenarten von den Streuobstwiesen profitieren.
.jpg) Wie
die Obstbäume richtig gepflegt werden, so dass am
Ende auch ein entsprechender Ertrag herauskommt, das
vermitteln die zahlreichen Obst- und
Gartenbauverbände mit ihren Pflegekursen, so die
Bezirksvorsitzende des Verbandes für Gartenbau und
Landespflege, die Landtagsabgeordnete Gudrun
Brendel-Fischer. Die „Kulminarik“-Veranstaltung
richtete sich aber auch an Kinder, denn, so Simon
Reitmeier vom Kompetenzzentrum: „Ernährungsbildung
muss früh ansetzen, damit man die Ernährung im
Erwachsenenalter richtig zu schätzen weiß“.
Wie
die Obstbäume richtig gepflegt werden, so dass am
Ende auch ein entsprechender Ertrag herauskommt, das
vermitteln die zahlreichen Obst- und
Gartenbauverbände mit ihren Pflegekursen, so die
Bezirksvorsitzende des Verbandes für Gartenbau und
Landespflege, die Landtagsabgeordnete Gudrun
Brendel-Fischer. Die „Kulminarik“-Veranstaltung
richtete sich aber auch an Kinder, denn, so Simon
Reitmeier vom Kompetenzzentrum: „Ernährungsbildung
muss früh ansetzen, damit man die Ernährung im
Erwachsenenalter richtig zu schätzen weiß“.
Agnes Kohler von „Kohler´s Kulinarik“ führte beispielsweise vor, wie ein kreatives Menü mit Streuobst entsteht. Sternekoch Tobias Bätz von „Herrmann's Posthotel“ ließ sich beim Experimentieren mit Produkten von der Streuobstwiese ebenfalls über die Schulter blicken. Zusammengestellt wurde beispielsweise eine Quittenkaltschale zum Aperitif, eine Birnen-Selleriesuppe als Vorspeise und ein gebratenes Kalbspflanzerl mit Zwetschen-„Ketchup“ und Apfel-Krautsalat.
In einer Reihe von Vorträgen verriet Ernährungsberaterin Yvonne Müller Tipps und Tricks zu Verwertung und Haltbarmachung des Obstes, der frühere Kreisfachberater Friedhelm Haun berichtete vom Gesundheitswert der Walnuss sowie vom Lebensraum Streuobstwiese und die Hauswirtschaftsmeisterin Margot Findeiß von der „Vielfalt der Birne“
Ergänzt wurde das Programm unter anderem mit Mitmachangeboten zum Saftpressen und zur Sortenbestimmung sowie zu den verschiedensten Verkostungen. Die Bayerische Landesanstalt für Wein- und Gartenbau präsentierte eine Nuss-Mühle zur Herstellung von frischem Nussmus und die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft war mit dem Verbraucherportal Regionales Bayern und mit Information zu den Genuss Schätzen Bayern vertreten.
Bilder:
1. Hauswirtschaftsmeisterin
Margot Findeiß und der frühere Kreisfachberater
Friedhelm Haun stellten die breite Palette an
heimischen Apfelsorten vor.
2. Zum Test der Geschmacksnerven lud Eva Stetter
(rechts) den früheren Kreisfachberater Friedhelm
Haun, die Bezirksvorsitzende des Verbandes für
Gartenbau und Landespflege, die Abgeordnete Gudrun
Brendel-Fischer, Ludwig Wanner vom
Landwirtschaftsministerium, Martina Tröger vom
Kompetenzzentrum und dessen neue Leiterin Christine
Röger (von links).
Appell zu Ruhe und Gelassenheit / BBV Bayreuth feierte Kreiserntedankfest – Dank an ausgeschiedene Ortsobleute
.jpg) Bayreuth.
Der BBV-Kreisverband Bayreuth hat seine
Erntedankfeier dafür genutzt, allen Ortsbäuerinnen
und Ortsobmänner zu danken, die bei der
zurückliegenden Verbandswahlen nicht mehr angetreten
waren oder nicht mehr gewählt wurden. Genau 99
Persönlichkeiten aus allen Teilen des Bayreuther
Landkreises erhielten dabei eine Urkunde, eine
Anstecknadel und ein Geschenk des Bauernverbandes.
Bayreuth.
Der BBV-Kreisverband Bayreuth hat seine
Erntedankfeier dafür genutzt, allen Ortsbäuerinnen
und Ortsobmänner zu danken, die bei der
zurückliegenden Verbandswahlen nicht mehr angetreten
waren oder nicht mehr gewählt wurden. Genau 99
Persönlichkeiten aus allen Teilen des Bayreuther
Landkreises erhielten dabei eine Urkunde, eine
Anstecknadel und ein Geschenk des Bauernverbandes.
Vor den Ehrungen feierten die evangelischen Pfarrerehepaar Uschi und Christoph Aschoff von der Kirchengemeinde St. Johannis und Günter Schloßmacher, Gemeindereferent der katholischen St.-Hedwigs-Kirche in Bayreuth zusammen mit den Landwirten einen Erntedankgottesdienst in der mit allerlei Gaben geschmückten Tierzuchtklause. Kreisobmann Karl Lappe appellierte im Anschluss an seine Berufskollegen, trotz aller Krisen um uns herum, Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. „Angst und Panikmache sind fehl am Platz“, so Lappe.
Der Kreisobmann sprach in seinem Rückblick von einem ganz besonderen Jahr. Eine so lange und intensive Trockenheit habe es schon lange nicht mehr gegeben. Wenn der Klimawandel auch Anpassungen erforderlich macht, so seien „Greta-Thunberg-Diskussionen“ fehl am Platz. Lappe gab zu bedenken, dass Deutschland gerade einmal rund zwei Prozent der Weltbevölkerung und ebenfalls rund zwei Prozent der Weltagrarfläche besitze. Das bedeute: „Alles, was wir auch machen, kann den Klimawandel nicht verändern.“
Nachdem Lappe in seinem Grußwort auch den Verkehrsversuch der Stadt Bayreuth kritisiert hatte, in dessen Folge die Erlanger- und die Bismarckstraße als die beiden wichtigen Aus- und Einfallstraßen derzeit einspurig angelegt sind, ging Stadt- und Bezirksrat Stefan Specht in seinem Grußwort unmittelbar darauf ein. Er sprach von einem kommunalpolitisch ganz heißen Eisen und eine ganz schwierigen Thema. Specht nannte den Verkehrsversuch fragwürdig, gab aber auch zu bedenken, dass man derzeit noch die Chance habe, darüber zu diskutieren. Ohne seine Fraktion wäre der Beschluss zur Einspurigkeit längst gefallen. „Es ist nicht so, dass wir das einfach durchwinken werden“, versprach Specht. Karl Lappe gehörte zusammen mit den Landwirten aus dem westlichen Landkreis, aber auch zusammen mit seinen dortigen Bürgermeisterkollegen und den von ihnen vertretenen Bürgern zu den schärfsten Kritikern der Maßnahme, die den gesamten Verkehr zwischen Stadt und Landkreis entscheidend einschränke.
Die Bundestagsabgeordnete Silke Launert hob in ihrem Grußwort hervor, dass Nachhaltigkeit bei den Bauern schon immer eine entscheidende Rolle gespielt habe. Schon immer stünden Landwirte für Bodenständigkeit und Bodenhaftung, schon immer hätten sie den Bezug zur Natur und den Respekt vor Tieren gepflegt.
.jpg) Eine
besondere Ehrung wurde Hedwig Loos aus Kornbach
zuteil. Sie gehörte von 2007 bis 2022 der
Kreisvorstandschaft des BBV Bayreuth an und konnte
bei den Neuwahlen im Mai aus Zeitgründen nicht mehr
kandidieren. Ihr Amt als Ortsbäuerin, das sie seit
2001 innehat, bleibt sie allerdings auch weiterhin
treu. Kreisbäuerin Angelika Seyferth, die zusammen
mit Kreisobmann eine Ehrenurkunde überreichte,
nannte Hedwig Loos die treue Seele der Landfrauen
und eine wertvolle Ideengeberin für den
Kreisverband.
Eine
besondere Ehrung wurde Hedwig Loos aus Kornbach
zuteil. Sie gehörte von 2007 bis 2022 der
Kreisvorstandschaft des BBV Bayreuth an und konnte
bei den Neuwahlen im Mai aus Zeitgründen nicht mehr
kandidieren. Ihr Amt als Ortsbäuerin, das sie seit
2001 innehat, bleibt sie allerdings auch weiterhin
treu. Kreisbäuerin Angelika Seyferth, die zusammen
mit Kreisobmann eine Ehrenurkunde überreichte,
nannte Hedwig Loos die treue Seele der Landfrauen
und eine wertvolle Ideengeberin für den
Kreisverband.
Die folgenden ausgeschiedenen Ortsobleute wurden zum Erntedankfest geehrt:
Für fünf Jahre: Anna Leichtenstern (Altencreußen), Waltraud Lang (Aufseß-Heckenhof), Elfriede Schneider (Krögelstein), Gretel Hortelmaus (Nankendorf), Martina Böhner (Neuhof), Claudia Berger (Reizendorf), Gisela Hacker (Seulbitz), Ilse Hösch (Truppach), Jenny Schmitt (Weidmannsgesees), Andreas Ott (Büchenbach), Sven Stahlmann (Frankenhaag), Florian Götz (Frankenberg), Roland Thiem (Langenloh), Thomas Hauenstein (Mistelbach), Matthias Schatz (Moggendorf) und Martin Bächmann (Neuhaus).
Für zehn Jahre: Rosi Höhn (Frankenhaag), Brigitte Purrucker (Guttenthau), Karin Wittmann (Körbeldorf), Heidi Teufel (Langenloh), Margt Ströbel (Prebitz), Elfriede Berger (Thiergarten-Saas), Brigitte Lehner (Troschenreuth), Christine Schilling (Weiher), Gerd Böhner (Euben), Thomas Kolb (Kleinweiglarreuth), Heinz Herold (Kornbach), Klaus Timm (Lützenreuth), Alfons Neubauer (Rabeneck), Lorenz Fick (Untersteinach), Andreas Schilling (Weiher) und Alexander Kaiser (Wendelhöfen).
Für 15 Jahre: Gudrun Pezold (Birk), Beate Schieder (Penzenreuth), Cäcilia Brütting (Seelig), Gerd Schmidt (Wendelhöfen), Johannes Handwerger (Drosendorf), Bernd Scholz (Eschen), Reinhold Pöhlmann (Guttenthau-Röslas), Horst Seitz (Nemnschenreuth), Rudolf Hagen (St. Johannis), Günter Trautner (Seidwitz), Thomas Neuner (Welkendorf), und Roland Macht (Witzleshofen).
Für 20 Jahre: Christine Stenglein (Breitenlesau), Ingrid Stiefler (Regenthal), Christa Ordnung (st. Johannis), Margarete Teufel (Schressendorf), Marianne Galster (Stein), Angela Neuner (Volsbach) und Erwin Pfändner (Kainach).
Für 25 Jahre: Renate Oetterer (Aichig), Roswitha Müller (Busbach), Erna Handwerger (Drosendorf), Gunda Potzel (Fenkensees), Regina Pfändner (Kainach), Renate Böhm (Neuhaus), Irmgard Macht (Witzleshofen), Irmgard Büttner (Wolfsbach), Margarete Seiferth (Wülfersreuth), Friedrich Köhler (Betzenstein-Mergners), Johann Lochner (Obernsees), Erwin Hoffmann (Stechendorf) und Hans-Martin Reif (Stierberg).
Für 30 Jahre: Juliane Riedelbauch (Bärnreuth), Renate Ruder (Betzenstein-Mergners), Margitta Reichel (Bischofsgrün), Karin Potzel (Cottenbach-Altenplos), Gudrun Rank (Gefrees), Barbara Arnold Kaltenthal), Resi Hartmann (Körzendorf), Monika Heinz (Lankendorf), Angelika Grießhammer (Neudorf), Petra Legath (Oberwarmensteinach), Margitta Zeilmann (Schobertsreuth), Rita Hoffmann (Stechendorf), Heidi Popp (Zettitz), Hans-Erhard Keller (Eckersdorf-Donndorf), Hans Engelnrecht (Lankendorf), Hans Nickl (Lienlas), Peter Zeilmann (Schobertsreuth), Gerhard Richter (Siegritzberg), und Konrad Frank (Windischenlaibach).
Für 35 Jahre: Lore Hohlweg (Bad Berneck), Christine Freyberger (Losau), Brigitte Burghardt (Seitenbach), Lisbeth Fick (Untersteinach), Hans Portzel (Fenkensees) und Karl-Heinz Küffner (Hauendorf).
Für 40 Jahre: LIselotte Ströbel (Hauendorf), Waltraud Dörfler (Lützenreuth) und Peter Bauernfeind (Wolfsbach).
Für 45 Jahre: Gerda Hofmann (Altstadt, Gunda Neuner (Welkendorf), Heinz Leykauf (Großweiglareuth), Hemut Küfner (Mengersreuth) und Friedrich Stiefler (Regenthal)
Für 50 Jahre: Josef Ringler (Mandlau-Prüllsbirkig).
Für 55 Jahre: Rainer Sack (Altstadt).
Bilder:
1. Sie
gehören zu den Dienstältesten Ortsobleuten des
Bauernverbandes im Landkreis Bayreuth (von links):
Josef Ringler, Liselotte Ströbel, Waltraud Dörfler
und Friedrich Stiefler. Kreisbäuerin Angelika
Seyerth und Kreisobmann Karl Lappe zeichneten die
ausgeschiedenen Ehrenamtsträger beim Kreiserntedank
aus.
2. 15 Jahre lang und damit drei Amtsperioden gehörte
Hedwig Loos (2. von links) dem Kreisvorstand des BBV
an. Kreisbäuerin Angelika Seyferth (links),
Kreisobmann Karl Lappe und sie stellvertretende
Kreisbäuerin Doris Schmidt zeichneten Hedwig Loos
mit der Ehrenurkunde des Bauernverbandes aus.
„Schönster, spannendster und vielseitigster Beruf der Welt“ / 51 Landwirtschafts-Azubis aus dem Westen Oberfranken freigesprochen
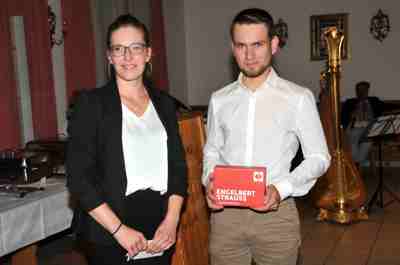 Hirschaid.
51 frischgebackene Landwirte aus dem westlichen
Oberfranken hat die Regierung von Oberfranken in
Hirschaid feierlich verabschiedet. Die 5 Damen und
46 Herren kamen aus den Städten und Landkreisen
Bamberg, Coburg, Forchheim, Kronach und Lichtenfels.
Sie alle haben eine dreijährige duale Ausbildung
hinter sich. Das bedeutet: Nach einem
Berufsschuljahr in Vollzeit waren sie zwei Jahre
lang in ihren Ausbildungsbetrieben tätig. Während
dieser Zeit besuchten sie einmal pro Woche die
Berufsschule. Dazu gab es die verschiedensten
Lehrgänge und Schulungen. Für die Berufsbildung ist
seit Juli 2021 die Regierung von Oberfranken
zuständig.
Hirschaid.
51 frischgebackene Landwirte aus dem westlichen
Oberfranken hat die Regierung von Oberfranken in
Hirschaid feierlich verabschiedet. Die 5 Damen und
46 Herren kamen aus den Städten und Landkreisen
Bamberg, Coburg, Forchheim, Kronach und Lichtenfels.
Sie alle haben eine dreijährige duale Ausbildung
hinter sich. Das bedeutet: Nach einem
Berufsschuljahr in Vollzeit waren sie zwei Jahre
lang in ihren Ausbildungsbetrieben tätig. Während
dieser Zeit besuchten sie einmal pro Woche die
Berufsschule. Dazu gab es die verschiedensten
Lehrgänge und Schulungen. Für die Berufsbildung ist
seit Juli 2021 die Regierung von Oberfranken
zuständig.
Die Erzeugung wertvoller Nahrungsmittel ist und bleibt die wichtigste Aufgabe des Landwirts, sagte Burkhard Traub von der Regierung. Im Zuge von Krieg und Krisen sei das der Bevölkerung jetzt erst weder so richtig bewusst geworden. Alle Absolventen hätten es in den zurückliegenden drei Jahren gelernt, Nahrungsmittel umweltverträglich und nachhaltig zu erzeugen und dabei auch das Tierwohl zu berücksichtigen.
Kein Jahrgang zuvor habe so vieles meistern müssen, wie der aktuelle Jahrgang, so Tanja Schilling von der für die angehenden Landwirte zuständigen Freiherr-von-Rast-Berufsschule in Coburg. Der mehrfache Wechsel von Präsenz- in den Inline-Unterricht habe genauso dazugehört, wie zahlreiche andere Hürden in Verbindung mit den Corona-Auflagen. Als besten anwesenden Absolventen zeichnete sie Korbinian Bischof aus. Er stammt aus Pfaffenhofen an der Roth im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm und hatte in Oberfranken seine Ausbildung absolviert. Bester wurde Michael Kilian aus Viereth-Trunstadt im Landkreis Bamberg. Er konnte an der Freisprechungsfeier nicht teilnehmen. Das Trio der Jahrgangsbesten ergänzt Michael Endres aus Wiesenttal.
 Die
Leistungen aller Absolventen seien ein ganz
wesentlicher Beitrag für unsere Gesellschaft, sagte
der stellvertretende Bamberger Landrat Johannes
Maciejonczyk. Der Beruf des Landwirts sei um vieles
anspruchsvoller, als manch anderer Beruf. „Der
Landwirts kennt auch keine Uhrzeit, sondern viele
Uhrzeiten“, sagte Maciejonczyk. Einige aktuelle
Themen, die ihn und seinen Berufskollegen derzeit
umtreiben, sprach der neue BBV-Kreisobmann Tobias
Kemmer aus Bamberg an. Die seiner Meinung nach
völlig überzogenen Vorschläge der EU zur
Pflanzenschutzreduktion in Schutzgebieten gehörten
genauso dazu, wie die im Raum stehende Schließung
des Bamberger Schlachthofes. Um dagegen anzukämpfen
sei eine Interessensgemeinschaft gegründet worden,
weitere Mitstreiter aus den Reihen der Viehhalter
seien dringend gesucht.
Die
Leistungen aller Absolventen seien ein ganz
wesentlicher Beitrag für unsere Gesellschaft, sagte
der stellvertretende Bamberger Landrat Johannes
Maciejonczyk. Der Beruf des Landwirts sei um vieles
anspruchsvoller, als manch anderer Beruf. „Der
Landwirts kennt auch keine Uhrzeit, sondern viele
Uhrzeiten“, sagte Maciejonczyk. Einige aktuelle
Themen, die ihn und seinen Berufskollegen derzeit
umtreiben, sprach der neue BBV-Kreisobmann Tobias
Kemmer aus Bamberg an. Die seiner Meinung nach
völlig überzogenen Vorschläge der EU zur
Pflanzenschutzreduktion in Schutzgebieten gehörten
genauso dazu, wie die im Raum stehende Schließung
des Bamberger Schlachthofes. Um dagegen anzukämpfen
sei eine Interessensgemeinschaft gegründet worden,
weitere Mitstreiter aus den Reihen der Viehhalter
seien dringend gesucht.
Ein weiterer Gratulant war Roland Reh, Vorsitzender des Bamberger VLF-Kreisverbandes (Verband landwirtschaftlicher Fachbildung). Mit der erfolgreichen Prüfung stünden den Absolventen jetzt alles Wege offen. Doch Arbeit und gewinn seien nicht alles, mahnte Reh. Er appellierte an die jungen Leute, sich auch immer wieder Freiräume zu schaffen, Hobbys nachzugehen, aber auch Ehrenämter zu übernehmen. Konrad Schrottenloher, der neue Leiter des Bamberger Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten nannte den Beruf des Landwirts den „schönsten, spannendsten und vielseitigsten Beruf, den es auf der ganzen Welt gibt“. Er rief die jungen Leute dazu auf, sich in die aktuelle gesellschaftliche Diskussion immer wieder einzubringen: „Tun sie mit der Landwirtschaft nicht nur Gutes, sondern reden sie auch darüber“, sagte der neue Amtschef.
Die erfolgreichen Absolventen sind:
Landkreis Bamberg:
Tobias Aichinger (Hirschaid), Michael Blauberger (Frensdorf), Christian Dotterweich (Schönbrunn/Steigerwald), Lukas Engel (Burgebrach), Niklas Geiger (Reckendorf), Sebastian Heberlein (Reundorf), Michael Kilian (Viereth-Trunstadt), Raphael Kropf (Pommersfelden), Rainer Richter (Heiligenstadt), Bernhard Schäfer (Heiligenstadt), Tobias Schwarzmann (Altendorf), Lukas Schwengler (Reckendorf) und Lukas Zenk (Scheßlitz).
Landkreis Coburg:
Tobias Freiberger-Falk (Itzgrund), Lukas Köhn (Neustadt bei Coburg), Gina Pohle (Seßlach), Jonas Spielmann (Seßlach), Max Taschek (Großheirath), Jonathan Waldert (Großheirat), Christian Wäschenfelder (Großheirath) und Tobias Wöhner (Seßlach).
Landkreis Forchheim:
Anna-Maria Deinhardt (Ebermannstadt), Michael Endres (Wiesenttal), Melissa Geyer (Hallerndorf), Johannes Götz (Kirchehrenbach), Maria Götz (Kirchehrenbach), Michael Götz (Kirchehrenbach), Christian Hübschmann (Kirchehrenbach), Niklas Niedermann (Langensendelbach), Christof Otzelberger (Hallerndorf), Michael Roppelt (Kauernhofen), Max Singer (Hetzles), Johannes Vollmann (Hausen) und Sebastian Wölfel (Igensdorf).
Landkreis Kronach:
Tobias Backer (Marktrodach), Tobias Bauer (Weißenbrunn), Kai Döhler (Küps), Jonas Thiem (Ludwigstadt) und Jan Welcher (Kronach).
Landkreis Lichtenfels:
Jonas Fischer Hochstadt, Isabell Kremer (Lichtenfels), Martin Lypold (Lichtenfels), Maximilian Reindl (Altenkunstadt), Fabian Reinhardt (Lichtenfels), Maximilian Rieger (Burgkunstadt) und Jakob Wunner (Ebensfeld).
Bild:
1. Als
besten anwesenden Absolventen hat Tanja Schillig von
der Freiherr-von-Rast-Berufsschule in Coburg
Korbinian Bischof aus Pfaffenhofen an der Roth
ausgezeichnet. Er hatte in Oberfranken seine
Ausbildung absolviert.
2. Sie alle haben die Ausbildung zum staatlich
anerkannten Landwirt erfolgreich absolviert und
wurden bei einer Feierstunde in Hirschaid
„freigesprochen“. Das Bild zeigt die erfolgreichen
Absolventen aus dem Landkreis Coburg zusammen mit
einigen Gratulanten.
Landwirt als Beruf der Zukunft / 43 frischgebackene Landwirte aus Ostoberfranken verabschiedet
 Himmelkron.
43 Absolventen des Ausbildungsberufes Landwirt aus
den Städten und Landkreisen Bayreuth, Hof, Kulmbach
und Wunsiedel haben am Mittwoch in Himmelkron ihre
Zeugnisse und Urkunden erhalten. Für die
„Freisprechungsfeier“ war erstmals die Regierung von
Oberfranken statt wie bisher das jeweilige
Landwirtschaftsamt zuständig. Hintergrund ist die
Neuorganisation der Ämterstruktur, in deren Rahmen
seit Juli 2021 die Bezirksregierungen für die
Berufsausbildung der Landwirte zuständig sind.
Lediglich die Berufsberatung liegt weiterhin in den
Händen der Landwirtschaftsämter. Unter den 43
Absolventen waren neun Frauen.
Himmelkron.
43 Absolventen des Ausbildungsberufes Landwirt aus
den Städten und Landkreisen Bayreuth, Hof, Kulmbach
und Wunsiedel haben am Mittwoch in Himmelkron ihre
Zeugnisse und Urkunden erhalten. Für die
„Freisprechungsfeier“ war erstmals die Regierung von
Oberfranken statt wie bisher das jeweilige
Landwirtschaftsamt zuständig. Hintergrund ist die
Neuorganisation der Ämterstruktur, in deren Rahmen
seit Juli 2021 die Bezirksregierungen für die
Berufsausbildung der Landwirte zuständig sind.
Lediglich die Berufsberatung liegt weiterhin in den
Händen der Landwirtschaftsämter. Unter den 43
Absolventen waren neun Frauen.
Mit Loisa Riedl, Jan Morath und Christopher Schramm kommen alle drei Besten des Ausbildungsjahres aus der Gemeinde Himmelkron. Bei der feierlichen Verabschiedung betonten sämtliche Redner, wie wichtig die regionale Erzeugung von Lebensmittel vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und des Ukraine Krieges ist. Ebenso ließ es kein Redner aus, an die jungen Leute zu appellieren, Weiterbildungsangebote anzunehmen.
„Die Bedeutung von Nahrungsmittelsicherheit ist uns allen wieder bewusst geworden“, sagte Burkhard Traub von der Regierung. Doch Landwirte stünden noch für vieles mehr, für den Erhalt der Kulturlandschaft für das gesellschaftliche Leben auf dem Land, für ein aktives Dorfleben und eine lebendige Dorfkultur. Eine fundierte landwirtschaftliche Ausbildung bezeichnete er als bestmögliche Vorbereitung auf das künftige Berufsleben.
Es gebe kaum einen anderen Beruf, der so abwechslungsriech und vielfältig ist, wie der des Landwirts, so der stellvertretende Hofer Landrat und Bürgermeister von Naila Frank Stumpf. Noch immer machten sich viele Menschen im Supermarkt keine Gedanken darüber, woher das reichhaltige Angebot eigentlich kommt. Dazu benötige es die Landwirte als hochqualifizierte Fachkräfte, die sich ständig neuen Herausforderungen stellen müssten.
 Von
einem „Beruf der Zukunft“ sprach Andrea Brönner, die
Leiterin des Beruflichen Schulzentrums Stadt und
Landkreis Hof, zu dem auch die Berufsschule für
Landwirte in Münchberg gehört. Zusammen mit Martin
Abt, dem Leiter des Staatlichen Berufsschulzentrums
III in Bayreuth, sprach sie aber auch die
Herausforderungen an. „Das Problem ist die
Akademisierung der Bildung“, sagte Andrea Brönner.
Martin Abt bezeichnete im Rückblick den
Distanzunterricht als nicht einfach. Er sprach auch
den Lehrermangel an seinem Schulzentrum und an den
Berufsschulen allgemein an.
Von
einem „Beruf der Zukunft“ sprach Andrea Brönner, die
Leiterin des Beruflichen Schulzentrums Stadt und
Landkreis Hof, zu dem auch die Berufsschule für
Landwirte in Münchberg gehört. Zusammen mit Martin
Abt, dem Leiter des Staatlichen Berufsschulzentrums
III in Bayreuth, sprach sie aber auch die
Herausforderungen an. „Das Problem ist die
Akademisierung der Bildung“, sagte Andrea Brönner.
Martin Abt bezeichnete im Rückblick den
Distanzunterricht als nicht einfach. Er sprach auch
den Lehrermangel an seinem Schulzentrum und an den
Berufsschulen allgemein an.
Glückwünsche für den Bauernverband überbrachte der Kulmbacher BBV-Kreisobmann Harald Peetz. Er bereitete die jungen Leute darauf vor, dass sie es im Rahmen ihrer künftigen Tätigkeit auch immer wieder mit Teilen der Gesellschaft zu tun hätten, die „es nicht immer gut mit uns meinen“. Er appellierte deshalb an die frischgebackenen Landwirte, selbstbewusst zum eigenen Berufsstand zu stehen, schließlich seien seit den Krisen gerade die Bauern wieder mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt.
Auch Rainhard Kortschack vom Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF) sprach dieses Thema an. „So manch Verbraucher träumt noch immer von der lila Kuh“, sagte er. Die Landwirte müssten sich deshalb immer wieder aufs Neue bemühen, in der Gesellschaft Gehör zu finden.
Die folgenden jungen Leute haben ihre Ausbildung zum Landwirt erfolgreich bestanden.
Stadt und Landkreis Bayreuth:
Christopher Schramm (Bayreuth), Anna Büttner (Pegnitz), Mariella Hannig (Hollfeld), Fabian Lang (Creußen) und Vanessa Lochmüller (Weidenberg).
Stadt und Landkreis Hof:
Moritz Gruber (Hof), Martin Eckardt (Konradsreuth), Susann Eckardt (Konradsreuth), Florian Feulner (Stammbach), Pascal Findeiß (Selbitz), Johannes Häßler (Issigau), Matthias Hermasch (Stammbach), Fabian Hüttner (Schauenstein), Christoph Kothmann (Schauenstein), Maximilian Kretzer (Regnitzlosau), Lukas Meyer (Schwarzenbach an der Saale), Moritz Neudel (Zell), Simon Rödel (Rehau), Paul Schaber (Döhlau), Stefan Schlegel (Münchberg), Hannah Schmutzler (Döhlau), Robert Sörgel (Konradsreuth), Moritz Tutsch (Selbitz), Fabien Wolfrum (Schauenstein), Tobias Wolfrum (Helmbrechts) und Lena Zuber (Köditz).
Stadt und Landkreis Kulmbach:
Mirijam Beierlein (Neuenmarkt), Stefan Köber (Kulmbach), Jan Morath (Himmelkron), Louisa Riedl (Himmelkron), Tobias Spiller (Himmelkron) und Florian Wehrfritz (Kulmbach).
Landkreis Wunsiedel:
Ralf Amann (Röslau), Michel Döhler (Thiersheim), Moritz Friedel (Höchstädt) und Jonas Gräbner (Kirchenlamitz).
Bilder:
1. Louisa
Riedl aus Himmelkron gilt mit einem Notenschnitt von
1,1 als Beste des Prüfungsjahrgangs. Dafür erhielt
sie aus den Händen von Schulleiter Martin Abt unter
anderem einen Staatspreis.
2. Diese frischgebackenen Landwirte aus den Städten
und Landkreisen Bayreuth, Hof, Kulmbach und
Wunsiedel haben ihren Berufsabschluss zum Landwirt
erfolgreich absolviert.
2. Zusammen
mit den Gratulanten stellten sich die Absolventen
aus den einzelnen Landkreisen zu Gruppenbildern


Landkreis Bayreuth (links) - Landkreis Hof (rechts)


Landkreis Kulmbach (links) - Landkreis Wunsiedel
(rechts)
Abschied von Fichte und Kiefer / Bei der FBG Pegnitz spielt das Thema Waldumbau eine immer größere Rolle – Gemischte Bilanz bei Jahresversammlung
 Pegnitz.
Auf zwei turbulente Jahre hat die
Forstbetriebsgemeinschaft Pegnitz bei ihrer
Jahresversammlung zurückgeblickt. Nach einem langen
Tief hat sich der Holzpreis seit Anfang des Jahres
wieder erholt und ist seitdem stabil. „Wir können im
Großen und Ganzen zufrieden sein“, sagte der
Vorsitzende Werner Lautner. Probleme gibt es
trotzdem noch genug.
Pegnitz.
Auf zwei turbulente Jahre hat die
Forstbetriebsgemeinschaft Pegnitz bei ihrer
Jahresversammlung zurückgeblickt. Nach einem langen
Tief hat sich der Holzpreis seit Anfang des Jahres
wieder erholt und ist seitdem stabil. „Wir können im
Großen und Ganzen zufrieden sein“, sagte der
Vorsitzende Werner Lautner. Probleme gibt es
trotzdem noch genug.
Der zuständige Forstdirektor Dirk Lüder vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg machte den Waldbesitzern bei der Versammlung einmal mehr klar, dass Fichte und Kiefer in unseren Breiten künftig keine Chance mehr haben werden. Zwar sei das Gebiet der FBG Pegnitz von den Kalamitäten durch den Borkenkäfer nicht ganz so schlimm betroffen, wie etwa das Fichtelgebirge und vor allem der Frankenwald, weil der Laubholzanteil hier höher ist, doch sollten sich die Waldbesitzer nicht allzu sicher sein.
„Der Klimawandel wird weitergehen“, sagte Dirk Lüder. Dem müsse man ins Auge sehen, so der Forstdirektor, der die Waldbesitzer zum Waldumbau aufrief. Dabei sollten sie möglichst auf mehrere und nicht nur auf ein oder zwei Baumarten setzen. Sicher sei nur eines: „Die Zukunft wird für den Wald wirtschaftlich schwieriger werden.
Die Jahresversammlung bezog sich in erster Linie auf das Jahr 2021. Damals seien 16972 Festmeter Holz vermarktet worden, ungefähr 5000 Festmeter mehr als im Jahr zuvor, so Förster und fachlicher Berater Stefan Failner. 11500 Festmeter davon waren Fichten und über 5000 Festmeter Kiefern. Das vermarktete Laubholz macht dem Geschäftsbericht zufolge gerade einmal gut 300 Festmeter aus. Als positiv bewertete es der Sprecher, dass die FBG zu Jahresbeginn 1723 Mitglieder und damit fast 30 mehr als im Jahr zuvor hatte. Sie alle zusammen bewirtschaften eine Mitgliedsfläche von 12500 Hektar Wald, das sind 230 mehr als im Vorjahr.
Ehrenvositzender Hans Escherich, der die FBG viele Jahre lang geleitet hatte, prangerte in seinem Grußwort einige politische Entscheidungen an. So sei es unverständlich, dass in der gegenwärtigen Situation bei der Energieversorgung Brennholz bei der Wärmeversorgung gedeckelt und über die sogenannte CO-2-Bepreisung - laut Escherich eine Umschreibung für Besteuerung - belastet werden soll. „Von den Landesregierungen, und dem EU-Parlament, die dem anscheinend auch schon zugestimmt haben, bin ich enttäuscht“, so der Ehrenvorsitzende.
Eine Ehrung wurde bei der Versammlung dem bisherigen Leiter des Amtes für Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg Georg Dumpert zuteil. Er war zuletzt über dreieinhalb Jahre lang Leiter des Amtes und zuvor drei Jahre lang Chef des Bereichs Forsten. Während all dieser Jahre habe Georg Dumpert auch die FBG Pegnitz unterstützt und hervorragend fachlich beraten. „Durch Georg Dumpert hat unsere FBG an Professionalität gewonnen“, sagte Vorsitzender Werner Lautner. Georg Dumpert tritt mit Ablauf des Septembers in den Ruhestand. Wegen Krankheit verhindert war der bisherige forstliche Berater Klaus Eisinger. Er erfuhr ebenfalls eine Ehrung für sein langjähriges Wirken von Juli 2005 bis März 2022.
„Der Wald werde mit Sicherheit eine Zukunft haben“, sagte Landrat Florian Wiedemann. Er zollte den Waldbesitzern und Forstwirten seine Anerkennung für den tägliche Leistung zum Wohl der Allgemeinheit, für die vielfältigen Pflege und Aufbauarbeiten und deren hohen Engagement. Die Bayreuther Region sei seit jeher in besonderem Maße von der Forstwirtschaft geprägt.
Bild: Die FBG Pegnitz hat den bisherigen Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Georg Dumpert ausgezeichnet und sich für dessen jahrelangen Einsatz bedankt. Im Bild von links: Ehrenvorsitzender Hans Escherich 2. Vorsitzender Bernd Kiefhaber, forstlicher Berater Stefan Failner, Vorsitzender Werner Lautner, Georg Dumpert und der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann.
Bayerns größer Bauernmarkt mit vielen tausend Besuchern
.jpg) Bis
zum Nachmittag hatte das Wetter gehalten - und
tausende Menschen kamen, um Bayerns größten
Bauernmarkt zu besuchen. Auf dem Odeonsplatz und in
der Ludwigstraße boten mehr als 90 Direktvermarkter
aus ganz Bayern ihr vielfältiges Sortiment an selbst
erzeugten Produkten - es blieb kein kulinarischer
Wunsch offen.
Bis
zum Nachmittag hatte das Wetter gehalten - und
tausende Menschen kamen, um Bayerns größten
Bauernmarkt zu besuchen. Auf dem Odeonsplatz und in
der Ludwigstraße boten mehr als 90 Direktvermarkter
aus ganz Bayern ihr vielfältiges Sortiment an selbst
erzeugten Produkten - es blieb kein kulinarischer
Wunsch offen.
Die Standbetreiber auf der Bauernmarktmeile München lockten mit regionalen Delikatessen: Ochsenschmankerl, Fisch- Lamm- und Wildspezialitäten oder Spezialitäten vom Strauß. Dazu die Vielfalt regionaler Obst- und Gemüsesorten, eine Vielzahl an Kartoffelsorten, Milchprodukte, Käse- und Wurstdelikatessen, Brot Backwaren und feine Kuchen. Säfte, Cidre, Liköre, Wein und Edelbrände aus heimischem Obst durften nicht fehlen. Neben den kulinarischen Genüssen bot die Bauernmarktmeile auch Nützliches und Dekoratives für daheim wie Alpaka-Wolle und Alpaka-Betten, handbedruckte Leinenartikel, gedrechselte Holzwaren und Trockenblumen-, Getreide und Hopfenkränze.
Doch es ging um mehr als ums Einkaufen. Auch der Austausch mit den Direktvermarktern Bauernmarktmeile kam gut an. Im Bereich vor der Feldherrenhalle waren zahlreiche Infostände aufgebaut. So konnten sich die Gäste beispielsweise am Pavillon des Bayerischen Bauernverbands über die heimische Landwirtschaft informieren. Vor Ort dabei waren auch Obstbauern, die Äpfel zur Verkostung anboten. Hauptveranstalter der 11. Bauernmarktmeile war der Bayerische Bauernverband., Mitveranstalter unter anderem das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Hälfte eines normalen Erntejahres / Mehr Schatten als Licht: Landwirte zogen Bilanz beim Kreiserntedankfest – Eigenes Kirchenlied für den Bauernstand
 Kulmbach.
Miteinander reden, statt übereinander schimpfen. Das
ist es, was sich der Kulmbacher BBV-Kreisobmann
Harald Peetz für die Zukunft wünschen würde. „Meine
Hoffnung ist es, dass Landwirte und Verbraucher
künftig zusammenhalten“, sagte Peetz beim
Kreiserntedank am Rande eines Gottesdienstes in der
festlich geschmückten Petrikirche.
Kulmbach.
Miteinander reden, statt übereinander schimpfen. Das
ist es, was sich der Kulmbacher BBV-Kreisobmann
Harald Peetz für die Zukunft wünschen würde. „Meine
Hoffnung ist es, dass Landwirte und Verbraucher
künftig zusammenhalten“, sagte Peetz beim
Kreiserntedank am Rande eines Gottesdienstes in der
festlich geschmückten Petrikirche.
Die Bilanz, die der Kreisobmann über das zurückliegende Erntejahr zog, hatte freilich mehr Schatten als Licht. Ab Anfang Mai habe es im Landkreis monatelang nicht mehr geregnet. „Das ist schlichtweg eine Katastrophe“, so Peetz. Die Folge sei in etwa die Hälfte des Ertrages einer normalen Erntejahres gewesen, manchmal sogar noch weniger. Katastrophal sei die Situation auch beim Futter. Schon jetzt müsse das verfüttert werden, was eigentlich für den Winter gedacht war. Dann müssten die Bauer das notwendige Futter teuer zukaufen. Extrem getroffen habe die Trockenheit auch die Waldbauern. Der Borkenkäfer habe alles zunichte gemacht. „Wie und womit forste ich auf?“, das sei die Frage, die derzeit alle Forstleute umtreibt. Peetz: „Die Waldbauern haben die Riesenaufgabe vor sich, die Grüne Krone Bayerns wieder grün werden zu lassen.“
Was sich Peetz besonders wünscht ist das gesunde Mittelmaß in der Beziehung zwischen Landwirt und Verbraucher. „Wir Bauern sind Lebensmittelproduzenten, Energiewirte, setzen uns für Artenschutz und Biodiversität ein.“ Der gesamte Umweltschutz etwa sei nur mit den Bauern und nicht gegen sie zu erreichen. Kein anderer Berufszweig sei in der Lage Kohlendioxid zu speichern, nur die Landwirtschaft. An die Adresse mancher Kritiker richtete Peetz den Satz: „Lebensmittel wachsen nicht in den Regalen der Einzelhändler.“ Die Bauern hätten ihren Beruf von der Pike auf gelernt, während Teile der Bevölkerung ihr Wissen über die Landwirtschaft ausschließlich aus YouTube oder Google hätten.
Zuvor hatte Dekan Friedrich Hohenberger den feierlichen Gottesdienst ausgestaltet. Fürbitten lasen neben dem Kreisobmann und dessen Stellvertreter Martin Baumgärtner unter anderem die Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel und der frühere Kreisobmann Wilfried Löwinger. Unter den ausgewählten Erntedankliedern ragte eines ganz besonders heraus: Pfarrerin Bettina Weber aus Mangersreuth hatte für das bekannte zeitgenössische Kirchenlied „Danke für diesen guten Morgen“ von Martin Gotthard Schneider einen neuen Text verfasst, der ganz besonders die Landwirtschaft und ihre Produkte in den Mittelpunkt rückt. In einem Vers heißt es beispielsweise: „Danke für alle uns´ re Bauern, danke, dass man sie hier noch sieht. Danke für ihren großen Einsatz, dass es Ernte gibt.“
In mehreren Grußworten drückten Landrat Klaus Peter Söllner, Bezirkstagspräsident Henry Schramm, der Leiter des Amtes für Landwirtschaft Harald Weber und der stellvertretende oberfränkische BBV-Bezirkspräsident Michael Bienlein ihre Verbundenheit zur Landwirtschaft und zum Kulmbacher Kreisverband aus. „Ohne die Bauern geht nichts, wir wissen, was wir an unserer Landwirtschaft haben“, sagte Söllner. Henry Schramm bescheinigte den Bauern eine großartige Leistung für die gesamte Gesellschaft. „Ihr macht einen super Job“, sagte er.
Bild: Am geschmückten Erntedankaltar des Kulmbacher Petrikirche zog BBV-Kreisobmann Harald Peetz Bilanz über das zurückliegende Erntejahr, das von Trockenheit und Dürre geprägt war.
Dialog zwischen Stadt und Land / Kommenden Samstag: Bauernverband feiert Erntedankfest mit Gottesdienst in der Petrikirche
 Kulmbach.
„Dank gemeinsam teilen.“ Unter diesem Motto steht
der Erntedankgottesdienst, den der Bauernverband am
Samstagabend gemeinsam mit den Menschen aus Stadt
und Land in der Petrikirche feiern möchte. „Mit der
Wahl der Petrikirche als Veranstaltungsort für unser
Erntedankfest suchen wir auch den Dialog zwischen
der Stadt- und der Landbevölkerung“, sagte
Kreisobmann Harald Peetz im Vorfeld bei einem
Ortstermin mit Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel
und Dekan Friedrich Hohenberger.
Kulmbach.
„Dank gemeinsam teilen.“ Unter diesem Motto steht
der Erntedankgottesdienst, den der Bauernverband am
Samstagabend gemeinsam mit den Menschen aus Stadt
und Land in der Petrikirche feiern möchte. „Mit der
Wahl der Petrikirche als Veranstaltungsort für unser
Erntedankfest suchen wir auch den Dialog zwischen
der Stadt- und der Landbevölkerung“, sagte
Kreisobmann Harald Peetz im Vorfeld bei einem
Ortstermin mit Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel
und Dekan Friedrich Hohenberger.
„Erntedank ist der Sonntag, der den Bauern gehört“, so Dekan Hohenberger. In früheren Jahren sei es fast schon eine Ehre gewesen, an diesem Tag den Gottesdienst besuchen zu dürfen. Oft habe man auch die Erschöpfung der Bauern nach einem Jahr anstrengender Arbeit förmlich gespürt, erinnerte sich Hohenberger. Doch auch heute gelte immer noch: „Ohne die Bauern geht in der Welt gar nichts“.
Die Krisen der zurückliegenden Monate hätten gezeigt, dass nichts selbstverständlich ist, so Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel. Aufgabe der heimischen Bauern sei es, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicherzustellen. „Das können und das wollen wir auch erfüllen“, so Opel. Allerdings benötige man dazu auch die Wertschätzung der Menschen.
Mit dem Einbringen der Ernte hätten die Bauern früher das Jahr abgeschlossen, so Kreisobmann Harald Peetz. Vieles habe sich mittlerweile geändert. Manche Berufskollegen seien noch immer mit der Ernte, andere bereits wieder mit der Aussaat beschäftigt. Geblieben sei aber die große Bedeutung der Lebensmittelsicherheit mit regionalen Produkten. „Die Bevölkerung kann sich sicher sein, dass die heimische Landwirtschaft die Menschen ernähren kann, man muss die Landwirte aber auch machen lassen.“
In den zurückliegenden Jahren hatte der BBV-Kreisverband immer in einer Gemeinde des Landkreises gefeiert. Diesmal bringt Kreisobmann Peetz die Himmelkroner Erntekrone mit nach Kulmbach. Den Dankgottesdienst wird Dekan Hohenberger halten, Kreisobmann Peetz wird das zurückliegende Erntejahr Revue passieren lassen und Kreis- und Bezirksbäuerin Opel wird einen Ausblick wagen, ehe der Bauernverband in der Kirche zu einem kleinen Imbiss einlädt. Für den musikalischen Rahmen sorgt Stadt- und Dekanatskantor Christian Reitenspieß an der Rieger-Orgel.
Der Gottesdienst zum Kreiserntedankfest des Bayerischen Bauernverbandes findet am Samstag, 24. September, um 19.30 Uhr in der Petrikirche, Kirchplatz 1 in Kulmbach statt
Bild: Dekan Friedrich Hohenberger (links) freut sich zusammen mit Kreis- und Bezirksbäuerin Beate Opel und Kreisobmann Harald Peetz auf die Erntedankfeier am Samstagabend in der Petrikirche.
„Betriebshelfer wachsen nicht auf Bäumen“ / Maschinenring Münchberg: Spitzenwerte trotz Pandemie
 Selbitz-Dörnthal.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg und
Umgebung ist dringend auf der Suche nach neuen
Kräften. Dies gilt sowohl für die klassische
Betriebshilfe, als auch für die gewerblichen
Aufgaben in der ausgelagerten GmbH. „Helfer wachsen
nicht auf Bäumen“, sagte der bisherige
Geschäftsführer Patrick Heerdegen, der den
Tätigkeitsbericht bei der Jahresversammlung in
Dörnthal für seinen erkrankten Nachfolger Simon
Weller erstattete.
Selbitz-Dörnthal.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg und
Umgebung ist dringend auf der Suche nach neuen
Kräften. Dies gilt sowohl für die klassische
Betriebshilfe, als auch für die gewerblichen
Aufgaben in der ausgelagerten GmbH. „Helfer wachsen
nicht auf Bäumen“, sagte der bisherige
Geschäftsführer Patrick Heerdegen, der den
Tätigkeitsbericht bei der Jahresversammlung in
Dörnthal für seinen erkrankten Nachfolger Simon
Weller erstattete.
„Viele Familienbetriebe sind auf Betriebshelfer angewiesen“, so der Vorsitzende Siegfried Hüttner aus Mühldorf bei Schauenstein. Doch der feste Stamm von Helfern werde altersbedingt weniger und Nachwuchs sei nur schwer zu generieren. Allgemein sei es auch schwierig, die Betriebshelfer bei Laune zu halten, sagte Patrick Heerdegen. Durch Corona sei die Arbeit vorübergehend weniger geworden und so hätten sich die Helfer vom Maschinenring abgewendet und andere Jobs gesucht. „Wer einmal weg ist, der kommt nicht mehr zurück“, so Heerdegen, der bis März als Geschäftsführer tätig war. Er sprach von einer prima Möglichkeit des Zuerwerbs für Landwirte. Man könne flexibel arbeiten und sich spontan für Einsätze melden. Auch der Stundenlohn von netto rund 20 Euro sei nicht unbedingt der Schlechteste.
Wenn die Zahl der Einsätze in der Betriebshilfe um etwa ein Drittel zurückgegangen ist, dann vor allem deshalb, weil aufgrund von Corona weniger Krankenhausaufenthalte, Operationen und kaum Rehabilitationsmaßnahmen stattgefunden hätten. Somit wurden auf den Betrieben keine Helfer gebraucht. Insgesamt kam der Geschäftsführer auf knapp 19000 Stunden geleisteter sozialer Betriebs- und Haushaltshilfe und weiteren knapp 3400 Stunden geleisteter wirtschaftlicher Betriebshilfe, etwa zur Abdeckung von Arbeitsspitzen. Macht zusammen knapp 22400 Stunden Betriebshilfe und damit exakt 31 Prozent weniger als im Vorjahr.
Zweites Standbein des Maschinenrings ist die klassische Maschinenvermittlung, deren Verrechnungswert leicht auf gut 3,1 Millionen Euro angestiegen war. Besonders die Bereiche Futterbau und Strohernte sowie Düngung, Saat und Pflege waren bei der Vermittlung von Technik und Maschinen gefragt. Der Gesamtverrechnungswert, also Betriebshilfe, Maschinenvermittlung und auch ein kleiner Teil Landschaftspflege zusammen liegt für 2021 bei knapp 4,7 Millionen Euro, was einen Anstieg um knapp sechs Prozent gegenüber 2020 bedeutet. „Wenn wir den Verrechnungswert trotz Pandemie steigern konnten, dann ist das keine Selbstverständlichkeit“, sagte der Vorsitzende Siegfried Hüttner.
Eine Neustrukturierung hatte es bei der gewerblichen Tochter gegeben. Seit 15. März ist der Maschinenring Münchberg alleiniger Gesellschafter der GmbH. Bisher war der Nachbarring aus Wunsiedel mit an Bord. Nach den Worten des GmbH-Geschäftsführers Daniel Seuß kümmert sich die GmbH in erster Linie um Grünflächenpflege, Winterdienst, Stromtrassenpflege und viele andere Dinge. Auftraggeber sind unter anderem das Bayernwerk, die Stadt Hof, das Landgericht in Hof, eine Vielzahl von Kommunen und immer mehr auch Privatleute. „Wenn man mal nicht mehr weiter weiß, dann hilft in der Regel die Telefonnummer des Maschinenrings weiter“, sagte Seuß und verwies auf einige Spezialaufträge wie die Sturmschadenbeseitigung bei einem Eisenwerk in Martinlamitz, auf die Gehölzpflege bei Windrädern oder auf die Ansaat von Blumenwiesen.
Als Betriebshelfer mit den meisten Einsatzstunden wurden bei der Jahreshauptversammlung Hannes Bodenschatz und Holger Braun ausgezeichnet. Bodenschatz hatte im zurückliegenden Jahr 1013 Stunden und Braun 608 Stunden geleistet.
Bild: Vorsitzender Siegfried Hüttner (links) und Susanne Taubald von der Geschäftsstelle zeichneten Hannes Bodenschatz (2. von links) und Holger Braun als Betriebshelfer mit den meisten geleisteten Einsatzstunden aus.
Mit den Auflagen steigt der Frust / Viele Probleme, keine Lösungen: Bauernverband diskutierte mit Politikern
 Bayreuth.
Bürokratie, immense Verteuerungen der
Produktionsmittel, Handelsverwerfungen, immer neue
Auflagen, hohe Energiepreise und eine ungewisse
Zukunft: Viele Bauern, nicht nur im Bayreuther Land,
wissen nicht, wie es weitergehen soll. „Da bist du
echt frustriert, die Lage ist zum Auswachsen“,
brachte es Gerhard Meyer aus Hummeltal bei einem
Gespräch der Kreisvorstandschaft des Bauernverbandes
mit einigen Bundes- und Landtagsabgeordneten auf den
Punkt. Wer sich dabei Lösungen erhofft hatte, wurde
allerdings enttäuscht. „Gute Botschaften haben wir
alle nicht, dazu ist die Lage zu schwierig“, sagt
der Bundestagsabgeordnete Thomas Hacker von der FDP.
Bayreuth.
Bürokratie, immense Verteuerungen der
Produktionsmittel, Handelsverwerfungen, immer neue
Auflagen, hohe Energiepreise und eine ungewisse
Zukunft: Viele Bauern, nicht nur im Bayreuther Land,
wissen nicht, wie es weitergehen soll. „Da bist du
echt frustriert, die Lage ist zum Auswachsen“,
brachte es Gerhard Meyer aus Hummeltal bei einem
Gespräch der Kreisvorstandschaft des Bauernverbandes
mit einigen Bundes- und Landtagsabgeordneten auf den
Punkt. Wer sich dabei Lösungen erhofft hatte, wurde
allerdings enttäuscht. „Gute Botschaften haben wir
alle nicht, dazu ist die Lage zu schwierig“, sagt
der Bundestagsabgeordnete Thomas Hacker von der FDP.
Die Situation für die Landwirte ist ernst, das machten Kreisobmann Karl Lappe und Kreisbäuerin Angelika Seyferth klar. Obwohl sämtliche Bundes- und Landespolitiker aller Parteien eingeladen waren, stellten sich neben Thomas Hacker lediglich Gudrun Brendel-Fischer (CSU), Tim Pargent (Grüne) und Tobias Peterka (AFD) den Landwirten.
„Der Ertrag bringt derzeit nicht das, was ich an Ausgaben habe“, sagte Angelika Seyferth. Vor allem die Schweinemastbetriebe und die Ferkelerzeuger würden derzeit reihenweise aufgeben, so Karl Lappe. „Auch wir haben die hohen Energiekosten, kommen als Bauern aber nicht in den Entlastungpaketen der Bundesregierung vor“, monierte Angelika Seyferth. Die Sorge, dass viele Landwirte im Landkreis ihre Ställe für immer ausgeräumt haben, gehe um, so Karl Lappe. Unter anderem ging es den Bauern im Einzelnen darum:
Auflagen und Bürokratie
Tierwohl sei ja schön und gut, doch kaum hat man einen neuen Stall gebaut, schon kommen die nächsten Auflagen, sagte Doris Schmidt, stellvertretende Kreisbäuerin aus Plech. So schnell komme man gar nicht mehr hinterher, wie sich die Auflagen ändern, bemängelte auch Martin Ponfick aus Unterölschnitz.
Energiekosten
Die exorbitanten Steigerungen bei den Kraftstoffen müsse man erst einmal schultern, so Christa Ziegler aus Oberobsang, Vorsitzende des Verbandes landwirtschaftlicher Fachschulbindung. Es sei nicht mehr verwunderlich, wenn so viele Bauern aufhören, denn die Dieselpreise seien ja kaum mehr zu stemmen, sagte Doris Schmidt.
Gesellschaftliche Anerkennung
„Wir werden als Luftverschmutzer und Tierquäler beschimpft“, sagte Doris Schmidt. Die Landwirtschaft werde übel behandelt. Auch Monika Daubinger aus Höfen beklagte die immer weiter auseinanderklaffende Schere in der Gesellschaft. „Viele haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, das ist ein ganz großes Problem.“ Große Teile der Gesellschaft seien nicht nur weltfremd, sondern auch arrogant gegenüber den Landwirten. Sie wünsche sich mehr Bezug zu Natur und schlug vor: „Wer Bafög will, der muss erst einmal ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr leisten.“
Zwangsstilllegung
Auch wenn die geplante Stilllegung von vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche erst einmal auf bestimmte Zeit ausgesetzt wurde, ist das Vorhaben der Bundesregierung noch immer ein großer Aufreger, gerade in einer Zeit, in der die große Bedeutung der Lebensmittelproduktion im eigenen Land wieder einen hohen Stellenwert haben müsste. Konkret geht es dabei um die verpflichtende Flächenstilllegung ab 2023. Ursprünglich sollten Landwirte mindestens vier Prozent ihrer Ackerfläche stilllegen, um die Basisprämie zu erhalten. „Der Boden ist unser Hab und Gut, den lass ich mir doch nicht wegnehmen“, schimpfte Martin Ponfick. „Die Stilllegung ist absolut nicht notwendig“, so Martin Gebhardt aus Görau. Seiner Meinung nach schaffe der ökologische Anbau genauso viel Artenvielfalt wie eine stillgelegte Fläche. Versorgungssicherheit für Mensch und Tier wäre jetzt ohnehin wichtiger.
Was sagt die Politik dazu:
Gudrun Brendel-Fischer bekräftigte, dass man einen gesunden Bestand an Schweinehaltern auf jeden Fall aufrechterhalten müsse. Was die Neuauflage des Kultur- und Landschaftsprogramms (KULAP) angeht, so sicherte sie zu, dass Bayern die EU-Mittel voll ausschöpfen und mit eigenem Geld ergiebig ausstatten werde. Wo die Landschaft in zehn Jahren steht, so genau könne er das auch nicht sagen, meinte Tim Pargent. Mit seiner Aussage, dass die Landwirte endlich die Preise bekommen, die sie verdienen, erntete er Widerspruch, denn schließlich seien ja auch die Kosten explodiert.
„Die deutschen Landwirte fallen hinten runter, weil sie nicht kompatibel sind mit den Plänen der EU“, meinte Tobias Peterka. Er sah das Problem Hauptsache in der EU. „In Brüssel liegt der Hund begraben“, sagte Peterka. Von dort käme die gesamte Bürokratie mit all ihren Widersprüchen. Im Gegensatz zu anderen Ländern halte Deutschland dann auch zu allem Überfluss eisern daran fest. Die geplante Flächenstilllegung nannte er schlichtweg einen Wahnsinn. Vor dem Hintergrund des Getreidemangels aufgrund des Ukraine-Krieges könne man doch nicht auch noch in Kauf nehmen, dass wertvolle Produktionsflächen einfach wegfallen. Thomas Hacker sprach sich für preisdämpfende Maßnahmen im Energiebereich aus. Die Kernkraftschraube dürfe man dabei nicht komplett zurückdrehen. „Wir haben den Ausstieg beschlossen, aber vergessen, den Umstieg zu organisieren“, so Hacker mit Blick auf die Diskussion um die Laufzeiten der Kernkraftwerke.
Bild: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges werden hierzulande alle Flächen gebraucht. Die geplante Stilllegung von Produktionsflächen war deshalb auch einer der Aufreger beim Abgeordnetengespräch des BBV Bayreuth mit Bundes- und Landespolitikern.
Borkenkäfer überlebt auch tiefgefroren / Katastrophale Situation in vielen Wäldern des Kulmbacher Landes
.jpg) Kulmbach/Marktschorgast.
„Die Situation ist absolut einmalig.“ Darin sind
sich Stadtförsterin Carmen Hombach und Theo Kaiser,
Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung
Kulmbach/Stadtsteinach einig. Der Borkenkäfer hat in
vielen Teilen des Kulmbacher Landkreises ganze
Arbeit geleistet. Besonders schlimm sei es in den
Gemeindegebieten von Grafengehaig, Presseck,
Rugendorf und Stadtsteinach. Aber auch viele andere
Orte bleiben nicht verschont. Derzeit sind die
Forstarbeiter unter anderem in einem Waldstück bei
Marktschorgast zugange.
Kulmbach/Marktschorgast.
„Die Situation ist absolut einmalig.“ Darin sind
sich Stadtförsterin Carmen Hombach und Theo Kaiser,
Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung
Kulmbach/Stadtsteinach einig. Der Borkenkäfer hat in
vielen Teilen des Kulmbacher Landkreises ganze
Arbeit geleistet. Besonders schlimm sei es in den
Gemeindegebieten von Grafengehaig, Presseck,
Rugendorf und Stadtsteinach. Aber auch viele andere
Orte bleiben nicht verschont. Derzeit sind die
Forstarbeiter unter anderem in einem Waldstück bei
Marktschorgast zugange.
Im Wald der Kulmbacher Stadtwerke hat sich der Käfer dort auf zwei bis drei Hektar ausgebreitet. Es sind viele aneinander gereihte Nester, sagt Stadtförsterin Hombach, die auch Vorsitzende der Waldbesitzer ist. Je nach Bodenbeschaffenheit sei der Käfer mehr oder weniger festzustellen. Flachgründige Standorte auf der Fränkischen Linie seien besonders betroffen, so Kaiser. Gerade im Frankenwald sei die Fichte über viele Jahre hinweg an viel Wasser gewöhnt gewesen und habe deshalb nicht besonders tief gewurzelt. Plötzlich ist das Wasser weg und die Fichte scheitert an der Trockenheit. Und mit der Trockenheit kommt der Käfer.
Zwei bis vier Monate wird es hier im Kulmbacher Stadtwald bei Marktschorgast schon dauern, bis das gesamte Käferholz abgefahren ist. „Die Nachfrage nach Holzeinschlag und Abtransport ist derzeit einfach zu groß“, so der WBV-Geschäftsführer. 5000 Festmeter würden derzeit pro Woche im Kulmbacher Land eingeschlagen, zu normalen Zeiten waren es 500 Festmeter. Klar, dass da die Kapazitäten eng werden. „Das muss man erst einmal alles auf die Reihe kriegen.“
Die mit großem Abstand am meisten betroffene Baumart ist mit 95 Prozent die Fichte. „Wir rechnen damit, dass der Fichtenbestand in unseren Breiten gewaltig zurückgeht“, sagt die Stadtförsterin. Dann habe auch der Käfer nichts mehr zu melden. Bleiben die Jahre weiter so trocken wie jetzt, habe die Fichte unter Umständen überhaupt keine Chance mehr.
.jpg) Auf
einen besonders milden oder besonders strengen
Winter zu hoffen, bringt nichts. Der Käfer werde
überleben. Bleibt die Witterung mild, dann niste
sich der Käfer unter der Baumrinde ein, dann könne
man ihn sogar noch am ehesten bekämpfen. Wird der
Winter hart, gräbt sich der Borkenkäfer in die Erde
ein. „Dann haben wir keine Chance, ihn zu kriegen.“
Versuche hätten sogar ergeben, dass der Borkenkäfer
Temperaturen im tiefgefrorenen Zustand mit bis zu
minus 18 Grad Celsius überlebt.
Auf
einen besonders milden oder besonders strengen
Winter zu hoffen, bringt nichts. Der Käfer werde
überleben. Bleibt die Witterung mild, dann niste
sich der Käfer unter der Baumrinde ein, dann könne
man ihn sogar noch am ehesten bekämpfen. Wird der
Winter hart, gräbt sich der Borkenkäfer in die Erde
ein. „Dann haben wir keine Chance, ihn zu kriegen.“
Versuche hätten sogar ergeben, dass der Borkenkäfer
Temperaturen im tiefgefrorenen Zustand mit bis zu
minus 18 Grad Celsius überlebt.
Was passiert auf den Flächen, von denen das Käferholz abtransportiert wurde? In dem Waldstück bei Marktschorgast sei bereits mit der Waldverjüngung begonnen worden, erläutert Hombach. Hier wachse das Laubholz schon nach, vor allem Buche und Ahorn. So könne am schnellsten wieder ein geschlossener Bestand heranwachsen. Die große Kunst sei es allerdings, die befallenen Fichten so aus dem Wald zu transportieren, dass die nachwachsenden Laubbäume keinen Schaden nehmen. Da braucht es schon echte Profis.
Ein Lichtblick war es, dass zumindest die Preise im zweiten Quartal des laufenden Jahres nicht schlecht waren. „Nun ist die Entwicklung aber schon wieder rückläufig“, sagt Theo Kaiser, der im Schnitt vom 60 bis 70 Euro pro Festmeter Käferholz spricht. Gründe für die rückläufige Entwicklung gibt es viele. Die Lager der Sögewerke seien voll, die Baukonjunktur lasse aufgrund befürchteter Risiken nach, dazu komme eine unsichere Situation durch die Preissteigerungen. „Die Menschen sind nicht mehr so zuversichtlich.“
Gut vermarkten lasse sich dagegen Energieholz. Gerade bei den Brennholzsortimenten würden die Preise wieder anziehen. Allerdings verdienten sich die Waldbesitzer bei weitem keine goldenen Nasen damit, wie manche vermuten. Immerhin sei Brennholz noch bis Mitte des Jahres defizitär gewesen.
Bilder:
1. In
diesem Waldstück nahe Marktschorgast sieht auch der
Laie die immensen Schäden, die der Borkenkäfer
angerichtet hat.
2. Stadtförsterin Carmen Hombach, Praktikant Noah
Partenfelder aus Kirchleus und der Geschäftsführer
der Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach
begutachten das Holz, das im Wald der Kulmbacher
Stadtwerke bereits zum Abtransport bereit liegt.
Stimmung bei den Bauern: „Zwischen gedämpften Optimismus und purer Verzweiflung“ / Tag der Landwirtschaft lockte viele hundert Besucher nach Schirradorf
.jpg) Schirradorf.
Mit einer großen Land- und Forsttechnikausstellung
haben Bauernverband und das Unternehmen Nicklas
Landtechnik den Tag der Landwirtschaft gefeiert. Ein
Gottesdienst mit dem Posaunenchor Wonsees am Morgen
und zahlreiche Attraktionen lockten mehrere hundert
Besucher nach Schirradorf, obwohl die traditionelle
Oldtimer-Traktorrundfahrt diesmal nicht stattfand.
Dafür feierte das Unternehmen seine 25-jährige
Partnerschaft mit dem US-amerikanischen
Landmaschinenhersteller John Deere. Da durfte
natürlich der John-Deere-Fanclub mit seinem
Vorsitzenden Friedbert Weiß an der Spitze nicht
fehlen.
Schirradorf.
Mit einer großen Land- und Forsttechnikausstellung
haben Bauernverband und das Unternehmen Nicklas
Landtechnik den Tag der Landwirtschaft gefeiert. Ein
Gottesdienst mit dem Posaunenchor Wonsees am Morgen
und zahlreiche Attraktionen lockten mehrere hundert
Besucher nach Schirradorf, obwohl die traditionelle
Oldtimer-Traktorrundfahrt diesmal nicht stattfand.
Dafür feierte das Unternehmen seine 25-jährige
Partnerschaft mit dem US-amerikanischen
Landmaschinenhersteller John Deere. Da durfte
natürlich der John-Deere-Fanclub mit seinem
Vorsitzenden Friedbert Weiß an der Spitze nicht
fehlen.
„Handwerk und Landwirtschaft haben goldenen Boden.“ Davon zeigte sich der Chef des Landtechnikunternehmens Edwin Nicklas überzeugt. Er spielte damit auf den Fachkräftemangel in seiner Branche an. „Wir brauchen dringend Landmaschinenmechatroniker mit Leidenschaft und Liebe zum Beruf“, sagte er. Keine Maschine werde einen qualifizierten Handwerker jemals ersetzen können. Deshalb müsse man den jungen Leuten zeigen, wie gut und wichtig das Handwerk ist.
.jpg) Wenn
der Fachkräftemangel nur das einzige Problem wäre.
Edwin Nicklas beschrieb die momentane Stimmung unter
den Landwirten als „zwischen gedämpften Optimismus
und purer Verzweiflung“. Er sprach von absoluten
Krisenzeiten. Eine so hohe Inflation mit
Abschwächung der Konjunktur und ein Nachlassen der
Investitionsbereitschaft: „So etwas habe ich mit
meinen 62 Jahren noch nicht erlebt.“ Verbindliche
Lieferzeiten könne er gar nicht mehr nennen, manche
Computer-Chips für Landmaschinen, die früher 14 Euro
gekostet hätten lägen mittlerweile bei 1400 Euro.
Wenn
der Fachkräftemangel nur das einzige Problem wäre.
Edwin Nicklas beschrieb die momentane Stimmung unter
den Landwirten als „zwischen gedämpften Optimismus
und purer Verzweiflung“. Er sprach von absoluten
Krisenzeiten. Eine so hohe Inflation mit
Abschwächung der Konjunktur und ein Nachlassen der
Investitionsbereitschaft: „So etwas habe ich mit
meinen 62 Jahren noch nicht erlebt.“ Verbindliche
Lieferzeiten könne er gar nicht mehr nennen, manche
Computer-Chips für Landmaschinen, die früher 14 Euro
gekostet hätten lägen mittlerweile bei 1400 Euro.
Edwin Nicklas legt Wert darauf, dass die Landtechnik zu den systemrelevanten und krisensicheren Branchen gehört. Trotzdem rückten plötzlich Themen wie Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln und Energie in den Vordergrund. Lange habe in der Politik die Meinung vorgeherrscht, was wir nicht selbst produzieren besorgen wir uns auf den Weltmärkten. Corona und der Krieg in der Ukraine hätten nun gezeigt, wie kurzsichtig und unrealistisch diese Sichtweise ist.
.jpg) „Versorgungssicherheit,
mit landwirtschaftlichen Produkten im eigenen Land
und eine umweltverträgliche Landwirtschaft schließen
einander nicht aus“, sagte Edwin Nicklas. Doch statt
wirksam Hilfe zu leisten überziehe die Politik die
Landwirtschaft mit unendlichen Verordnungen, einer
ständig wachsenden Bürokratie,
Dokumentationspflichten oder neuen Rahmenbedingungen
in der Tierhaltung. „Die Regulierungswut und extrem
gestiegene Produktionskosten stellten viele
Familienbetriebe vor große Probleme oder zwingen sie
zum Aufhören.“
„Versorgungssicherheit,
mit landwirtschaftlichen Produkten im eigenen Land
und eine umweltverträgliche Landwirtschaft schließen
einander nicht aus“, sagte Edwin Nicklas. Doch statt
wirksam Hilfe zu leisten überziehe die Politik die
Landwirtschaft mit unendlichen Verordnungen, einer
ständig wachsenden Bürokratie,
Dokumentationspflichten oder neuen Rahmenbedingungen
in der Tierhaltung. „Die Regulierungswut und extrem
gestiegene Produktionskosten stellten viele
Familienbetriebe vor große Probleme oder zwingen sie
zum Aufhören.“
Im Rahmen der Land- und Forsttechnikausstellung waren nicht nur Traktoren, neu und gebraucht zu sehen, sondern auch Mähdrescher, Lade- und Silierwagen, Düngestreuer und vieles mehr sowie die gesamte Palette von Technik zur Rasen und Grundstückspflege. Der Besucherstrom aus dem gesamten Landkreis sowie den benachbarten Regionen riss trotz des durchwachsenen Wetter bis zum späten Nachmittag nicht ab..
Bilder:
1. Edwin
Nicklas (rechts) vom gleichnamigen
Landtechnikunternehmen und Friedbert Weiß vom
John-Deere-Fanclub freuten sich über den großen
Zuspruch beim Tag der Landwirtschaft in Schirradorf.
2.+3. Zahlreiche Besucher waren zur großen Land- und
Forsttechnikausstellung auf das Gelände von
Nicklas-Landtechnik in Schirradorf gekommen.
„Ohne Wald kein Wild“ / Wald steht vor großen Herausforderungen - Kulmbacher Jägerverein feierte 100. Geburtstag
.jpg) Kulmbach.
„Jäger sind keine Killer.“ Der Satz fiel gleich
mehrfach bei der 100-Jahr-Feier des „Jagdschutz- und
Jägereins Kulmbach“ am Freitag in den Räumen der
Mönchshof-Museen. Die Jagd ist aber auch weder Hobby
noch Sport, sondern vielmehr Teil der Landwirtschaft
Jagd steht für Natur- und Artenschutz, für den
Einsatz der um die Artenvielfalt und für den Schutz
des Klimas.
Kulmbach.
„Jäger sind keine Killer.“ Der Satz fiel gleich
mehrfach bei der 100-Jahr-Feier des „Jagdschutz- und
Jägereins Kulmbach“ am Freitag in den Räumen der
Mönchshof-Museen. Die Jagd ist aber auch weder Hobby
noch Sport, sondern vielmehr Teil der Landwirtschaft
Jagd steht für Natur- und Artenschutz, für den
Einsatz der um die Artenvielfalt und für den Schutz
des Klimas.
Das Schießen macht bei der Jagd den kleinsten Teil aus, sagte der Vorsitzende Peter Müller aus Thurnau. „Wir wollen vielmehr den Menschen Tiere und Natur näher bringen.“ Ein wichtiger Teil spiele dabei die Umweltbildung, beispielsweise bei Waldspaziergängen für Schulklassen, die der Jägerverein immer wieder anbietet. Wir wollen Wild, Wald, Natur und Landschaft in den Focus rücken, so der stellvertretende Vorsitzende Otto Kreil.
Peter Müller ließ die Geschichte des Jägervereins Revue passieren, der exakt am 26. März 1922 gegründet wurde. Heinrich Hoferer hieß der erste Vorsitzende, ihm folgen Manfred Jarosch, Christian Schröppel und Berthold Höhn, ehe Peter Müller 2004 seine Amtszeit antrat. Als einen Meilenstein nannte er 1950 die Gründung des Kulmbacher Bläser-Corps. Überhaupt seien Bläsergruppen, von denen es mittlerweile sogar zwei gibt, ein bedeutender Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. Sowohl die Es-Hornbläser, als auch die Parforce-Hornbläser umrahmen beispielsweise regelmäßig die Erntedankgottesdienste oder sorgen mit Standkonzerten für Aufsehen.
.jpg) Prominente
Rednerin zum Jubiläum war die bayerische
Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, die
besonders auf die zahlreichen aktuellen Probleme von
Wild und Wald einging. Klimawandel, Trockenheit,
Dürrejahre, Borkenkäfer, das alles setze dem Wald
derzeit gehörig zu. „Ganze Landstriche vertrocknen
schlichtweg“, sagte sie mit Blick auf den
Frankenwald. Die Jagd alleine werde es nicht
schaffen, den Wald zu retten. Sie könne aber einen
wichtigen Beitrag dazu leisten. Schließlich müsse
gelten: „Es zählt jeder Hektar, den wir retten
können“.
Prominente
Rednerin zum Jubiläum war die bayerische
Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, die
besonders auf die zahlreichen aktuellen Probleme von
Wild und Wald einging. Klimawandel, Trockenheit,
Dürrejahre, Borkenkäfer, das alles setze dem Wald
derzeit gehörig zu. „Ganze Landstriche vertrocknen
schlichtweg“, sagte sie mit Blick auf den
Frankenwald. Die Jagd alleine werde es nicht
schaffen, den Wald zu retten. Sie könne aber einen
wichtigen Beitrag dazu leisten. Schließlich müsse
gelten: „Es zählt jeder Hektar, den wir retten
können“.
Der Wildbestand spielt nach Auffassung der Ministerin deshalb eine wichtige Rolle, weil er in den allermeisten Regionen einfach nicht mehr ausgeglichen sei. Auch in sämtlichen Revieren des Kulmbacher Landkreises sei die Verbissbelastung einfach zu hoch. Kaniber bemühte dabei einmal mehr den Grundsatz „Wald vor Wild“, der zwar im Gesetz so steht, der aber mittlerweile völlig instrumentalisiert werde. „Wald ohne Wild“, das möchte sicher keiner, „Wald und Wild“ klinge zwar sanft, dabei dürfe man aber nicht vergessen, dass es ohne den Wald auch kein Wild gibt. „Mit ist beides wichtig, der Wald, aber auch das Wild“, sagte die Ministerin. „Das eine geht nicht ohne das andere.“
.jpg) 100
Jahre Jagdschutz bedeute auch 100 Jahre Tier- und
Naturschutz, sagte der Landtagsabgeordnete und
stellvertretende Vorsitzende des Landtagsausschusses
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Martin
Schöffel. Jäger seien die echten Naturschützer, so
Schöffel, der selbst stellvertretender Vorsitzender
einer Kreisgruppe des Jagdverbandes im
Fichtelgebirge ist. Der oberfränkische
Bezirkstagspräsident Henry Schramm appellierte an
die Jäger, sich nicht von so manchen Tendenzen „in
unserer immer verrückter werdenden Gesellschaft“
abbringen zu lassen. „Lasst euch diese wichtige
gesellschaftliche Aufgabe bloß nicht ausreden“, so
Schramm. Jagd stehe aber auch für Tradition, so
Landrat Klaus-Peter Söllner. Er war sich sicher,
dass die Jagd in weiten Teilen der Gesellschaft noch
immer hoch angesehen ist. „Sie können auf ihre
Arbeit wirklich stolz sein“, brachte es der
Kulmbacher Oberbürgermeister Ingo Lehmann auf den
Punkt.
100
Jahre Jagdschutz bedeute auch 100 Jahre Tier- und
Naturschutz, sagte der Landtagsabgeordnete und
stellvertretende Vorsitzende des Landtagsausschusses
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Martin
Schöffel. Jäger seien die echten Naturschützer, so
Schöffel, der selbst stellvertretender Vorsitzender
einer Kreisgruppe des Jagdverbandes im
Fichtelgebirge ist. Der oberfränkische
Bezirkstagspräsident Henry Schramm appellierte an
die Jäger, sich nicht von so manchen Tendenzen „in
unserer immer verrückter werdenden Gesellschaft“
abbringen zu lassen. „Lasst euch diese wichtige
gesellschaftliche Aufgabe bloß nicht ausreden“, so
Schramm. Jagd stehe aber auch für Tradition, so
Landrat Klaus-Peter Söllner. Er war sich sicher,
dass die Jagd in weiten Teilen der Gesellschaft noch
immer hoch angesehen ist. „Sie können auf ihre
Arbeit wirklich stolz sein“, brachte es der
Kulmbacher Oberbürgermeister Ingo Lehmann auf den
Punkt.
Bilder:
1. Seine
Parforce-Hornbläser sind für den Kulmbacher
Jägerverein ein wichtiger Teil der
Öffentlichkeitsarbeit. Zum 100-Jahr-Feier gaben sie
im Mönchshof ein kleines Standkonzert.
2. Zahlreiche
prominente Gratulanten konnte der Kulmbacher
Jägerverein begrüßen (von links): Vorsitzender Peter
Müller, BBV-Kreisobmann Harald Peetz, Landrat
Klaus-Peter Söllner, der Landtagsabgeordnete Rainer
Ludwig, Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann,
Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber,
Landtagsabgeordneter Martin Schöffel, der bayerische
Jagdpräsident Ernst Weidenbusch und
Bezirkstagspräsident Henry Schramm.
3. Blumen für die Ministerin: Peter Müller
überreichte Michaela Kaniber einen bunten Strauß.
Bauern kritisieren verfehlte Agrarpolitik / Schirradorfer Bauerntag: Schlagabtausch mit der Ministerin
.jpg) Schirradorf.
Zur Generalabrechnung mit der Agrarpolitik hat der
neue Kulmbacher Kreisobmann Harald Peetz den
Schirradorfer Bauerntag auf dem Gelände des
Landtechnikunternehmens Nicklas genutzt. Peetz
sprach von einer völlig verfehlten Politik und ging
vor allem mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem
Özdemir hart ins Gericht. Der Kreisobmann sparte
aber auch nicht mit Kritik an der bayerischen
Politik und an Landwirtschaftsministerin Michaela
Kaniber. Sie war die Hauptrednerin des Bauerntages.
Schirradorf.
Zur Generalabrechnung mit der Agrarpolitik hat der
neue Kulmbacher Kreisobmann Harald Peetz den
Schirradorfer Bauerntag auf dem Gelände des
Landtechnikunternehmens Nicklas genutzt. Peetz
sprach von einer völlig verfehlten Politik und ging
vor allem mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem
Özdemir hart ins Gericht. Der Kreisobmann sparte
aber auch nicht mit Kritik an der bayerischen
Politik und an Landwirtschaftsministerin Michaela
Kaniber. Sie war die Hauptrednerin des Bauerntages.
Was die extreme Dürre in diesem Sommer angeht, so könne es im nächsten Jahr eigentlich nur noch besser werden. Von der Politik habe er diese Hoffnung allerdings nicht mehr. Vor allem Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir gebe ein „trauriges Bild“ ab. Der Minister sei immer auf Seiten der anderen, nie auf der Seite der Bauern. Mittlerweile würden die Bauern nicht mehr vom Landwirtschafts-, sondern vom Umweltministerium regiert. Aber auch in Bayern sei längst nicht mehr alles Gold, was glänzt, so Harald Peetz. Die Politik schiele nur mehr auf die Wähler in den Ballungszentren. Das flache Land gerate dabei in Vergessenheit.
.jpg) Der
Kreisobmann wehrte sich vor allen dagegen, dass
überall grüne Ideologien durchgesetzt werden sollen.
Artenvielfalt, Biodiversität oder Insektenschutz
seien zwar richtig. Dabei gerate allerdings in
Vergessenheit, dass die Bauern die Versorgung der
Menschen mit Lebensmitteln sicherstellen. „Wenn ich
die Produktion hier einschränke, dann mache ich mich
vom Ausland abhängig“, sagte Harald Peetz. Niemand
könne dann mehr für Umweltstandards, Tierwohl oder
sachgerechten Pflanzenschutz garantieren.
Der
Kreisobmann wehrte sich vor allen dagegen, dass
überall grüne Ideologien durchgesetzt werden sollen.
Artenvielfalt, Biodiversität oder Insektenschutz
seien zwar richtig. Dabei gerate allerdings in
Vergessenheit, dass die Bauern die Versorgung der
Menschen mit Lebensmitteln sicherstellen. „Wenn ich
die Produktion hier einschränke, dann mache ich mich
vom Ausland abhängig“, sagte Harald Peetz. Niemand
könne dann mehr für Umweltstandards, Tierwohl oder
sachgerechten Pflanzenschutz garantieren.
Statt ständig neuer Auflagen und immer mehr Bürokratie bräuchten die Bauern eine zuverlässige Politik, die fest an ihrer Seite steht. Jeder Betrieb, der jetzt aufgibt, sei für immer verloren. Das Ende der Schweinehaltung sei bereits eingeläutet.
Kreisobmann Peetz ging Ministerin Kaniber aber auch direkt wegen deren Aussagen zur Anbindehaltung an. Diese seien „überflüssig wie ein Kropf“ gewesen und hätten nur Wasser auf die Mühlen der Tierhaltungsgegner gebracht. In Zukunft werde man noch froh sein, wenn man überhaupt noch Milch habe, egal aus welcher Haltungsform. Darüber hinaus würden in Deutschland ohnehin keine Anbindeställe mehr gebaut und die Anbindehaltung laufe sowieso aus.
.jpg) Das
ließ die Ministerin so nicht auf sich sitzen. Einige
Molkereien hätten schon damals keine Milch mehr aus
Anbindehaltung angenommen. Als das bekannt wurde,
habe sie es auch gesagt. „Mir war es wichtig, dass
die bayerischen Bauern wissen, wohin die Reise
geht“, sagte Kaniber. Auf diese Situation müssten
sich die Landwirte einstellen. Die Ministerin hatte
im vergangenen Jahr in einer Regierungserklärung
angekündigt, dass die ganzjährige Anbindehaltung so
schnell wie möglich beendet werden muss.
Das
ließ die Ministerin so nicht auf sich sitzen. Einige
Molkereien hätten schon damals keine Milch mehr aus
Anbindehaltung angenommen. Als das bekannt wurde,
habe sie es auch gesagt. „Mir war es wichtig, dass
die bayerischen Bauern wissen, wohin die Reise
geht“, sagte Kaniber. Auf diese Situation müssten
sich die Landwirte einstellen. Die Ministerin hatte
im vergangenen Jahr in einer Regierungserklärung
angekündigt, dass die ganzjährige Anbindehaltung so
schnell wie möglich beendet werden muss.
Was die Beurteilung der Bundespolitik aus Sicht der Landwirtschaft anging, teilte die Michaela Kaniber allerdings die Meinung von Kreisobmann Peetz und fand dafür ungewöhnlich scharfe Worte. „Özdemir hat weder Interesse an, noch Verständnis für die Landwirtschaft“, sagte sie. „Die grünen Pazifisten kennen sich mittlerweile mit Panzern besser aus, als wir das jemals taten“. An dem Thema Ernährungssicherheit hätten die Grünen dagegen kein Interesse.
.jpg) Die
Ministerin plädierte für eine grundlegende
Neubewertung des sogenannten Green Deals
(Reduzierung der Netto-Emissionen von Treibhausgasen
bis 2050 auf null), als auch der gesamten
gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik. Die Situation
habe sich mittlerweile völlig verändert. Nach
jetzigem Stand würden die geplanten
Flächenstilllegungen zu jeweils einem Drittel
weniger Rindfleisch und Getreide führen. Zudem würde
Özdemirs Ankündigung „öffentliches Geld nur noch für
öffentliche Leistungen“ nichts anderes bedeuten, als
50 Prozent weniger Einkommen für die Bauern.
Die
Ministerin plädierte für eine grundlegende
Neubewertung des sogenannten Green Deals
(Reduzierung der Netto-Emissionen von Treibhausgasen
bis 2050 auf null), als auch der gesamten
gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik. Die Situation
habe sich mittlerweile völlig verändert. Nach
jetzigem Stand würden die geplanten
Flächenstilllegungen zu jeweils einem Drittel
weniger Rindfleisch und Getreide führen. Zudem würde
Özdemirs Ankündigung „öffentliches Geld nur noch für
öffentliche Leistungen“ nichts anderes bedeuten, als
50 Prozent weniger Einkommen für die Bauern.
Bilder:
1.
Der Landtagsabgeordnete
Martin Schöffel, Kreisbäuerin Beate Opel,
Landtagsabgeordneter Rainer Ludwig, Ministerin
Michaela Kaniber, Landrat Klaus-Peter Söllner, Gabi
und Edwin Nicklas, Bürgermeister Andreas Pöhner und
Kreisobmann Harald Peetz (von links) beim
Schirradorfer Bauerntag auf dem Gelände des
Landtechnikunternehmens Nicklas.
2. BBV-Kreisobmann
Harald Peetz.
3. Die
bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela
Kaniber.
4. BBV-Kreisbäuerin Beate Opel und Kreisobmann
Harald Peetz überreichten der Ministerin einen
getöpferten Erinnerungsteller aus Thurnau als
Gastgeschenk.
Gemeinschaft statt Leerstand / Förderoffensive macht es möglich: Neues Dorfgemeinschaftshaus in Grafengehaig eingeweiht
.jpg) Grafengehaig.
Nach drei Jahren Umbauzeit und mit einem
Kostenaufwand von gut 1,4 Millionen Euro ist in der
Ortsmitte von Grafengehaig ein Dorfgemeinschaftshaus
mit Begegnungsstätte, Vereinszimmern, Praxisräumen
und einem Dorfladen entstanden. Das Projekt wurde zu
90 Prozent aus der Förderoffensive Nordostbayern
bezuschusst. „Damit unterstützen wir gezielt die
ländlichen Gemeinden in Oberfranken und der
Oberpfalz bei der Innenentwicklung“, sagte die für
das Programm zuständige Landwirtschaftsministerin
Michaela Kaniber bei der Einweihung.
Grafengehaig.
Nach drei Jahren Umbauzeit und mit einem
Kostenaufwand von gut 1,4 Millionen Euro ist in der
Ortsmitte von Grafengehaig ein Dorfgemeinschaftshaus
mit Begegnungsstätte, Vereinszimmern, Praxisräumen
und einem Dorfladen entstanden. Das Projekt wurde zu
90 Prozent aus der Förderoffensive Nordostbayern
bezuschusst. „Damit unterstützen wir gezielt die
ländlichen Gemeinden in Oberfranken und der
Oberpfalz bei der Innenentwicklung“, sagte die für
das Programm zuständige Landwirtschaftsministerin
Michaela Kaniber bei der Einweihung.
In dem denkmalgeschützten Haus am Marktplatz war zuletzt eine Sparkassenfiliale untergebracht. Früher beherbergte das stattliche Gebäude einen Gasthof. Nun hatte der Markt Grafengehaig das Haus erworben und zu einer Begegnungsstätte umgewandelt. „Damit geht auch der Wunsch vieler Grafengehaiger Bürgerinnen und Bürger in Erfüllung“, so Bürgermeister Werner Burger.
Marktplatz, Dorfladen, ein Freisitz für Besucher und ein Mehrgenerationenspielplatz sollen künftig eine Einheit bilden, sagte das Gemeindeoberhaupt. Ein neu erbautes barrierefreies Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten mit Mitteln aus dem bayerischen Wohnraumförderprogramm runde die Lage hervorragend ab. Als die Förderoffensive Nordostbayern im Jahr 2017 auf den Weg gebracht worden sei, habe Grafengehaig sofort reagiert und die Projekte angemeldet, erinnerte sich der Bürgermeister. Zusammen mit einem kleinen Bürgergarten in Eppenreuth könne das Projekt nun erfolgreich abgeschlossen werden.
Genau das sei auch der Zukunftsweg für die ländlichen Kommunen, so Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Es müsse darum gehen, lebendige und attraktive Ortskerne zu sichern, Flächen und Ressourcen zu schonen und den eigenständigen Charakter des Dorfes zu bewahren. All das sei in Grafengehaig hervorragend gelungen. Mit diesem zentralen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft habe der Ort ein Stück oberfränkische Heimat und prägende Baukultur für die nächste Generation erhalten. „Mit diesen Projekten in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rathaus ist aus der Ortsmitte von Grafengehaig ein richtiges Schmuckstück geworden“, sagte die Ministerin.
.jpg) Insgesamt
hätten im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern
in Oberfranken und in der Oberpfalz 192 Vorhaben auf
den Weg gebracht werden können. Ihr Ministerium habe
dafür Mittel in Höhe von 70 Millionen Euro
bewilligt, bilanzierte Michaela Kaniber.
Insgesamt
hätten im Rahmen der Förderoffensive Nordostbayern
in Oberfranken und in der Oberpfalz 192 Vorhaben auf
den Weg gebracht werden können. Ihr Ministerium habe
dafür Mittel in Höhe von 70 Millionen Euro
bewilligt, bilanzierte Michaela Kaniber.
Dorfgemeinschaftshaus und Dorfladen stünden für Gemeinschaft, sagte Landrat Klaus-Peter Söllner. Gerade in den Dörfern sei die Gemeinschaft durch nichts zu ersetzen, auch nicht durch soziale Medien. Von einem Musterbeispiel in einer Modellkommune im ländlichen Raum sprach der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Landtagsausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Martin Schöffel. Pfarrerin Heidrun Hemme nahm die kirchliche Segnung des Anwesens vor, ehe sich die Ministerin in das Goldene Buch der Gemeinde eintrug und einen Rundgang durch das Dorfgemeinschaftshaus, den Dorfladen und den Mehrgenerationenspielplatz startete
Bilder:
1. Der
Kulmbacher Landrat Klaus-Peter Söllner,
Landtagsabgeordneter Martin Schöffel,
Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber,
Bürgermeister Werner Burger und Landtagsabgeordneter
Rainer Ludwig (von links) freuten ich über den
gelungenen Umbau des zuletzt leerstehenden Anwesens
zum Dorfgemeinschaftshaus.
2. Ein
wichtiger Bestandteil des neuen Areals mitten in
Grafengehaig ist der Dorfladen.
Musterbeispiel: Strom und Wärme aus regenerativen Energien / Hackschnitzelheizwerk und Biogasanlage in Hollfeld waren Vorreiter
 Hollfeld.
Um die Energiewende bewältigen zu können, braucht es
einen Mix aller regenerativen Möglichkeiten. „Wenn
wir nicht von den fossilen Energieträgern wegkommen,
geht die Welt zugrunde“, meint Michael Schatz (65).
In Sachen Hackschnitzel und Biogas gehört der
Landwirt aus Hollfeld zu den Pionieren. Er hatte
viel früher als die meisten anderen die
entscheidenden Anstöße zum Bau einer
Hackschnitzelheizung und einer Biogasanlage gegeben.
Die Hollfelder Anlagen gelten heute gerade vor der
aktuellen Entwicklung mit einer Explosion der Preise
bei fossilen Brennstoffen in jeder Hinsicht als
mustergültig.
Hollfeld.
Um die Energiewende bewältigen zu können, braucht es
einen Mix aller regenerativen Möglichkeiten. „Wenn
wir nicht von den fossilen Energieträgern wegkommen,
geht die Welt zugrunde“, meint Michael Schatz (65).
In Sachen Hackschnitzel und Biogas gehört der
Landwirt aus Hollfeld zu den Pionieren. Er hatte
viel früher als die meisten anderen die
entscheidenden Anstöße zum Bau einer
Hackschnitzelheizung und einer Biogasanlage gegeben.
Die Hollfelder Anlagen gelten heute gerade vor der
aktuellen Entwicklung mit einer Explosion der Preise
bei fossilen Brennstoffen in jeder Hinsicht als
mustergültig.
Aktuell versorgen Hackschnitzelheizung und Biogasanlage unter anderem die Gesamtschule, die Grundschule, zwei Kindergärten, das Rathaus, das Altenheim, Kirche und Stadtapotheke und viele Privatleute mit Wärme. Pro Jahr werden, je nachdem wie streng der Winter ausfällt, 700000 bis 800000 Liter Heizöl eingespart. Der erzeugte Strom wird ins Netz eingespeist.
„Die Hollfelder Anlage ist beispielhaft“, sagt Schatz, der zusammen mit Manuel Appel vom Maschinenring als Geschäftsführer an der Spitze der Biogasanlage steht. Gesellschafter sind in erster Linie die beteiligten Bauern über die MR Agrarservice GmbH, die Stadt Hollfeld, der Zweckverband Gesamtschule, die Waldbauernvereinigung Hollfeld und der Maschinenring Fränkische Schweiz.
Michael Schatz sieht im Biogas ganz klar viele Vorteile vereint. Vor allem könne man den Ertrag von den Feldern dort verwenden, wo er am dringendsten gebracht wird, auf dem Teller, also für die Nahrungsmittelproduktion, oder für den Tank, also zur Energieerzeugung mit Strom und Wärme. Als weiteren Vorteil bezeichnete er es, dass man das für die Anlage notwendige Material lagern und somit auch mal eine Dürrejahr, wie das jetzige überbrücken kann.
Bereits 2003 setzte man in Hollfeld auf regenerative Energien. Als die Gesamtschule eine neue Heizung benötigte, entschied man sich für die Wärme von Hackschnitzeln. Schnell kamen Grundschule, Rathaus und einige Privatleute dazu, so dass die Wärme schon bald nicht mehr ausreichte. An der Leistungsgrenze angekommen musste also eine weitere Energiequelle erschlossen werden. Die Lösung sah man im Bau einer Biogasanlage. 28 Landwirte aus der engsten Umgebung hatten sich von Anfang an daran beteiligt, brachten Geld als Darlehen ein und gingen eine Lieferverpflichtung ein. Die Investition lag damals bei 2,3 Millionen Euro. Rein theoretisch erzeugt die Anlage so viel Strom, wie in der Stadt Hollfeld verbraucht wird. Mit der Abwärme könne man den Bedarf gut decken.
Der Mix aus Biogas und Hackschnitzeln sei absolut richtig gewesen, sagt Michael Schatz. Im Moment könne man sich vor Nachfragen kaum retten. „Wir haben Anfragen von Privatleuten ohne Ende.“. Gerade habe man wieder fünf neue Haushalte an das vier Kilometer lange Leitungsnetz angeschlossen. Der jetzige Hackschitzelofen habe eine Leistung von 1000 kw, die Biogasanlage von zwei Mal 400 kw. Aktuell bestücken 30 Bauern die Anlage mit Gülle, Ganzpflanzensilage, Gras und der Energiepflanzen Silphie. Den Gärrest bekommen die Bauern zurück.
Trotz der aktuell katastrophalen Ernte seien die Speicher derzeit gut gefüllt und reichten auch über den Winter. Ein zweites Dürrejahr, so wie das jetzige, dürfe allerdings nicht noch einmal kommen. In der Biogasanlage beschäftigt die GmbH mit Landwirtschaftsmeister Roland Beetz als Betriebsleiter eine Vollzeitkraft. Geschäftsführung und Buchhaltung besorgt der Maschinenring.
Bild: Geschäftsführer Michael Schatz (links) und Betriebsleiter Roland Beetz sorgen auf der Hollfelder Biogasanlage für die optimale Versorgung.
Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft rücken / Beate Opel löst Anneliese Göller als oberfränkische Bezirksbäuerin ab
.jpg) Himmelkron.
Die Kulmbacher Kreisbäuerin Beate Opel aus Neufang
bei Wirsberg ist die neue oberfränkische
Bezirksbäuerin. Bei der Wahl in Himmelkron wurde sie
einstimmig für die nächsten fünf Jahre in das Amt
gewählt. Die 62-Jährige löst damit die bisherige
Bezirksbäuerin Anneliese Göller aus dem Landkreis
Bamberg ab, die nicht mehr zur Wahl angetreten war.
Himmelkron.
Die Kulmbacher Kreisbäuerin Beate Opel aus Neufang
bei Wirsberg ist die neue oberfränkische
Bezirksbäuerin. Bei der Wahl in Himmelkron wurde sie
einstimmig für die nächsten fünf Jahre in das Amt
gewählt. Die 62-Jährige löst damit die bisherige
Bezirksbäuerin Anneliese Göller aus dem Landkreis
Bamberg ab, die nicht mehr zur Wahl angetreten war.
Beate Opel ist bereits seit dem Jahr 2017 auf oberfränkischer Ebene als stellvertretende Bezirksbäuerin aktiv. Sie wurde erst vor kurzem zum dritten Mal zur Kulmbacher Kreisbäuerin gewählt, gleichzeitig ist sie seit 30 Jahren als Ortsbäuerin tätig. Beate Opel hat zwei Töchter und einen Sohn, zusammen mit ihrer Familie bewirtschaftet sie einen Milchviehbetrieb mit Bullenmast.
Zur neuen stellvertretenden Bezirksbäuerin wählten die Delegierten mit großer Mehrheit die Lichtenfelser Kreisbäuerin Marion Warmuth. Beisitzerinnen im Bezirksvorstand sind die neue Forchheimer Kreisbäuerin Christine Werner (43), die Wunsiedler Kreisbäuerin Karin Reichel und Nicole Werthmann (40) aus Sassanfahrt im Landkreis Bamberg.
In ihrer Antrittsrede appellierte Beate Opel vor allem an den Zusammenhalt. „Ich möchte, dass wir zu einer großen Familie zusammenwachsen“, sagte sie vor dem Hintergrund der anstehenden Herausforderungen nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in der gesamten Gesellschaft. Die neue Bezirksbäuerin bedankte sich bei ihrer Vorgängerin Anneliese Göller, die vieles angestoßen und eine herausragende Arbeit geleistet habe.
.jpg) Ziel
der Landfrauenarbeit sollte es auch in Zukunft sein,
ein besonderes Augenmerk auf die
Öffentlichkeitsarbeit zu legen und dabei besonders
bei Kindern anzusetzen. Die Landwirtschaft sei
leider nicht mehr in der Gesellschaft verankert,
deshalb sollte es die Aufgabe der Landfrauen sein,
vor allem Kinder und Jugendliche auf die Höfe zu
holen, um Zusammenhänge aufzuzeigen und
Landwirtschaft zu erklären. Beate Opel appellierte
aber auch an das Selbstbewusstsein der Landfrauen:
„Wir leiste eine schwere Arbeit, das soll uns erst
einmal jemand nachmachen.“
Ziel
der Landfrauenarbeit sollte es auch in Zukunft sein,
ein besonderes Augenmerk auf die
Öffentlichkeitsarbeit zu legen und dabei besonders
bei Kindern anzusetzen. Die Landwirtschaft sei
leider nicht mehr in der Gesellschaft verankert,
deshalb sollte es die Aufgabe der Landfrauen sein,
vor allem Kinder und Jugendliche auf die Höfe zu
holen, um Zusammenhänge aufzuzeigen und
Landwirtschaft zu erklären. Beate Opel appellierte
aber auch an das Selbstbewusstsein der Landfrauen:
„Wir leiste eine schwere Arbeit, das soll uns erst
einmal jemand nachmachen.“
Zuvor war Anneliese Göller als oberfränkische Bezirksbäuerin mit lang anhaltendem Applaus und Standing Ovations verabschiedet worden. Sie war 15 Jahre als Bezirksbäuerin und vorher fünf Jahre als Stellvertreterin tätig. As oberstes Ziel der Landfrauenarbeit bezeichnete es Anneliese Göller, die Landwirtschaft in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. „Die Themen verändern sich, nicht aber die gemeinsamen Ziele“, sagte sie. Der Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft gehöre dazu genauso wie die Schaffung einer lebenswerten Zukunft gerade für den ländlichen Raum.
Ein besonderes Augenmerk legte Anneliese Göller auf die zurückliegende Wahlperiode, die aufgrund der Corona-Pandemie anders als alle je zuvor gewesen sei. „Corona hat uns ausgebremst und stellte uns vor große Herausforderungen“, doch auch das hätten die Landfrauen bewältigt, unter anderem mit dem ersten bayerischen virtuellen Landfrauentag.
Bis zur Neuwahl am 17. Oktober in Herrsching bleibt Anneliese Göller als Landesbäuerin noch im Amt.
Bilder.
1. Beate Opel folgt auf Anneliese Göller als neue
oberfränkische Bezirksbäuerin Im Bild von links:
Anneliese Göller, BBV-Direktor Dr. Wilhelm Böhmer,
Christine Werner, Marion Warmuth, Beate Opel, Nicole
Werthmann, Karin Reichel und der oberfränkische
BBV-Präsident Hermann Greif.
2. Die bisherige Bezirksbäuerin Anneliese Göller
(rechts) gratulierte ihrer Nachfolger Beate Opel.
Bauern nehmen Artenschutz ernst / Ortstermin zum Insektenschutz in Laubersreuth bei Münchberg
 Laubersreuth.
Imker, Jäger und Landwirte engagieren sich für
Insekten- und Artenschutz, und das nicht erst seit
dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Darauf hat
der Bauernverband Hof mit einer medienwirksamen
Aktion auf den Flächen von Klaus-Dieter Bäger
aufmerksam gemacht. Der Landwirt aus Konradsreuth
legt schon seit weit über zehn Jahren Blühwiesen
rund um seine Flächen in Laubersreuth bei Münchberg
an.
Laubersreuth.
Imker, Jäger und Landwirte engagieren sich für
Insekten- und Artenschutz, und das nicht erst seit
dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Darauf hat
der Bauernverband Hof mit einer medienwirksamen
Aktion auf den Flächen von Klaus-Dieter Bäger
aufmerksam gemacht. Der Landwirt aus Konradsreuth
legt schon seit weit über zehn Jahren Blühwiesen
rund um seine Flächen in Laubersreuth bei Münchberg
an.
„Darunter sind sowohl einjährige, als auch mehrjährige Blühflächen“, sagt Klaus-Dieter Bäger, der die verschiedensten Mischungen einsetzt, um damit die Insektenvielfalt zu fördern. 600 Euro pro Hektar koste allein das Saatgut, sagt der Landwirt. Die Verarbeitung und die Pflege müsse man noch hinzurechnen.
„Landwirtschaftliche Betriebe erbringen umfangreiche kooperative Umweltleistungen auf freiwilliger Basis auf ihren Flächen“, heißt es von Seiten des Bauernverbandes. So legten sie unter anderem Blühstreifen und Gewässerrandstreifen an oder setzten auf eine besonders vielfältige Fruchtfolge. „Ob es um Bienen oder Insekten geht, um bedrohte Arten wie Lerchen oder Feldhamster, die Haltung alter Haus- und Nutztierrassen oder den Anbau alter Obst- und Gemüsesorten: „Bayerns Bäuerinnen und Bauern nehmen den Artenschutz ernst“.
Auch die Jäger investierten in Blühflächen, sagt Heinz Kammerer von der Jägerschaft Münchberg. Allein an 25 verschiedenen Flächen habe man sich zwischen den Jahren 2019 bis 2021 beteiligt, um Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten zu schaffen. Das sei auch dringend notwendig, so Robert Bayreuther vom Imkerverein Münchberg. Seinen Worten zufolge gibt es allein 550 verschiedene Wildbienenarten in Deutschland. Nicht nur für sie würden durch das Engagement von Bauern, Imkern und Jägern Rückzugsorte für alle möglichen Insekten geschaffen, sagt Wildlebensraumberaterin Lisa-Mareen Fischer vom Landwirtschaftsamt Bayreuth-Münchberg.
Die Kulturlandschaft um Münchberg, in Sichtweite zur Bundesautobahn A9, weist schon durch ihre Topographie einige Besonderheiten auf. Hier ist die Flur schon seit jeher von Ödlandflächen, Böschungen, Rainen und Hecken durchzogen, was den Insekten besonders zu Gute kommt. Solche Standorte gelte es zu erhalten, sagt die Wildlebensraumberaterin.
Der Einsatz für Insekten sei aber auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und nicht nur auf Landwirte, Jäger und Imker beschränkt. Auch Gartenbesitzer in den Siedlungen seien gefragt, wenn es um die Anlage und Pflege ihres Rasens geht. „Sogar ein Balkonkasten kann insektenfreundlich angepflanzt werden“, so Theresa Hick vom Bauernverband. Jeder habe die Möglichkeit, die Insektenvielfalt zu fördern, jeder einzelne könne seinen Beitrag dazu leisten, indem er auf insektenfreundliche Pflanzen setzt.
Bauern und Imker verbindet auch die Aktion „Blühende Rahmen“, die bereits seit 2011 läuft und die vom Bauernverband und dem Landesverband der Bayerischen Imker getragen wird. Jahr für Jahr werden im Rahmen dieser Aktion nahezu unzählige Blühstreifen und Blühflächen angelegt. Bereits 2014 haben die bayerischen Bauern für dieses freiwillige Engagement den „European Bee Award“ erhalten.
Bild: Mitten in einer insektenfreundlichen Blühwiese trafen sich zu einem öffentlichkeitswirksamen Termin (von links): Lisa-Mareen Fischer, Heinz Kammerer, Theresa Hick, Alfred Ott, Klaus-Dieter Bäger, Robert Bayreuther und Andreea Strößner.
Mit einem Lächeln geht alles leichter / Ernste und heitere Worte beim ersten Bayreuther Landfrauentag nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause
.jpg) Bayreuth.
Zwei Jahre ist es her, dass sich die Bayreuther
Landfrauen zum letzten Mal persönlich im großen
Rahmen getroffen haben. Jetzt war es endlich wieder
soweit. Zu diesem ganz besonderen Landfrauentag in
einer Halle der Landwirtschaftlichen Lehranstalten
hatte man sich deshalb auch viel Zeit genommen und
ein beinahe tagesfüllendes Programm ausgedacht. Es
reichte von einer Ökumenischen Andacht am Morgen bis
zu einer umfangreichen Tombola am späteren
Nachmittag. Höhepunkt war der Auftritt von Stargast
Volker Heißmann, ein Teil des TV-bekannten
Komiker-Duos Heißmann und Rassau aus Fürth.
Bayreuth.
Zwei Jahre ist es her, dass sich die Bayreuther
Landfrauen zum letzten Mal persönlich im großen
Rahmen getroffen haben. Jetzt war es endlich wieder
soweit. Zu diesem ganz besonderen Landfrauentag in
einer Halle der Landwirtschaftlichen Lehranstalten
hatte man sich deshalb auch viel Zeit genommen und
ein beinahe tagesfüllendes Programm ausgedacht. Es
reichte von einer Ökumenischen Andacht am Morgen bis
zu einer umfangreichen Tombola am späteren
Nachmittag. Höhepunkt war der Auftritt von Stargast
Volker Heißmann, ein Teil des TV-bekannten
Komiker-Duos Heißmann und Rassau aus Fürth.
So witzig Volker Heißmann auch sprach, so ernst war seine Botschaft: „Mit einem Lächeln geht alles leichter“. Sein Ziel, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, das hat er an diesem Nachmittag mehr als erreicht. Mit manchmal fast ein wenig derber Komik brachte er den Frankenfasching nach Bayreuth, berichtete von seinen landwirtschaftlichen Erfahrungen in der Kindheit, vom Aufwachsen im Angesicht der Fürther Paulskirche und vom Krippenspiel, in dem er dank seines Knabensoprans die Maria darstellen musste. Zum Mariechen sei es da gar nicht mehr weit gewesen, sagte er. Tatsächlich war er über die Kirche zu Bühne gekommen, vom Gemeindehaus in die Fürther „Comödie“ sozusagen, und irgendwann erstreckten sich seine Auftritte nicht mehr nur auf Nürnberg, Fürth und Erlangen, sondern teilweise auch weit darüber hinaus, etwa bis Plech, Gefrees und Bayreuth, so merkte er augenzwinkernd an.
.jpg) „Sie
können mit einem Lächeln ihr Leben besser meistern“,
gab Volker Heißmann den Landfrauen mit auf den Weg.
Egal, was im Leben passiere, das Lächeln kehre immer
wieder zurück. Wer lächelt, der schütte auch
Glückshormone aus, sagte er und riet den Damen, das
Lächeln mit nach Hause zu nehmen. Dann gehe auch auf
dem Hof die Arbeit viel besser von der Hand.
„Sie
können mit einem Lächeln ihr Leben besser meistern“,
gab Volker Heißmann den Landfrauen mit auf den Weg.
Egal, was im Leben passiere, das Lächeln kehre immer
wieder zurück. Wer lächelt, der schütte auch
Glückshormone aus, sagte er und riet den Damen, das
Lächeln mit nach Hause zu nehmen. Dann gehe auch auf
dem Hof die Arbeit viel besser von der Hand.
Für ernste Gedanken stand auch die Rede von Kreisbäuerin Angelika Seyferth. Durch die Corona-Krise und zuletzt durch den Krieg in der Ukraine sei die Wertschätzung von Lebensmitteln und damit auch der Bauern vor Ort wieder etwas gestiegen, sagte sie. Besonders die Direktvermarkter hätten das durchaus zu spüren bekommen. Viele Menschen hätten wieder gemerkt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass es in der Region genügend Lebensmittel gibt und dass man sich hierzulande selbst versorgen kann. Die Kreisbäuerin versprach: „Wir werden auch in Zukunft die Versorgung mit hochwertigen regionalen und Lebensmitteln sicherstellen.“
Nun aber treibe nicht nur die Bauern die große Sorge um, wie es mit der Rohstoff- und Energieversorgung weitergehen soll. Was geschieht, wenn es kein Gas mehr gibt und Schlachthöfe und Molkereien nicht mehr arbeiten können? Auch wenn das Jahresthema der Landfrauenarbeit im Bauernverband „Blick durch das Schlüsselloch in Richtung Zukunft“ lautet, so hatte doch niemand die Antworten auf Fragen wie diese.
.jpg) Die
Ökumenische Andacht zum Auftakt des Landfrauentages
feierten Pfarrer Thomas Karukayil von der
katholischen Pfarrei Eckersdorf und der evangelische
Pegnitzer Dekan Markus Rausch aus Pegnitz. Auch der
Bayreuther Landfrauenchor kam nach zweieinhalb
Jahren Pause zum ersten Mal wieder zu einem
öffentlichen Auftritt zusammen. Die Einnahmen aus
einer Tombola und der Verkaufserlös von Kaffee,
Kuchen und Torten gingen an die vor zwei Jahren
abgebrannte Lebenswerk gGmbH (Werkstatt für
Behinderte) der Diakonie Bayreuth. Damit möchten
auch die Landfrauen einen kleinen Teil zum
Wiederaufbau beitragen, so Kreisbäuerin Angelika
Seyferth.
Die
Ökumenische Andacht zum Auftakt des Landfrauentages
feierten Pfarrer Thomas Karukayil von der
katholischen Pfarrei Eckersdorf und der evangelische
Pegnitzer Dekan Markus Rausch aus Pegnitz. Auch der
Bayreuther Landfrauenchor kam nach zweieinhalb
Jahren Pause zum ersten Mal wieder zu einem
öffentlichen Auftritt zusammen. Die Einnahmen aus
einer Tombola und der Verkaufserlös von Kaffee,
Kuchen und Torten gingen an die vor zwei Jahren
abgebrannte Lebenswerk gGmbH (Werkstatt für
Behinderte) der Diakonie Bayreuth. Damit möchten
auch die Landfrauen einen kleinen Teil zum
Wiederaufbau beitragen, so Kreisbäuerin Angelika
Seyferth.
Bild (unten): Kreisbäuerin Angelika Seyferth (rechts) und ihre Stellvertreterin Doris Schmidt überraschten Volker Heißmann mit einer Großpackung Gummibärchen als außergewöhnliches Geschenk. Der Komiker hat dafür eine ganz besondere Schwäche.
Borkenkäfer-Situation ist dramatisch / WBV Kulmbach/Stadtsteinach warnt vor Katastrophe - Sinkende Auftragslage trifft auf Überangebot
 Himmelkron.
Eigentlich müsste man sich freuen über die riesige
Menge an Holz, die von der Waldbesitzervereinigung
Kulmbach/Stadtsteinach im Auftrag ihrer Mitglieder
im zurückliegenden Jahr vermarktet wurde. Der
riesige Anstieg von 150000 Festmeter in 2020 auf
210000 Festmeter Holz im zurückliegenden Jahr ist
allerdings im Wesentlichen auf den Borkenkäfer
zurückzuführen. „Es ist fast wie eine
Notschlachtung, aber das Käferholz muss weg“, sagte
Geschäftsführer Theo Kaiser bei der
Jahresversammlung in Himmelkron.
Himmelkron.
Eigentlich müsste man sich freuen über die riesige
Menge an Holz, die von der Waldbesitzervereinigung
Kulmbach/Stadtsteinach im Auftrag ihrer Mitglieder
im zurückliegenden Jahr vermarktet wurde. Der
riesige Anstieg von 150000 Festmeter in 2020 auf
210000 Festmeter Holz im zurückliegenden Jahr ist
allerdings im Wesentlichen auf den Borkenkäfer
zurückzuführen. „Es ist fast wie eine
Notschlachtung, aber das Käferholz muss weg“, sagte
Geschäftsführer Theo Kaiser bei der
Jahresversammlung in Himmelkron.
Dabei haben die Preise im zurückliegenden Jahr schon wieder angezogen. Die Talsohle des Jahres 2020 habe man 2021 mit Durchschnittserlösen von 51 Euro pro Festmeter (Vorjahr 31 Euro) bei der Fichte und 46 Euro (Vorjahr 24 Euro) pro Festmeter bei der Kiefer durchschritten. Dennoch bei der Fichte beispielsweise treffe die sinkende Auftragslage der Sägeindustrie auf ein zu erwartendes Überangebot beim Rundholz.
Schuld an der ganzen Misere sind nach den Worten des Geschäftsführers einzig und allein Trockenheit und Hitze. Sie setzten dem Wald massiv zu. Der Borkenkäfer könne sich ungehindert vermehren, eine weitere Massenvermehrung stehe bevor. „Die Situation ist dramatisch“, sagte Theo Kaiser. Wenn es mit der Hitze so weitergeht, sei eine echte Katastrophe zu erwarten. Der Geschäftsführer appellierte deshalb eindringlich an alle Waldbesitzer, den Waldumbau aufgrund des Klimawandels rasant anzupacken.
Der Borkenkäfer ist allerdings nicht das einzige Problem, mit dem sich die Waldbesitzer derzeit herumschlagen müssen. Ungemach droht auch von politischer Seite, wie die Vorsitzende Carmen Hombach erläuterte. Größtes Problem ist, dass sich Betriebe mit über 100 Hektar verpflichten müssen, fünf Prozent Wald stillzulegen, also nicht mehr zu bewirtschaften, wenn sie in den Genuss der Bundesprämie kommen wollen. „Das ist nicht zielführend, das passt nicht in unsere Zeit“, sagte die Vorsitzende. „Wir brauchen unser Holz als Gegenwarts- und Zukunftswerkstoff.“ Die Zwangsstillegung komme einer Enteignung gleich.
Man könne Waldflächen nicht aus der Nutzung nehmen und dafür Holz aus fraglichen Quellen importieren und dann auch noch für den weiten Transport wertvolle Energie verschwenden. „Wir hier vor Ort wirtschaften nachhaltig mit Sinn und Verstand, unsere Wälder sind zertifiziert und wir handeln nach dem Grundsatz schützen und nützen“, sagte die Vorsitzende. Sie gab auch zu bedenken, dass man beim Holz den Kreislauf selbst in der Hand habe. „Kein Hahn kann zugedreht werden.“
Die steigende Menge an vermarktetem Holz machte sich auch in der Bilanz der WBV Kulmbach/Stadtsteinach bemerkbar. Hatte der Zusammenschluss im Auftrag seiner Mitglieder 2020 noch rund 2,6 Millionen Euro umgesetzt, waren es 2021 mit 5,5 Millionen Euro mehr als das Doppelte. Die Summe setzt sich im Wesentlichen aus Handelsgeschäften, also aus Holz, das im Auftrag der Mitglieder vermarktet wurde sowie aus Dienstleistungen zusammen. Auch für das laufende Jahr geht Kassiert Rudolf Hafner wieder von Einnahmen in Höhe von fast sechs Millionen Euro aus.
Die WBV Kulmbach/Stadtsteinach hatte zu Jahresbeginn 1955 Mitglieder, 77 mehr als noch im zurückliegenden Jahr. Zusammen bewirtschaften sie eine Waldfläche von 13286 Hektar. Seit Januar ist die Mitgliederzahl den Worten von Theo Kaiser zufolge noch einmal auf 1987 angestiegen.
Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde die bisherige Vorstandschaft im Wesentlich bestätigt. Vorsitzende bleibt Carmen Hombach aus Kulmbach, Stellvertreter Heinz Reiner aus Presseck, Kassier Rudolf Hafner aus Mainleus und Schriftführer Horst Degelmann aus Premeusel. Der „Ausschuss“, also die erweiterte Vorstandschaft setzt sich zusammen aus: Robert Fürst (Hohenberg), Peter Göppner (Altenreuth), Gerhard Hahn (Dörnhof), Michael Milewski (Hanauerhof), Siegfried Beyer (Presseck), Rainer Schmidt (Waizendorf), Otto Schröppel (Neuenmarkt) und Markus Teller (Neuenreuth am Sand).
Bild: Auch im Kulmbacher Land, wie hier bei Marktleugast, warten derzeit riesige Holzmengen auf den Abtransport.
Schulkinder im Focus der Landfrauen / Beate Opel bleibt Kreisbäuerin – Große Veränderungen in der Vorstandschaft
 Kulmbach.
Beate Opel bleibt Kreisbäuerin von Kulmbach. Die
62-jährige aus Neufang bei Wirsberg wurde bei der
Verbandswahl der Landfrauengruppe im Bauernverband
ohne Gegenstimme in ihrem Amt bestätigt. Große
Veränderungen gibt es dagegen in der übrigen
Vorstandschaft. Gudrun Passing aus Oberdornlach löst
Silvia Schramm (Marktleugast) als stellvertretende
Kreisbäuerin ab. Schramm wiederum wurde in den
Beirat gewählt. Der übrige Beirat, also die
erweiterte Vorstandschaft, setzt sich aus Franziska
Bär (Buch am Sand), Manuela Vogler (Kunreuth),
Susanne Kraus (Gemlenz) und Marion Hartmann (Waldau)
zusammen.
Kulmbach.
Beate Opel bleibt Kreisbäuerin von Kulmbach. Die
62-jährige aus Neufang bei Wirsberg wurde bei der
Verbandswahl der Landfrauengruppe im Bauernverband
ohne Gegenstimme in ihrem Amt bestätigt. Große
Veränderungen gibt es dagegen in der übrigen
Vorstandschaft. Gudrun Passing aus Oberdornlach löst
Silvia Schramm (Marktleugast) als stellvertretende
Kreisbäuerin ab. Schramm wiederum wurde in den
Beirat gewählt. Der übrige Beirat, also die
erweiterte Vorstandschaft, setzt sich aus Franziska
Bär (Buch am Sand), Manuela Vogler (Kunreuth),
Susanne Kraus (Gemlenz) und Marion Hartmann (Waldau)
zusammen.
Für Beate Opel ist es die dritte Amtszeit. Sie wurde vor zehn Jahren zum ersten Mal zur Kreisbäuerin gewählt. Gleichzeitig ist sie seit 30 Jahren als Ortsbäuerin tätig und seit 2017 auch stellvertretende oberfränkische Bezirksbäuerin. Zusammen mit ihrer Familie bewirtschaftet sie einen Milchviehbetrieb mit Bullenmast.
Die alte und neue Kreisbäuerin ließ bei der Verbandsversammlung noch einmal die zurückliegende Wahlperiode Revue passieren, die zumindest bis zur Corona-Pandemie von zahlreichen gesellschaftlichen politischen und bildungspolitischen Veranstaltungen geprägt war. Als ganz besonders wichtiges Thema der Landfrauenarbeit bezeichnete sie das Projekt „Landfrauen machen Schule“, bei dem Schulkinder mit der Arbeit der Landwirte konfrontiert werden. „Wir müssen den Kindern zeigen, wo ihr Essen herkommt“, sagte sie. Die Landfrauen müssten zeigen, wie man gesundes Essen zubereitet, wie man pfleglich mit der Natur umgeht und wie die Bauern wirtschaften. Bei Kindern könne man damit noch etwas bewirken, bei Erwachsenen sei dies ungleich schwieriger.
Auch die bayerische Landesbäuerin und oberfränkische Bezirksbäuerin Anneliese Göller berichtete von den Schwierigkeiten, die Corona in der Landfrauenarbeit mit sich gebracht habe. „Es war eine Wahlperiode wie keine andere zuvor“, sagte sie. Die Landfrauen seien mit Schwung gestartet und dann jäh ausgebremst worden. Auch wenn bei den Landfrauen stets die persönliche Begegnung im Vordergrund steht, sei man mit den technischen Möglichkeiten sehr gut zurechtgekommen und habe die Arbeit gut aufrechterhalten können.
Es werde immer schwieriger Menschen zu finden, die bereit sind, sich zu engagieren, sagte der für alle drei fränkischen Regierungsbezirke zuständige Bauernverbandsdirektor Dr. Wilhelm Böhmer. Umso dankbarer könne man im Landkreis Kulmbach sein, dass sich in nahezu allen Ortsverbänden wieder Frauen gefunden hätten, um das Amt der Ortsbäuerin zu begleiten. Auch ein politisches Thema sprach Böhmer an. So wehrten sich die Landwirte derzeit gegen die politische Vorgabe vier Prozent der Fläche stillzulegen. Bei Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sei dabei auch beim Deutschen Bauerntag vor wenigen Wochen keinerlei Bewegung erkennbar gewesen. Allerdings gebe es vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine Signale aus Brüssel, nach denen es die Länder künftig in der Hand haben sollen, ob die vier Prozent Pflichtbrache durchgesetzt werden sollen, oder nicht.
Bild: Gruppenbild der neuen Kreisvorstandschaft der Kulmbacher Landfrauen mit (hinten von links): Geschäftsführer Harald Köppel, Marion Hartmann, Franziska Bär, Silvia Schramm, Kreisobmann Harald Peetz, BBV-Direktor Wilhelm Böhmer. Vorne von links: Bezirks- und Landesbäuerin Anneliese Göller Manuela Vogler, Susanne Kraus, Beate Opel und Gudrun Passing.
Braune Wiesen, dünner Mais, kümmerliche Sommergerste / Bauern gehen von unterdurchschnittlicher Ernteerwartung aus
 Die
Landwirte in ganz Bayern rechnen in diesem Jahr mit
einer unterdurchschnittlichen Getreideernte. Während
in Südbayern relativ gute Bestände auf den Feldern
stehen, wird es in Nordbayern trockenheitsbedingt
geringere Getreideerträge geben. Dazu kommt eine
angespannte Situation auf dem Weltmarkt. Zum einen
sind die Aussichten auf die Ernte dem Bauernverband
zufolge in ganz Europa schlecht. Zum anderen sei die
Transportlogistik aus wichtigen Erzeugerländern wie
der Ukraine aufgrund des Krieges nach wie vor nicht
sicher. Sorge bereiten den Bauern auch die enormen
Preisanstiege in der gesamten Lieferkette. Wie ist
die Situation vor Ort?
Die
Landwirte in ganz Bayern rechnen in diesem Jahr mit
einer unterdurchschnittlichen Getreideernte. Während
in Südbayern relativ gute Bestände auf den Feldern
stehen, wird es in Nordbayern trockenheitsbedingt
geringere Getreideerträge geben. Dazu kommt eine
angespannte Situation auf dem Weltmarkt. Zum einen
sind die Aussichten auf die Ernte dem Bauernverband
zufolge in ganz Europa schlecht. Zum anderen sei die
Transportlogistik aus wichtigen Erzeugerländern wie
der Ukraine aufgrund des Krieges nach wie vor nicht
sicher. Sorge bereiten den Bauern auch die enormen
Preisanstiege in der gesamten Lieferkette. Wie ist
die Situation vor Ort?
„Es schaut nicht gut aus“, sagt Harald Köppel, der als Geschäftsführer des Bauernverbandes für die Landkreise Bayreuth, Kulmbach und Kronach tätig ist. Die Witterung spreche für sich. Braune Wiesen, kümmerlicher Mais, eine sehr dünne Sommergerste, das alles hänge mit dem Wasser und der Temperatur zusammen. Grünland oder Mais seien nicht mehr gewachsen, Sommergerste habe teilweise verkürzte Ähren, weil das Wasser schlicht und einfach gefehlt habe. Teilweise seien die Ähren nicht einmal halb so lang, wie sie sein sollten. Auch die Körner des Wintergetreides seien nicht gefüllt worden, weil das Wasser ausgeblieben ist.
Regional gestalte sich die Situation dabei unterschiedlich. Im Unterland sei es teilweise noch schlechter, als im Oberland. Manchmal sei die Situation sogar von Dorf zu Dorf unterschiedlich, je nachdem, wo ein Gewitter war. Besonders trocken sei es um Himmelkron herum, während es über den Berg im Harsdorfer Bereich immer wieder mal geregnet habe.
„Alles in allem muss man aufgrund des Wassermangels mit Ertrags- und Qualitätseinbußen rechnen“, sagt Harald Köppel. Genaueres könne man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen. Auf jeden Fall unterdurchschnitt wird die Ernte bei der Wintergerste ausfallen. Wie es bei den anderen Früchten ausschaut, könne man erst sagen, wenn der Mähdrescher darüber gefahren ist.
Beim Grünland müsse man dagegen schon jetzt feststellen, der erste Schnitt sei in Ordnung gewesen, den zweiten Schnitt habe es dagegen schon fast nicht mehr gegeben und der dritte Schnitt stehe in den Sternen. Ebenso beim Mais: Während der zum jetzigen Zeitpunkt normalerweise schon zweieinhalb Meter hoch sein sollte, sei er im Moment bei einem halben bis dreiviertel, höchstens einem Meter angelangt. Köppel: „Da fehlt es hinten und vorne.“
Dabei sei das Frühjahr noch ganz gut losgegangen. „Es war ein super Start“, so Harald Köppel. Doch dann habe der Regen aufgehört. Das Wintergetreide, das sich über den Winter entwickeln konnte, sei dabei noch im Vorteil gewesen. Zum Körner füllen sei das Wasser aber auch zu wenig gewesen. Die Sommergerste habe es allerdings komplett erwischt. Die Ernte laufe in diesen Tagen so richtig an. Harald Köppel geht sogar davon aus, dass sie noch im Juli abgeschlossen werden kann und sich nicht wie sonst in den August hineinziehen werde.
Genaues kann Michael Greim aus Marktschorgast noch nicht sagen, doch erwartet er eine Ernte, die etwa um die Hälfte von der eines „normalen“ Jahres liegt. „Es schaut nach vielen kleinen und dünnen Körnern aus“, sagt Michael Greim. Schon allein deshalb rechne er mit Verlusten. Beim Sommergetreide sei es noch viel schlimmer als beim Wintergetreide. Einige Flächen bei Ziegenburg seien ihm bereits fast vertrocknet. Dazu kommt, dass das Getreide relativ kurz gewachsen sei, das bedeute, dass auch wenig Stroh übrig bleiben werde. Während beispielsweise der Hafer im zurückliegenden Jahr 1,50 bis 1,60 Meter hoch wurde, stehe er jetzt gerade einmal bei 30 bis 40 Zentimetern. „Da hat man das ganze Jahr Arbeit und Aufwand reingesteckt, und dann kann man nichts machen“, so Michael Greim. Er bewirtschaftet einen Betrieb mit Mutterkuhhaltung, erzeugt alternativer Energien und betreibt Ökolandbau. Gut 200 Hektar Fläche bewirtschaftet Michael Greim. Darauf baut er Winterweizen, Braugerste, Roggen, Dinkel und Hafer an, das im Wesentlichen in der Backwarenindustrie landet, die Braugerste geht zur Mälzerei Weyermann nach Bamberg.
Von einem einigermaßen durchschnittlichen Jahr geht dagegen die Familie Jurkat aus Oberlangenroth aus, „sofern die Qualität beim Wintergetreide ok ist“. In diesem Jahr zeige sich wieder, dass nicht nur die Menge, sondern vor allem die Verteilung der Niederschläge eine Rolle spielt, sagt Christoph Jurkat. Zusammen mit Bruder Michael und den Eltern Rosa und Ulrich bewirtschaften er das Gut Oberlangenroth, das zur Gemeinde Neuenmarkt gehört. Auf rund 75 Hektar baut die Familie Bio-Getreide wie Dinkel, Hafer, Sommergerste, Triticale und Ackerbohnen an.
Das Frühjahr sei auf dem Standort mit seinen schweren tonige Böden sogar fast zu nass gewesen. Dann aber folgte eine deutliche Frühsommertrockenheit. Die Winterungen wie Dinkel, Roggen, oder Triticale hätten das relativ gut überstanden. Die Bestände würden vielversprechend aussehen. Hier bleibe allerdings die Kornqualität, also die Füllung der Körner abzuwarten. Die Sommerungen wie Braugerste und Hafer würden dagegen deutlich abfallen. „Hier gehen wir von einer unterdurchschnittlichen Ernte aus“, sagt Christoph Jurkat. Spannend bleibe auch hier, ob die Qualität, also der Vollgerstenanteil bei der Sommergerste und das Hektoliter-Gewicht beim Hafer paßt.
Von Einbußen bis hin zum Totalausfall sprcht dagegen ein weiterer Landwirt aus dem Landkreis Kulmbach, der nicht genannt werden möchte. Die bereits geerntete Wintergerste sei noch knapp im Durchschnitt gewesen. Bei den späteren Getreidearten wie Weizen und vor allem beim Sommergetreide würden sicher 20 bis 40 Prozent fehlen. Besonders dramatisch sei die Situation im Futterbau. „Bei Mais und auf dem Grünland werden wir Einbußen von 50% bis zum Totalausfall haben“, so der Landwirt.
Bild: Was die Ernte betrifft gehen die Bauern im Kulmbacher Land heuer eher von unterdurchschnittlichen Erträgen aus.
Pionier für eine Landwirtschaft / Bittl´scher Gutsbetrieb beteiligt sich an Pilotprojekt zur Biodiversität
 Küps.
Nutzungs- und Schutzinteressen in der Landwirtschaft
zusammenzubringen, das ist das Ziel des Projektes
„Natur-positive Agrarsysteme“ (NaPA), an dem sich 19
ökologisch und konventionell wirtschaftende
Landwirte unter wissenschaftlicher Begleitung der
Humboldt-Universität Berlin beteiligen. Einer der
Betriebe ist dabei auch in Oberfranken: der
Bittl´sche Gutsbetrieb von Barbara und Hubertus von
Künsberg in Oberlangenstand bei Küps im Landkreis
Kronach.
Küps.
Nutzungs- und Schutzinteressen in der Landwirtschaft
zusammenzubringen, das ist das Ziel des Projektes
„Natur-positive Agrarsysteme“ (NaPA), an dem sich 19
ökologisch und konventionell wirtschaftende
Landwirte unter wissenschaftlicher Begleitung der
Humboldt-Universität Berlin beteiligen. Einer der
Betriebe ist dabei auch in Oberfranken: der
Bittl´sche Gutsbetrieb von Barbara und Hubertus von
Künsberg in Oberlangenstand bei Küps im Landkreis
Kronach.
Das Projekt soll in den kommenden drei Jahren Daten über die Auswirkungen unterschiedlicher Anbauarten und Bewirtschaftungsformen auf die lokale Biodiversität, Bodengesundheit sowie das Klima generieren. Außerdem wollen die beteiligten Landwirte regelmäßig praktische Erfahrungen auszutauschen. Ins Leben gerufen wurde NaPA von dem Unternehmen Syngenta Agro GmbH, ein internationaler Anbieter von Agrartechnologie, der in Frankfurt am Main seine deutsche Zentrale hat.
„Uns geht es um Lern- und Entwicklungszusammenhänge in der Landwirtschaft“, sagte Franz-Theo Gottwald, Professor für Umweltethik an der Humboldt-Universität Berlin. Schließlich sollen Grund und Boden ja auch für die Enkelgeneration noch zur Verfügung stehen. Eine Aufgabe des Projektes wird es deshalb sein, Wege zu finden, um die Bodenfruchtbarkeit und damit den Humusaufbau zu steigern. Einen besonderen Focus wollen die Beteiligten außerdem darauf legen, was passiert, wenn Veränderungen in der Fruchtfolge vorgenommen werden. „Wir hoffen, daraus neue Impulse für künftige Anbauentscheidungen ableiten zu können“, so Gottwald. Das Projekt soll aber auch einen Beitrag dazu leisten, dass es nicht immer nur die Bauern sind, die permanent angegriffen werden. Neu und einzigartig ist nach den Worten des Professors die wissenschaftliche Begleitung. Am Ende soll ein Maßnamepaket für den jeweiligen Standort stehen.
Als ein Beispiel für die konkrete Arbeit nannten Gottwald und der örtliche Projektbetreuer Sebastian Funk Untersuchung von Blühstreifen auf die lokale Biodiversität durch Wissenschaftler des Leibnitz Instituts. Sie sollen drei Jahre lang den Biodiversitätswandels unter die Lupe nehmen. Die NaPA-Landwirte haben dazu an oder mitten in ihren Feldern Messstationen mit speziellen Fallen eingerichtet, die sie regelmäßig leeren und austauschen. Das Forschungsinstitut wertet in seinem Labor daraufhin aus, welche Insekten und andere Kleintiere in der Luft und in den Boden gefangen wurden. Auch Bodenbeschaffenheit und Nährstoffkonzentrationen werden untersucht und in Beziehung zu Wetter, Temperaturentwicklung, den angebauten Feldfrüchten und weiteren Faktoren gesetzt. Dabei kommen testweise auch neue Technologien und Analysemethoden zum Einsatz. „Im Zeitverlauf ergibt sich so eine einzigartige Datensammlung und -qualität für die Agrarflächen“, sagte Gottwald.
Hubertus Freiherr von Künsberg bewirtschaftet in Oberlangenstadt die 400 Hektar Land des Bittl´schen Guts. Die Schwerpunkte des Betriebs liegen auf der Biogasproduktion und dem Ackerbau. Der Agrartechniker und Fachagrarwirt für erneuerbare Energien räumt dem Umweltschutz seit jeher einen besonderen Stellenwert ein. So übertrifft er mit seiner gewässerschonenden Bewirtschaftung bereits seit Jahren das gesetzlich geforderte Mindestmaß an Gewässerschutz. Eine von mehreren Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind die Pufferstreifen, die zwischen seinen Feldern und angrenzenden Gewässern verlaufen. Künsberg achtet auch darauf, den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln so in das System seiner Anbaumaßnahmen einzubauen, dass der Befallsdruck gesenkt und Pflanzenschutz reduziert werden kann. Zum Schutz des Ackerbodens setzt der Agrartechniker außerdem auf einer Teilfläche auf das Verfahren der sogenannten Streifenbodenbearbeitung. Dabei wird nur der unmittelbare Bereich, in dem Pflanzen wachsen sollen, intensiv bearbeitet, der Rest bleibt unberührt.
Bild: Hubertus von Künsberg (links) und Professor Dr. Franz-Theo Gottwald von der Humboldt-Universität Berlin haben in Küps das Projekt „Natur-positive Agrarsysteme“ (NaPA) gestartet.
Vollkornbrot per Instagram und WhatsApp / Brot von den eigenen Feldern - Die Familie Passing bewirtschaftet in Oberdornlach einen Bio-Bauernhof
 Oberdornlach.
Eigentlich ist das Ganze aus der Not heraus
entstanden. Im verregneten Sommer 2017 hatte der
Dinkel nicht ganz die geforderten Werte und so
probierte Gudrun Passing einfach einmal selbst, Brot
zu backen. Das Ergebnis konnte sich sehen und vor
allem schmecken lassen. Schnell sprach es sich in
der Verwandtschaft herum und so fand sie auch im
Freundes- und Bekanntenkreis schnell Abnehmer für
ihr selbstgebackenes Dinkel-Vollkornbrot.
Mittlerweile hat Gudrun Passing einen
Direktvermarktungskurs absolviert und einen eigenen,
von den Behörden nach strengen Vorgaben bereits
abgenommenen Backraum auf dem Hof in Oberdornlach
eingerichtet.
Oberdornlach.
Eigentlich ist das Ganze aus der Not heraus
entstanden. Im verregneten Sommer 2017 hatte der
Dinkel nicht ganz die geforderten Werte und so
probierte Gudrun Passing einfach einmal selbst, Brot
zu backen. Das Ergebnis konnte sich sehen und vor
allem schmecken lassen. Schnell sprach es sich in
der Verwandtschaft herum und so fand sie auch im
Freundes- und Bekanntenkreis schnell Abnehmer für
ihr selbstgebackenes Dinkel-Vollkornbrot.
Mittlerweile hat Gudrun Passing einen
Direktvermarktungskurs absolviert und einen eigenen,
von den Behörden nach strengen Vorgaben bereits
abgenommenen Backraum auf dem Hof in Oberdornlach
eingerichtet.
„Das gesamte Getreide stammt aus eigenem Anbau“, sagt Gudrun Passing. „Bei uns wird nichts für die Tonne gebacken“, ergänzt ihr Mann Wolfgang. Zusammen bewirtschaften sie den Hof in Oberdornlach, das zur Stadt Kulmbach gehört, mit Junior Johannes. Die beiden Schwestern Katharina und Lisa sind außerlandwirtschaftlich tätig.
Geworben wird per Instagram, auch eine eigene WhatsApp- Gruppe gibt es schon. Eigentlich wollte man die Vermarktung des Brotes über die Aktion „Marktschwärmer“ machen, doch dort gibt es Anlaufschwierigkeiten. Noch sei das Ganze nicht der Rede wert, wiegelt Gudrun Passing ab. Doch die Geschichte mit dem Backen soll auf jeden Fall ausgeweitet werden. Drei Sorten gibt es derzeit schon, neben dem Dinkel-Vollkorn ein Roggenmischbrot und ein Weißbrotbaguette. „Richtig gute Qualität ist mir das Wichtigste“, so Gudrun Passing. Eine erste Bewährungsprobe hat das Brot aus dem Hause Passing bereits bestens bestanden. Auf dem Kulmbacher Altstadtfest wurde das Weißbrot zusammen mit dem Damwildfleisch des befreundeten Marcel Wachter vom Lehenthaler Wildgehege angeboten.
Nach dem Besuch der Landwirtschaftsschule hatte Wolfgang Passing, heute 57, den Hof in der Ortsmitte von seinem damals bereits schwer kranken Vater übernommen. Damals mit 25 Kühen in Anbindehaltung. Klar, dass man Aufstocken musste und so entschied man sich für einen damals noch völlig unbekannten Kaltstall, den ersten derartigen Laufstall im Landkreis. Der hatte sich nach entsprechenden Startschwierigkeiten („wir konnten uns ja nirgends orientieren“) bewährt. Mittlerweile tummeln sich 40 Kühe darin. Die Bio-Milch wird an die Milchwerke Oberfranken-West in Coburg geliefert. Bereits im Jahr 2000 hatte die Familie den gesamten Betrieb auf EG-Bio-Standard umgestellt, seit 2012 gehört er dem Bioland-Anbauverband an.
Waren es bei der Übernahme an die 50 Hektar bewirtschaftete Fläche sind es heute exakt 76, die sich im Wesentlichen um die Ortschaft herum gruppieren. Angebaut werden Sommer- und Wintergerste, Weizen, Triticale, Dinkel, Mais und im geringen Umfang auch Linsen und Lein. Das Getreide wird, sofern nicht zum Brotbacken benötigt, zum Teil als Futter selbst genutzt, der Rest wird über die Vermarktungsgesellschaft Biobauern im schwäbischen Pöttmeß vertrieben. Einfach ist es für die Biobranche derzeit nicht, weiß auch Wolfgang Passing. „Schließlich müssen wir die Preissteigerungen genauso mittragen, wie die übrige Landwirtschaft auch.“ Dabei fallen die Kosten aufgrund der Vorgaben von jeher höher aus.
An die zehn Jahre wird Wolfgang Passing den Betrieb wohl schon noch führen, ehe er an Sohn Johannes (25) übergibt. Der bringt auf jeden Fall die besten Voraussetzungen mit. Er hat im landwirtschaftlichen Bildungszentrum Triesdorf die Ausbildung zum Techniker gemacht und danach ein Landwirtschaftsstudium mit der Fachrichtung Tier absolviert. Mittlerweile ist er beim Kulmbacher Futtermittelhersteller Bergophor als Produktentwickler tätig.
Als hätten sie auf dem Hof nicht schon genug zu tun, nimmt die gesamte Familie jede Menge verantwortungsvolle Ehrenämter wahr. Vater Wolfgang ist nicht nur Ortsobmann des Bauernverbandes, sondern auch Dirigent des Posaunenchors Kirchleus-Gössersdorf und 2. Vorstand der Feuerwehr Oberdornlach. Gudrun Passing engagiert sich in der Seniorenarbeit der Kirchengemeinde und gehört der Kreisvorstandschaft der BBV-Landfrauen an. Junior Johannes schließlich ist ebenfalls im Posaunenchor aktiv, hat auch schon in der Städtischen Jugendblaskapelle musiziert, ist aktives Mitglied der Feuerwehr und der Soldatenkameradschaft und spielt Fußball in der ersten Mannschaft des 1. FC Kirchleus. „Das Engagement und die Ehrenämter sind uns schon sehr wichtig“ ist sich die Familie einig. Schließlich gehe es ja auch darum, Verantwortung zu übernehmen.
Bild: Wolfgang, Gudrun und Johannes Passing bewirtschaften den landwirtschaftlichen Betrieb in Oberdornlach.
Heute Wurzeln, morgen Humus / Pflanzenbautage in Lopp stießen auf große Resonanz
 Lopp.
Trockenheit und Wassermangel bringen es mit sich:
Ackerböden müssen in der Tiefe gelockert und
Untersaaten zur Humusbildung eingebracht werden.
Andernfalls werden die Erträge immer weniger und am
Schluss wächst gar nichts mehr auf den Feldern. Das
alles wurde beim Pflanzenbautag in Lopp bei
Kasendorf deutlich. Vor dem Hintergrund der
anhaltenden Trockenheit ging es diesmal vor allem
darum, wie Landwirte auf ihren Feldern den Humus in
die Tiefe bringen können, um den Wasserhaushalt zu
verbessern, so Geschäftsführer Horst Dupke vom
Maschinenring. Die Traditionsveranstaltung wird vom
Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung und vom
Maschinenring Kulmbach ausgerichtet.
Lopp.
Trockenheit und Wassermangel bringen es mit sich:
Ackerböden müssen in der Tiefe gelockert und
Untersaaten zur Humusbildung eingebracht werden.
Andernfalls werden die Erträge immer weniger und am
Schluss wächst gar nichts mehr auf den Feldern. Das
alles wurde beim Pflanzenbautag in Lopp bei
Kasendorf deutlich. Vor dem Hintergrund der
anhaltenden Trockenheit ging es diesmal vor allem
darum, wie Landwirte auf ihren Feldern den Humus in
die Tiefe bringen können, um den Wasserhaushalt zu
verbessern, so Geschäftsführer Horst Dupke vom
Maschinenring. Die Traditionsveranstaltung wird vom
Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung und vom
Maschinenring Kulmbach ausgerichtet.
Für Feldfrüchte eigneten sich besonders die verschiedensten Kleearten oder Kleemischungen als Untersaat. Beim Mais schneiden Wicken am besten ab. Insgesamt gehe es darum, dass Untersaaten tief wurzeln, um die Humusbildung zu fördern, sagte Hans Koch von der BayWa. „Die Wurzeln von heute sind der Humus von morgen“, so der Referent.
Wichtig sei auch die Begrünung der abgeernteten Fläche, um keine trockene Brache entstehen zu lassen. Bleibt die Fläche offen, verdunsten die letzten Feuchtigkeitsreste, der Boden trocknet aus. Eine geeignete Untersaat beschattet und durchwurzelt dagegen das Feld. Untersaaten sollten bereits drei bis vier Wochen vor der Ernte der eigentlichen Frucht ausgebracht werden.
Daneben hatten die Landwirte aus der Region beim Pflanzenbautag auch die Gelegenheit, die Schauversuche mit Raps, Winterweizen und Sommergerste auf den Flächen von Gerhard Friedlein aus Lopp zu begutachten. Der Besuch sei auch heuer nicht schlecht gewesen, sagt Geschäftsführer Dupke. Viele Landwirte aus der Region seien gekommen, um die Unterschiede bei den verschiedenen Sorten, vor allem hinsichtlich Abreife und Krankheitsresistenz kennen zu lernen. Favoriten gibt es bei der Sortenwahl allerdings nicht, da jede Sorte anders auf die jeweilige Bodenbeschaffenheit und die klimatischen Standortbedingungen reagiert. Mit einem Tiefenlockerer konnten die Bauern auch testen, was der Geräteeinsatz bringt.
Um den Fortschritt der Versuche längerfristig zu begleiten ist ein weiterer Besichtigungstermin auf den Versuchsfeldern bereits für August geplant. In den zurückliegenden Jahren wurden auf den Feldern zwar ebenfalls verschiedene Versuche durchgeführt, die Erläuterungen dazu gab es allerdings nur schriftlicher Form auf einem ausgelegten Beiblatt. Trotzdem seien an den angekündigten Tagen rund 60 Interessierte vor Ort gewesen, sagt Geschäftsführer Dupke. Dies zeige, dass der Pflanzenbautag bei den Praktikern ein fester Termin ist.
Bild: Erstmals wieder in Präsenzform: Beim Pflanzenbautag in Lopp beschäftigten sich die Praktiker diesmal unter anderem um Humusbildung durch Untersaaten.
Biogas, Biomast und Bauernhofeis / Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz erkundete Landwirtschaft im Fichtelgebirge
.jpg) Wunsiedel.
Die Themenpalette war breit gestreut: vom Waldumbau
über die Herstellung von Bauernhofeis, von der
Bio-Ochsenmast über Biogas bis hin zur
Ferkelerzeugung reichten die Punkte, mit denen sich
eine Delegation mit der oberfränkischen
Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz an der
Spitze über Landwirtschaft im Fichtelgebirge
informierte.
Wunsiedel.
Die Themenpalette war breit gestreut: vom Waldumbau
über die Herstellung von Bauernhofeis, von der
Bio-Ochsenmast über Biogas bis hin zur
Ferkelerzeugung reichten die Punkte, mit denen sich
eine Delegation mit der oberfränkischen
Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz an der
Spitze über Landwirtschaft im Fichtelgebirge
informierte.
Start war an einem Hotspot, allerdings im negativen Sinn: am Buchberg bei Reichholdgrün. Dort hat der Borkenkäfer nach der Trockenheit der vergangenen Jahre gewaltig zugeschlagen. „Unser Hausberg hat Wunden und Narben“, brachte es Erich Reichel von der Dorfgemeinschaft auf den Punkt. Tatsächlich sei an dem 674 Meter hohen Buchberg exemplarisch zu sehen, was die Forstwirtschaft in ganz Deutschland bewegt, so Robert Geiser, Abteilungsleiter beim zuständigen Amt für Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg.
Der Buchberg sei aber nicht nur ein Hotspot des Borkenkäfers, sondern als ausgewiesenes FFH-Gebiet ein Hotspot des Naturschutzes und der Artenvielfalt. Im Waldmanagement sollte deshalb in Zukunft der Versuch unternommen werden, Mischbestände zu erzeugen. Das ist auch geplant: „Wir werden die Flächen wieder aufforsten“, versprach der Revierförster Viktor Klaus. Einen reinen Fichtenwald werde es in Zukunft nicht mehr gaben, so der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzendes des Landwirtschaftsausschusses Martin Schöffel. „Es ist absolut dramatisch, wie sich der Wald in den zurückliegenden zwei Jahren verändert hat.“
.jpg) Einen
erfreulicheren Blick in die Zukunft wagten Martina
und Florian Reichel vom Buchberghof in
Fichtenhammer. Sie betreiben nicht nur einen
Milchviehbetrieb mit knapp 80 Kühen sondern sind
auch in die Direktvermarktung eingestiegen und
vertreiben mit Erfolg ihr selbst produziertes
Bauernhofeis. Uwe Lucas vom Amt für Landwirtschaft
sprach vor Ort von einem „Familienbetrieb, der für
die Zukunft gerüstet ist“. 2017 hatte die Familie
den bisherigen Anbindestall aufgegeben und einen
hochmodernen Laufstall errichtet. Gleichzeitig waren
die Reichels in die Direktvermarktung eingestiegen,
mittlerweile gibt es ein Verkaufshäuschen an der
Hofeinfahrt mit zwei Automaten und einem
reichhaltigen Angebot.
Einen
erfreulicheren Blick in die Zukunft wagten Martina
und Florian Reichel vom Buchberghof in
Fichtenhammer. Sie betreiben nicht nur einen
Milchviehbetrieb mit knapp 80 Kühen sondern sind
auch in die Direktvermarktung eingestiegen und
vertreiben mit Erfolg ihr selbst produziertes
Bauernhofeis. Uwe Lucas vom Amt für Landwirtschaft
sprach vor Ort von einem „Familienbetrieb, der für
die Zukunft gerüstet ist“. 2017 hatte die Familie
den bisherigen Anbindestall aufgegeben und einen
hochmodernen Laufstall errichtet. Gleichzeitig waren
die Reichels in die Direktvermarktung eingestiegen,
mittlerweile gibt es ein Verkaufshäuschen an der
Hofeinfahrt mit zwei Automaten und einem
reichhaltigen Angebot.
Der Höhepunkt im breiten Portfolio des Buchberghofes ist allerdings das Bauernhofeis, das über Verbrauchermärkte, Bauernläden und Gaststätten in vielen Teilen Oberfrankens vertrieben und auch an Wochenenden und Feiertagen im hofeigenen Café angeboten wird. Einen mittleren sechsstelligen Betrag hat die Familie investiert in die Eisherstellung investiert. Dafür haben sie als Lebensmittelhersteller mittlerweile sogar eine EU-Zulassung. Die Milch kommt direkt aus dem benachbarten Stall, wird zunächst pasteurisiert und anschließend auf minus zehn Grad Celsius gefroren. Mit normaler Eisherstellung sei dies alles nicht vergleichbar, erläutert Martina Reichel. Großen Wert legt sie auch darauf, dass jede Sorte ihr eigenes Rezept hat. Mittlerweile werden pro Tag 500 bis 600 Liter Eis produziert.
Nicht ganz so optimistisch in die Zukunft sieht die Familie Medick aus Kothigenbibersbach bei Thiersheim. Der Zuchtsauenbetrieb mit Ferkelaufzucht und Marktfruchtanbau war die dritte Station der Regierungspräsidentin. „Seit zwei Jahren konnten wir kein Ferkel mehr kostendecken verkaufen“, sagte Juniorchef Fabian Medick. Vor elf Jahren sei man in den neuen Stall übersiedelt, aufgrund der aktuellen Tierwohlauflagen müsse man jetzt schon wieder umbauen. Konkret geht es um das geforderte Platzangebot pro Tier. „Wir müssen den Stall entweder erweitern oder den Bestand reduzieren, um die Tierwohlauflagen erfüllen zu können“, sagte Medick.
.jpg) Den
Abschluss der Regierungstour bildete der Ökobetrieb
der Familie Schübel in Schönlind bei Wunsiedel.
Neben Marktfruchtanbau setzt die Familie auf
Ochsenmast, Biogas, Urlaub auf dem Bauernhof sowie
land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen. Der
Schübelhof versorgt die Wunsiedler über den
einheimischen Metzger nicht nur mit Bio-Rindfleisch
sondern sichert vielen Einheimischen über Scheitholz
und Hackschnitzel auch ein warmes zuhause und
betreibt eine Biogasanlage mit einer Leistung von
270 kW.
Den
Abschluss der Regierungstour bildete der Ökobetrieb
der Familie Schübel in Schönlind bei Wunsiedel.
Neben Marktfruchtanbau setzt die Familie auf
Ochsenmast, Biogas, Urlaub auf dem Bauernhof sowie
land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen. Der
Schübelhof versorgt die Wunsiedler über den
einheimischen Metzger nicht nur mit Bio-Rindfleisch
sondern sichert vielen Einheimischen über Scheitholz
und Hackschnitzel auch ein warmes zuhause und
betreibt eine Biogasanlage mit einer Leistung von
270 kW.
Regierungspräsidentin Piwernetz würdigte bei der Rundfahrt die hervorragende Zusammenarbeit aller Akteure, die sich in Oberfranken mit der Landwirtschaft beschäftigen. „Hier herrscht ein Miteinander und kein Gegeneinander“, sagte sie. Die Landwirtschaft im Regierungsbezirk sei breit aufgestellt, erzeuge regionale und qualitativ hochwertige Lebensmittel und sorge für Nahrungsmittelsicherheit. „Wir wollen die Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft rücken“, so Rainer Prischenk, Chef der Landwirtschaftsverwaltung an der Regierung.
Nach den Worten von Georg Dumpert, dem Leiter des Amtes für Landwirtschaft Bayreuth-Münchberg, werden knapp 40 Prozent der Fläche m Landkreis Wunsiedel landwirtschaftliche genutzt, Weitere 46 Prozent beträgt der Waldanteil. Damit sind rund 86 Prozent der gesamten Landkreisfläche in land- und forstwirtschaftlicher Nutzung.
Bilder:
1. Florian
und Martina Reichen zeigten der Delegation um
Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz (Mitte)
ihren hochmodernen Milchviehstall.
2. Der
Buchberg bei Reichholdsgrün hat sich aufgrund des
Borkenkäferbefalls in den zurückliegenden Jahren
stark verändert.
3. Juniorchef
Florian Medick und die stellvertretende Kreisbäuerin
Christine Medick erläuterten der oberfränkischen
Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz die Probleme
ihres Ferkelerzeugungsbetriebes.
Preissteigerungen kommen bei den Landwirten nicht an / Wahlen beim Bauernverband: Karl Lappe geht in seine dritte Amtszeit als Bayreuther BBV-Kreisobmann
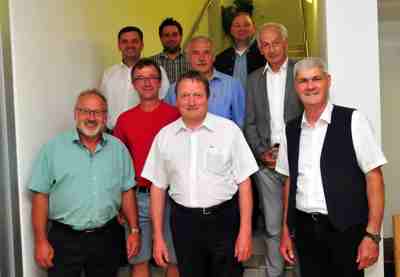 Bayreuth.
Karl Lappe bleibt auch in den kommenden fünf Jahren
Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes. Der
57-jährige Landwirt aus Schöchleins und Mistelgauer
Bürgermeister wurde bei der Kreisversammlung in
Bayreuth ohne Gegenstimme in seinem Amt bestätigt.
Lappe geht damit in seine dritte Amtsperiode.
Bayreuth.
Karl Lappe bleibt auch in den kommenden fünf Jahren
Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes. Der
57-jährige Landwirt aus Schöchleins und Mistelgauer
Bürgermeister wurde bei der Kreisversammlung in
Bayreuth ohne Gegenstimme in seinem Amt bestätigt.
Lappe geht damit in seine dritte Amtsperiode.
Wenige Veränderungen gab es auch in der weiteren Kreisvorstandschaft. Harald Galster aus Gefrees wurde ebenfalls ohne Gegenstimme erneut zum stellvertretenden Kreisobmann gewählt. Neu im fünfköpfigen Vorstand ist Christian Engelbrecht, der einen Michvieh- und Ackerbaubetrieb in Lankendorf bei Weidenberg bewirtschaftet. Er löst Andrea Mayer aus Zips ab, der nicht mehr zur Wahl stand. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind: Martin Ponfick aus Unterölschnitz bei Emtmannsberg, Martin Gebhardt aus Görau, Christian Hannig aus Pilgerndorf bei Hollfeld und Gerhard Meyer aus Creez bei Hummeltal.
Lappe drückte in seinem Bericht die Hoffnung aus, dass die Wertschätzung für die Bauern wieder zunimmt. „Die Zukunftsaussichten sind besser, als viele denken“, sagte er. Niemand hätte gedacht, dass bestimmte Lebensmittel tatsächlich wieder einmal knapp werden könnten. Keiner habe vorausgesagt, dass es zu einem Paradigmenwechsel hin zu einem Nachfragemarkt sowohl für Nahrungsmittel, als auch für Energie kommen würde. „Jetzt sehen viele Menschen wieder, wie bedeutsam die Lebensmittelerzeugung im eigenen Land ist.“
„Die Preise sind erfreulich, aber die Realität holt uns ein“, sagte Lappe und spielte damit auf die Tatsache an, dass die Preissteigerungen bei den Bauern gar nicht ankämen. Sowohl die Kosten für Düngemittel würden derzeit immens ansteigen, die Energiekoste geradezu explodieren. „Besonders der Energiebereich macht uns schwer zu schaffen“, so Lappe. Auch das verarbeitende Gewerbe werde dadurch hart getroffen, was beispielsweise das Milchgeld wieder schmälern werde.
Von einer „verrückten Zeit“ sprach bei der Versammlung auch der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges würde die Bevölkerung wieder erkennen, dass ein Land seine Bevölkerung selbst ernähren kann. An der „Teller-Trog-Tank-Diskussion“ wollte sich Greif nicht beteiligen. Man brauche vielmehr die Kreislaufwirtschaft, die auf zahlreichen Synergieeffekten aufbaut. So werde beispielsweise Gras ganz konkret durch Kühe verwertet, denn daraus entstehe Milch und Fleisch. Nebenbei werde auch noch die Landschaft gepflegt, was ohne Tierhaltung gar nicht möglich wäre.
Die geplanten Flächenstilllegungen kritisierte der für Ober-, Mittel- und Unterfranken zuständige BBV-Direktor Wilhelm Böhmer. Trotz der derzeitigen Situation beharre Bundesagrarminister Cem Özdemir auf vier Prozent Brache. Der Minister zeige keinerlei Kompromissbereitschaft, obwohl die Flächen zur Produktion von Nahrungsmitteln dringend gebraucht würden.
Große Sorgen bereiteten auch die Zuchtsauenhalter und Ferkelerzeuger. 30 bis 40 Prozent der Betriebe seien in den zurückliegenden Jahren aufgrund der miserablen Preissituation verloren gegangen. Doch nicht nur die schlechten Preise sondern auch die ständigen Verschärfungen von verschiedensten Auflagen seien für die Situation verantwortlich. Statt zu investieren hörten viele einfach auf. Wer aber einmal aufgegeben hat, der werde nie mehr zurückkommen.
Bild: Wenig Veränderungen gab es bei den Neuwahlen der BBV-Kreisvorstandschaft (von links): Harald Galster, Christian Hannig, Martin Gebhardt, Christian Engelbrecht, Gerhard Meyer (hinten), Karl Lappe (vorne), Harald Köppel, Direktor Wilhelm Böhmer und der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif.
Borkenkäfer bescherte Rekordzahlen / Waldbauernvereinigung Bayreuth: Wachstum in allen Bereichen
 Bayreuth.
Mehr Mitglieder, mehr Fläche und weit über 40000
vermarktete Festmeter Holz: Die
Waldbauernvereinigung Bayreuth konnte bei ihrer
Jahresversammlung riesige Wachstumszahlen in allen
Bereichen vermelden. Die Ursachen dafür sind
allerdings weniger erfreulich. Vor allem die
extremen Trockenjahre hatten dafür gesorgt, dass
sich der Borkenkäfer ungehindert verbreiten konnte.
Bayreuth.
Mehr Mitglieder, mehr Fläche und weit über 40000
vermarktete Festmeter Holz: Die
Waldbauernvereinigung Bayreuth konnte bei ihrer
Jahresversammlung riesige Wachstumszahlen in allen
Bereichen vermelden. Die Ursachen dafür sind
allerdings weniger erfreulich. Vor allem die
extremen Trockenjahre hatten dafür gesorgt, dass
sich der Borkenkäfer ungehindert verbreiten konnte.
Vorsitzender Hans Schirmer blickte allerdings auch mit einer gewissen Skepsis in die Zukunft: „Niemand kann vorhersagen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert.“ Wie es dann mit dem Holzpreis weitergeht, stehe in den Sternen. Schirmer äußerte unter anderem die Befürchtung, dass sich die gute Baukonjunktur im Herbst schnell wieder abschwächen kann, weil zum Beispiel potentielle Häuslebauer aufgrund der hohen Kosten und der Ungewissheit in vielen Bereichen von ihren Vorhaben abweichen. Schon jetzt stünden einige Baustellen still.
Nach den Zahlen von Geschäftsführer Gerhard Potzel hat die WBV Bayreuth aktuell 1685 Mitglieder mit einer Waldfläche von zusammen 8747 Hektar. Unter den Mitgliedern sind auch 22 Körperschaften, wie zum Beispiel die Stadt Bayreuth. Somit war die Mitgliederzahl um 106 und die Fläche um 355 Hektar gestiegen. Insgesamt hatte die WBV im Auftrag ihrer Mitglieder im Jahr 2021 genau 40126 Festmeter Holz vermarktet, was einer Steigerung um satte 11837 Festmeter gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gut 40000 Festmeter, so rechnete Potzel vor, entspreche 1543 Lkw und damit mehr als fünf Holztransporter pro Tag.
Die ungewöhnlich hohe Steigerung begründete der Geschäftsführer mit der verhältnismäßig großen Trockenheit, die bereits Mitte 2018 eingesetzt hatte. „Da hat der Käferbefall begonnen, seitdem konnte er richtig wüten“, so Potzel. In den beiden ersten Quartalen des laufenden Jahres sei der Absatz aber schon wieder ein wenig eingebrochen. „Wir müssen uns trotzdem nicht verstecken, wir haben super Zahlen“, so Vorsitzender Schirmer.
Den hohen Wert der WBV als bäuerliche Selbsthilfeeinrichtung stellten sämtliche Grußwortredner heraus. Holz sei immer gefragter, die Waldbauernvereinigung sei für die Stadt stets ein zuverlässiger, kompetenter und loyaler Partner, sagte Bayreuths 2. Bürgermeister Andreas Zippel. Holz erfreue sich derzeit als Baustoff, aber auch als Biomasse einer guten Nachfrage, so die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer (CSU). Ihr Kollege Tim Pargent von den Grünen sagte: „Ohne Waldbauern wird es keinen klimagerechten Waldumbau geben“. Es komme oft viel zu kurz, dass die Waldbauern aktiven Klimaschutz betreiben, so Landrat Florian Wiedemann.
Der Chef des noch relativ neu gegründeten Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg, Georg Dumpert, zählte auf, dass es im Amtsgebiet, also in den drei Städten und Landkreisen Bayreuth, Hof und Wunsiedel, unvorstellbare 120000 Hektar Wald gebe, mehr als die Hälfte davon in privater Hand. Dumpert sprach von rund 23000 privaten Waldbesitzern und sechs forstlichen Zusammenschlüssen. BBV-Kreisobmann Karl Lappe sah im Wald der Zukunft mehr den Energie- als den Baustofflieferanten. Die Errichtung einer Holzhackschnitzelheizung, mit dem unter anderem das Grüne Zentrum und das Ypsilon-Haus beheizt werden, sei daher vor Jahren eine absolut zukunftsweisende Entscheidung gewesen.
Über den Wald der Zukunft und die Möglichkeiten, Kalamitätsschäden vorzubeugen sprach bei der Versammlung Dirk Lüder, der Bereichsleiter Forsten des Amtes für Landwirtschaft. Er kam zu dem Schluss, dass künftig viel mehr Baumarten als derzeit im Wald zuhause sein müssten. „Wir müssen uns auf zunehmende Schäden, sei es durch den Käfer durch Stürme oder durch Trockenheit einstellen“, so Lüder. Neben einer konsequenten Pflege und Durchforstung appellierte es an die Waldbauern, schon jetzt Mischbaumarten, wie Tannen oder Buchen, unter dem Altholzschirm aus Kiefern und Fichten anzubauen. Gerade der Fichte werde es im Bereich der WBV zunehmend schlechter gehen.
Bildtext:
2021 hatte Klaus Wunderlich aus Gothendorf bei Bad Berneck den Bayerischen Staatspreis für vorbildliche Waldbewirtschaftung erhalten. Weil er sich seit langem auch als Vorstandsmitglied bei der WBV Bayreuth engagiert, wurde er hier noch einmal gesondert ausgezeichnet. Im Bild von links: Vorsitzender Hans Schirmer, Amtschef Georg Dumpert, Klaus Wunderlich und Geschäftsführer Gerhard Potzel.Hohe Kosten belasten Bauern / Steigende Milchpreise kommen bei den Landwirten nicht an - Langfristige Perspektiven gefordert
Kulmbach.
Lange galt der Milchpreis als eine Art Sorgenkind,
jetzt auf einmal ist er im Höhenflug, die Bauern
sind aber trotzdem in Bedrängnis. Wie kann das sein.
Grund für die steigenden Milchpreise ist, dass das Angebot an Rohmilch und Milchprodukten weltweit als sehr knapp gilt. Bundesweit sind die Erzeugerpreise im Mai teilweise auf über 50 Cent je Kilogramm gestiegen. Noch vor kurzem schien dies unvorstellbar. Die Landwirte müssten eigentlich froh darüber sein. Doch plötzlich werden auch die Kosten für die Erzeugung in bislang unvorstellbare Höhen getrieben. Dazu kommt, dass sämtliche Preise für Lebensmittel aber auch alle anderen Dinge des täglichen Bedarfs stark ansteigen. Die Nachfrage geht damit zurück, denn der Verbraucher dreht jeden Euro zweimal um.
„Die Unkosten laufen uns davon“, sagt Wilfried Löwinger, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes. Egal ob Energie, Futter oder Dünger, alle Preise gingen derzeit durch die Decke. Früher wäre ein Milchpreis von an die 50 Cent pro Kilogramm Milch super gewesen, doch heute kämen die Bauern nicht mehr damit aus. Scharfe Kritik über Löwinger am Lebensmitteleinzelhandel. Hier werde suggeriert, dass die Rohstoffkosten höher seien. Doch in Wirklichkeit klaffe die Schere zwischen Rohstoffkosten und Verkaufspreis immer weiter auseinander.
Einen Mangel gibt es für den Kreisobmann nicht. Die hohen Preise seien lediglich mit Spekulationen zu begründen. „Da machen sich einige die Taschen voll“, so Löwinger. Völlig unbegreiflich ist es für ihn, dass das Kartellamt nicht eingreift. Es müsste dazu beitragen eine Balance, zwischen Angebot und Nachfrage zu schaffen. Besonders extrem spürten diese Auswüchse die Biobauern, indem konventionell erzeugte Milchpreis beinahe den gleichen Preis habe, wie biologisch erzeugte Milch. Gleichwohl seien die Kosten bei der biologisch erzeugten Milch noch höher, so dass dem Biobauern am Ende noch weniger bleibt.
Die derzeitige Situation zeige leider auch: Wenn das Geld knapp wird, spart der Verbraucher zuerst bei Lebensmitteln. Bei der derzeitigen Situation habe er zwar Verständnis, dass viele Menschen auf den Cent rechnen müssten und es viele Familien hart trifft. Auf der anderen Seite seien Nahrungsmittel doch für jeden Menschen wichtiger als alles andere. Daran zu sparen sei sicher der falsche Weg.
Auch Harald Köppel, Geschäftsführer des Bauernverbandes für die Landkreis Bayreuth, Kulmbach und Kronach bestätigt, dass den Milchbauern die Kosten davon laufen, ganz egal ob Sie konventionell oder biologisch wirtschaften. Bei Betriebsmittelen wie Diesel, Dünger, Strom, Milchleistungsfutter, Ersatzteile, Reinigungsmittel, und vielem mehr hätten sich die Preise teilweise verdreifacht, wenn man überhaupt etwas bekommt.
Die Nachfrage nach Milchprodukten auf der ganzen Welt ist nach den Worten Köppels sehr hoch und die Produktion der Milch ist rückläufig. Die zurückliegenden Jahre mit Milchkrisen und ständig steigende Auflagen hätten bei den Milcherzeugern Spuren hinterlassen. Viele Betriebe hätten die Milchviehhaltung aufgegeben, neue Ställe würden nicht gebaut. Köppel: „Das ist der Trend und dieser wird sich auch nicht aufhalten lassen, wenn nicht endlich Signale aus der Politik und dem Handel kommen, die den Erzeugern eine langfristige Perspektive geben.“
Das sei aber nicht nur bei der Milcherzeugung ein Problem, sondern ebenfalls bei den Schweinehaltern und weiteren Teilbereichen der Landwirtschaft. „Wenn sich nicht bald was tut ist der Zug angefahren und die Lebensmittel kommen aus dem Ausland“, so der Geschäftsführer.
Was den sinkenden Preisunterschied zwischen konventioneller Milch zu Bio-Milch angeht merkte Köppel, dass die Verbraucher anfangen zu sparen und deshalb immer weniger zu teurer Bio- oder Markenprodukten greifen, dadurch gehe die Nachfrage nach diesen Produkten zurück. Es würden günstigere Milchprodukte gekauft und hier würden dann auch Nachfrage und Preis steigen.
Für Thomas Erlmann ist das Problem relativ einfach zu beschreiben. Kernproblem der gestiegenen Verbraucherpreise sieht er darin, dass die Lebensmittel in den zurückliegenden 30 Jahren viel zu billig verramscht worden seien. Erlmann bewirtschaftet zusammen mit seiner Familie einen Milchviehbetrieb am Ortsrand von Waldau mit 175 Hektar Fläche. Im Stall stehen rund 150 Kühe plus weiblicher und männlicher Nachzucht.
Im zurückliegenden Jahr sei der Preis für Diesel um 70 Prozent gestiegen, Futtermittel kosteten im Schnitt das Doppelte und Mineraldünger das Drei- bis Vierfache. Dazu kämen noch die Preissteigerungen für Strom, Tierarzt, Ersatzteile, Maschinen, Baustoffe und so weiter. Für Thomas Erlmann steh deshalb fest: „Da ist die Steigerung beim Milchpreis um 30 Prozent einfach zu wenig.“
Hermann Grampp aus Melkendort ist der gleichen Meinung. Er bewirtschaftet mit seiner Familie rund 200 Hektar Fläche und hat ebenfalls rund 150 Kühe in seinem Stall. Allerdings wirtschaftet Grampp seit 2017 nach den Richtlinie des Bioland-Anbauverbandes. Er macht eine einfache Rechnung auf. Einer Erhöhung beim Milchpreis um zehn Prozent steht eine Verteuerung der Produkte in den Läden um 30 Prozent (Käse) bis 50 Prozent (Butter) gegenüber. Auf der Kostenseite müsse er eine Preissteigerung um 35 bis 50 Prozent etwa bei Futtermitteln hinnehmen.
Biobauern seien derzeit noch schlimmer betroffen, als konventionelle Erzeuger, denn sie hätten nicht die Preissteigerungen, die der konventionelle Markt hergibt, müssten aber trotzdem die höheren Kosten tragen. Völlig unverständlich ist es für Grampp, wenn die immense Verteuerung beispielsweise bei hochwertigem Eiweißfutter mit dem Krieg in der Ukraine begründet wird. „Jeder stopft sich irgendwie die Taschen voll“, so lautet sein Verdacht.
Info:
Der Preis, den eine Molkerei dem Bauern auszahlt, ist der Milchpreis. Er wird in Cent je Kilogramm berechnet. Der Umrechnungsfaktor von Liter zu Kilogramm beträgt 1,03. Ein Liter Milch entspricht somit 1,03 Kilogramm. Wie viel Geld ein Landwirt für seine Milch bekommt, hängt von der gelieferten Rohmilchmenge, vom Fett- und Eiweißgehalt der Rohmilch und von Qualitätsmerkmalen wie der Keimzahl, der Zellzahl und den enthaltenden Hemmstoffen der Rohmilch ab. Der Grundpreis der Milch bezieht sich in der Regel auf einen Fettgehalt von 4,0 Prozent und einen Eiweißgehalt von 3,4 Prozent.
Publikumsmagnet Landwirtschaft / Maschinenring feierte 60. Geburtstag
.jpg) Kulmbach.
Er ist ein Dienstleister für die Landwirtschaft,
aber in zunehmenden Maß auch für Firmen und
Privatleute: der Maschinen- und Betriebshilfsring
Kulmbach. Vor rund 60 Jahren wurde er gegründet und
hat seitdem eine stetige Aufwärtsentwicklung
genommen. Ihr breites Portfolio stellte die
bäuerliche Selbsthilfeeinrichtung am Sonntag in
Neufang auf dem Gelände zwischen dem Reitstall von
Ralf Michel und dem Kulmbacher Flugplatz bei einem
„Tag der Landwirtschaft“ vor. Viele hundert Besucher
nutzten während des Nachmittags die Möglichkeit,
Technik zu bestaunen und sich über
landwirtschaftliche Zusammenhänge zu informieren.
Kulmbach.
Er ist ein Dienstleister für die Landwirtschaft,
aber in zunehmenden Maß auch für Firmen und
Privatleute: der Maschinen- und Betriebshilfsring
Kulmbach. Vor rund 60 Jahren wurde er gegründet und
hat seitdem eine stetige Aufwärtsentwicklung
genommen. Ihr breites Portfolio stellte die
bäuerliche Selbsthilfeeinrichtung am Sonntag in
Neufang auf dem Gelände zwischen dem Reitstall von
Ralf Michel und dem Kulmbacher Flugplatz bei einem
„Tag der Landwirtschaft“ vor. Viele hundert Besucher
nutzten während des Nachmittags die Möglichkeit,
Technik zu bestaunen und sich über
landwirtschaftliche Zusammenhänge zu informieren.
Dazu gab es eine große Maschinenausstellung zwischen Reitstall und Flugplatz. Mit der Schau sollte die Leistungsfähigkeit des Ringes eindrucksvoll unter Beweis gestellt werden. Die Maschinen standen freilich nicht nur so da, sondern konnten im Einsatz bestaunt werden. An den praktischen Vorführungen hatten sich viele Aktive und einige Firmen beteiligt, die eng mit dem Maschinenring zusammenarbeiten. Sie stellten ihre hohe Einsatzbereitschaft und ihr enorme Know-how vor.
.jpg) „Vom
Baumkletterer über Kehrmaschinen und
Klauenpflegestand bis zum Sägespalter haben wir auf
einem Rundweg unser gesamtes Programm
zusammengestellt“, sagte Geschäftsführer Dupke. Auch
die Heißwasserthermie zur Unkrautbekämpfung sowie
Möglichkeiten, dem Eichenprozessionsspinner den
Garaus zu machen, gehören zur umfangreichen
Angebotspalette des Maschinenrings. Dazu gab es
mehrere Informationsstände unter anderem des Amtes
für Landwirtschaft und des Bauernverbandes.
Landwirte aus der Region, wie Daniel Kaßel mit
seinem Eierheisla oder Ben Berthold aus Eggenreuth
mit dem Kulmbacher Weideschwein, stellten einen
kleinen Bauernmarkt zusammen.
„Vom
Baumkletterer über Kehrmaschinen und
Klauenpflegestand bis zum Sägespalter haben wir auf
einem Rundweg unser gesamtes Programm
zusammengestellt“, sagte Geschäftsführer Dupke. Auch
die Heißwasserthermie zur Unkrautbekämpfung sowie
Möglichkeiten, dem Eichenprozessionsspinner den
Garaus zu machen, gehören zur umfangreichen
Angebotspalette des Maschinenrings. Dazu gab es
mehrere Informationsstände unter anderem des Amtes
für Landwirtschaft und des Bauernverbandes.
Landwirte aus der Region, wie Daniel Kaßel mit
seinem Eierheisla oder Ben Berthold aus Eggenreuth
mit dem Kulmbacher Weideschwein, stellten einen
kleinen Bauernmarkt zusammen.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring hat mittlerweile 850 Mitglieder, sein Angebot reicht von der klassischen Maschinenvermittlung und Betriebshilfe bis hin zur Erschließung neuer Einkommensquellen für die Landwirte. Abgewickelt werden sie über die gewerbliche Tochtergesellschaft MR Oberfranken Mitte zusammen mit den Nachbarringen Bayreuth/Pegnitz und Fränkische Schweiz. Historisch reicht die Geschichte des Maschinenrings bis Anfang der 1960er Jahre zurück. Damals gab es drei Maschinenringe auf dem Gebiet des heutigen Landkreises Kulmbach. Mit dem Zusammenschluss der drei Ringe war der Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach entstanden.
Bilder: Mit einer großen Maschinenausstellung feierte der Maschinenring Kulmbach in Neufang auf dem Gelände zwischen Reitstall Michel und dem Kulmbacher Flugplatz seinen 60. Geburtstag.
.jpg)
.jpg)
Betriebshilfe, Beratung und Baumfällungen / Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach konnte sich im Corona-Jahr 2021 gut behaupten
 Neufang.
Ursprünglich ging es lediglich um die Vermittlung
von Maschinen. Mittlerweile bieten die Maschinen-
und Betriebshilfsringe ein weitverzweigtes Netz an
Dienstleistungen an. Bestes Beispiel dafür ist der
Maschinenring Kulmbach. Die bäuerliche
Selbsthilfeeinrichtung konnte im zurückliegenden
Jahr trotz Corona ihren Verrechnungswert, also den
Wert, der auf Basis der Kosten für die Leistungen
aller Bereiche angesetzt wird, von 3,7 auf gut vier
Millionen Euro steigern.
Neufang.
Ursprünglich ging es lediglich um die Vermittlung
von Maschinen. Mittlerweile bieten die Maschinen-
und Betriebshilfsringe ein weitverzweigtes Netz an
Dienstleistungen an. Bestes Beispiel dafür ist der
Maschinenring Kulmbach. Die bäuerliche
Selbsthilfeeinrichtung konnte im zurückliegenden
Jahr trotz Corona ihren Verrechnungswert, also den
Wert, der auf Basis der Kosten für die Leistungen
aller Bereiche angesetzt wird, von 3,7 auf gut vier
Millionen Euro steigern.
„Unser Ziel ist es, die Betriebe im Landkreis Kulmbach auch zukünftig zu organisieren und sicherzustellen“, sagte der Vorsitzende Andreas Textores bei der Jahresversammlung in der Reithalle von Ralf Michel in Neufang. Immer mehr in den Focus gerate dabei auch die Absicht, kommunale und private Aufträge zu organisieren und abzuwickeln. Der Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach hat aktuell 650 Mitglieder, zwei weniger als im Jahr zuvor.
Bei der sozialen Betriebshilfe, also immer dann, wenn zum Beispiel ein Betriebseiter erkrankt, einen Unfall hat, wegen einer Operation außer Gefecht ist oder zur Kur muss, stieg die Zahl der geleisteten Stunden nach den Zahlen von Geschäftsführer Horst Dupke von 17145 in 2020 auf 22500 im Jahr 2021 an. Der Maschinen- und Betriebshilfsring verstehe sich dabei als der Ansprechpartner, der sämtliche Formalitäten erledigt und die Verhandlungen mit dem Sozialversicherungsträger führt. Kaum noch Nachfrage gebe es im Kulmbacher Land nach wirtschaftlicher Betriebshilfe, etwa zur Abdeckung von Arbeitsspitzen. „Die wirtschaftliche Betriebshilfe ist komplett auf dem absteigenden Ast, wir haben auch kaum noch Helfer“, so Dupke.
Zweiter wesentlicher Aufgabenbereich ist die Vermittlung von Maschinen. Hier schlugen im Wesentlichen die Futter- und Strohernte, das weite Feld der Landschaftspflege, die Körnerernte und –aufbereitung sowie der Verleih von Schleppern zu Buche. Darüber hinaus sieht sich der Maschinenring als verlässlicher Partner, wenn es um die Mehrfachanträge, um Gasölanträge oder um Düngedokumentationen geht.
Seit 2021 ist es im Kulmbacher Land möglich, den Maiszünsler biologisch mit Schlupfwespen zu bekämpfen, die per Drohne ausgebracht werden. Auch dieses Angebot des Maschinenrings habe sich mittlerweile bewährt. Nicht zuletzt ist der Maschinenring auch Träger der dezentralen Grüngutkompostierung im Landkreis. Hier seien im zurückliegenden Jahr 51613 Kubikmeter Grüngut angeliefert worden.
Viel getan hatte sich im zurückliegenden Jahr bei der Maschinenring Oberfranken Mitte GmbH, in der die Ringe Kulmbach, Bayreuth und Fränkische Schweiz ihre gewerblichen Aktivitäten ausgelagert haben. Hier reicht das breite Portfolio von der Düngeberatung über die biologische Unkrautbekämpfung per Heißwasserthermie, die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners bis zu Klauenpflege. Für Firmen und Privatleute dürfte dabei das Angebot von Problembaumfällungen, Winterdienst oder Arbeiten rund um Haus und Garten interessant sein.
Drei Betriebshelfer wurden diesmal für ihren Einsatz ausgezeichnet: Thomas Kraß, Manfred Schuster und Horst Hempfling. Jeder von ihnen hatte im zurückliegenden Jahr mehr als 1000 Stunden Betriebshife geleistet.
Bild: Geschäftsführer Horst Dupke (links) und Vorsitzender Andreas Textores zeichneten Thomas Kraß, Manfred Schuster und Horst Hempfling als die Betriebshelfer mit den meisten Stunden aus.
Kleiner Ring, große Schlagkraft / Maschinen- und Betriebshilfsring Wunsiedel: Vorstand bleibt unverändert – Mitgliedsbeiträge verdoppelt
 Höchstädt.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Wunsiedel ist
mit seinen gut 600 Mitgliedern einer der kleineren
Ringe in Bayern. „Doch wir sind nicht weniger
schlagfertig als die großen Ringe“, sagte der
Vorsitzende Martin Goldschald bei der
Jahresversammlung in Höchstädt. Die Schlagkraft der
bäuerlichen Selbsthilfeeinrichtung machte er unter
anderem auch daran fest, dass nahezu alle
landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis auch
Mitglied des Maschinenrings sind.
Höchstädt.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Wunsiedel ist
mit seinen gut 600 Mitgliedern einer der kleineren
Ringe in Bayern. „Doch wir sind nicht weniger
schlagfertig als die großen Ringe“, sagte der
Vorsitzende Martin Goldschald bei der
Jahresversammlung in Höchstädt. Die Schlagkraft der
bäuerlichen Selbsthilfeeinrichtung machte er unter
anderem auch daran fest, dass nahezu alle
landwirtschaftlichen Betriebe im Landkreis auch
Mitglied des Maschinenrings sind.
Wichtigster Aufgabenbereich des Rings ist die Betriebshilfe. 15530 Stunden wurden nach den Zahlen von Geschäftsführer Andreas Hager im zurückliegenden Jahr geleistet, Corona-bedingt sind das rund 1500 weniger als noch im Jahr zuvor. Die Stunden teilen sich auf in knapp zwei Dritteln sozialen Einsätzen, also bei Krankheit, Unfällen, Reha-Maßnahmen, Operationen oder gar einem Todesfall, und gut einem Drittel wirtschaftlicher Betriebshilfe, also zur Abdeckung von Arbeitsspitzen. Der Maschinenring sei ständig auf der Suche nach neuen Betriebshelfern, sagte der Geschäftsführer. „Meldet euch bei uns, wir haben immer Arbeit“, so Hager.
Zweites wichtiges Standbein des Rings sind der Verleih und die Vermittlung von Maschinen. Hier hätten besonders die Bereiche Schlepper und Transporte, Pflanzenschutz und Körnermais das Geschäft beherrscht. Fasst man die Betriebshilfe, die Maschinenvermittlung und die Landschaftspflege, die der Ring zusammen mit dem Landratsamt und dem Naturpark Fichtelgebirge durchführt, zusammen, kommt man auf einem Verrechnungswert von knapp 3,2 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeute dies eine rund zehnprozentige Steigerung.
Neu ist die Auflösung der Maschinenrings Hochfranken GmbH, in der die beiden Ringe Münchberg und Wunsiedel bis Ende 2021 ihre gewerblichen Aktivitäten gebündelt hatten. Der Wunsiedler Ring führt die gewerbliche Tochter unter dem gleichen Namen weiter, genauso wie der MR Münchberg ein eigenes Tochterunternehmen gegründet hat. „Wir wollen aber auch weiterhin gut zusammen arbeiten“, sagte Geschäftsführer Reinhard Rasp.
Ohne Diskussion und auch ohne Gegenstimme stimmten die Mitglieder einer Erhöhung der Beiträge zu. So werden ab dem kommenden Jahr 50 statt bisher 25 Euro pro Mitglied fällig. Unberührt bleibt der Hektarbeitrag von einem Euro. „Uns bleibt leider nichts anderes übrig“, sagte Vorsitzender Martin Goldschald und verwies auf die geradezu explodierenden Kosten und die immense Erweiterung der Angebote.
In dieser Zeit müsste auch dem Letzten klar sein, wie wichtig die heimische Landwirtschaft für eine zuverlässige Nahrungsmittelversorgung ist, sagte der Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende des Landtagsausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Martin Schöffel. Landrat Peter Berek bescheinigte dem Maschinenring einen unersetzlichen Dienst für die Landwirtschaft im Landkreis. Auch für die Gemeinde sei der Maschinenring mittlerweile zu einem wichtigen, starken und zuverlässigen Partner geworden, so der Höchstädter Bürgermeister Gerald Bauer.
Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurden Martin Goldschald aus Erkersreuth als erster und Michael Groschwitz aus Vordorf als zweiter Vorsitzender in ihren Ämtern bestätigt. Im erweiterten Vorstand gab es ebenfalls keine Veränderungen. Er setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen: Markus Bauer (Sichersreuth), Frank Deistler (Hohenbuch), Klaus Gläßel (Grafenreuth), Christian Hendel (Thiersheim), Udo Legath (Schacht), Fabian Medick (Kothigenbibersbach), Anja Raithel (Bödlas), Thomas Schlegel (Wustung) und Reinhard Schlötzer (Raumetengrün).
Foto: Die drei Betriebshelfer mit den meisten Stunden wurden von den Verantwortlichen des MR Wunsiedel ausgezeichnet (von links): Hans Tröger, Geschäftsführer Andreas Hager, Toni Pößl, MR-Organisator Matthias Benker, Sandra Dörnhöfer, 2. Vorsitzender Michael Groschwitz und Vorstand Martin Goldschald.
Achtung, Respekt und Wertschätzung für Betriebshelfer / Maschinenring Fränkische Schweiz: Erfolgsbilanz trotz Corona
 Aufseß/Windischgaillenreuth.
Steigende Zahlen in nahezu allen Bereichen kann der
Maschinen- und Betriebshilfsring Fränkische Schweiz
für sich verbuchen. Bei der Jahreshauptversammlung
bezifferte Geschäftsführer Manuel Appel den
Verrechnungswert für das zurückliegende Jahr auf 3,1
Millionen Euro und damit auf über 100000 Euro mehr
als noch 2020. Beim Verrechnungswert handelt es sich
um den Wert, der auf der Basis der Kosten für die
Leistungen aller Bereiche angesetzt wird.
Aufseß/Windischgaillenreuth.
Steigende Zahlen in nahezu allen Bereichen kann der
Maschinen- und Betriebshilfsring Fränkische Schweiz
für sich verbuchen. Bei der Jahreshauptversammlung
bezifferte Geschäftsführer Manuel Appel den
Verrechnungswert für das zurückliegende Jahr auf 3,1
Millionen Euro und damit auf über 100000 Euro mehr
als noch 2020. Beim Verrechnungswert handelt es sich
um den Wert, der auf der Basis der Kosten für die
Leistungen aller Bereiche angesetzt wird.
Während die Zahl bei der Betriebshilfe minimal zurückgegangen war, können die Verantwortlichen für das Kerngeschäft der Maschinenvermittlung nahezu überall steigende Zahlen vermelden. Der Rückgang bei der Betriebshilfe liegt allerdings daran, dass hauptberufliche Kräfte mittlerweile über die Träger, also hauptsächlich über den Evangelischen Dorfhelferinnen und Betriebshelferdienst, abgerechnet werden. Lediglich nebenberufliche Kräfte rechnet der MR Fränkische Schweiz selbst ab. Trotzdem wurden immer noch 7713 Stunden soziale und 4934 Stunden wirtschaftliche Betriebshilfe geleistet. Während wirtschaftliche Betriebshilfe zur Abdeckung von Arbeitsspitzen angefordert werden kann, springt die soziale Betriebshilfe bei Krankheits- oder Notfällen auf landwirtschaftlichen Betrieben ein.
Diese Arbeit könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, sagte der Vorsitzende Bernhard Hack aus Weilersbach. „Die Tätigkeit der Betriebshelfer ist gerade in dieser Zeit nicht einfach“, so Hack. Die Helfer würden meistens mit Not, Krankheit oder Tod konfrontiert und müssten sich von jetzt auf gleich immer wieder auf eine neue Situation einstellen. Das sei absolut bewundernswert und deshalb sollte ihnen auch mit Achtung, Respekt und Wertschätzung begegnet werden. Für den MR Fränkische Schweiz sind vier Kräfte hauptamtlich, zwei weitere selbstständig und 20 nebenberuflich tätig.
 Bei
der Maschinenvermittlung machte der Bereich
Futterbau und Strohernte mit rund 1,2 Millionen Euro
den weitaus größten Teil aus. Das sei immerhin eine
Steigerung um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr,
sagte Manuel Appel. Die Arbeit mit Schleppern und
der Transport, sowie die Körnerernte waren ebenfalls
ertragsmäßig ganz oben angesiedelt.
Bei
der Maschinenvermittlung machte der Bereich
Futterbau und Strohernte mit rund 1,2 Millionen Euro
den weitaus größten Teil aus. Das sei immerhin eine
Steigerung um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr,
sagte Manuel Appel. Die Arbeit mit Schleppern und
der Transport, sowie die Körnerernte waren ebenfalls
ertragsmäßig ganz oben angesiedelt.
Zu den weiteren Aufgaben des Maschinenrings Fränkische Schweiz gehört die Übernahme der Geschäftsführung für die Biomasseheizwerke Hollfeld und Gößweinstein, für die Bioenergie Hollfeld und für die Regnitz-Jura-Düngetrac GmbH. Gewerbliche Aktivitäten hat der Ring zusammen mit den Nachbarringen Bayreuth und Kulmbach in der Maschinenring Oberfranken Mitte (OMI) GmbH gebündelt. Dazu gehört beispielsweise die Klauenpflege, die Maiszünslerbekämpfung oder die Unkrautbekämpfung mit Heißwasserthermie.
Der MR Fränkische Schweiz stellt ein besonderes Konstrukt dar, weil sich sein Tätigkeitsgebiet gleich auf drei Landkreise erstreckt. Neben zwei Gemeinden aus dem Landkreis Bamberg gehören vier Gemeinden aus dem Landkreis Bayreuth dazu, der Rest gehört zum Landkreis Forchheim. Der Ring hat 763 Mitglieder, 19 weniger als im Jahr zuvor.
In ihren Grußworten würdigte der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann, der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif und der Forchheimer Dekan Enno Weidt die Arbeit des Maschinenrings. „Ein Volk kann nur dann zufrieden leben, wenn es sich auch selbst versorgen kann“, sagte Greif. Was heute als Share Economy angepriesen wird, also die gegenseitige Unterstützung, sei bei den Maschinenringen schon lange Realität, so Wiedemann und Dekan Weidt erinnerte daran, dass Landwirtschaft und Kirche traditionell vielfältige Verbindungen haben.
Bilder:
1. Vorsitzender Bernhard Hack.
2. Geschäftsführer Manuel Appel.
Am 12. Juni: Tag der Landwirtschaft zwischen Reitstall und Flugplatz / Maschinen- und Betriebshilfering Kulmbach feiert 60. Geburtstag
 Kulmbach.
Drei Maschinenringe gab es Anfang der 1960er Jahre
auf dem Gebiet des heutigen Landkreises Kulmbach.
Alle drei wurden damals noch von der Sparkasse,
beziehungsweise den Raiffeisenbanken getragen. Mit
dem Zusammenschluss der drei Ringe genau vor 60
Jahren war der Maschinen- und Betriebshilfsring
Kulmbach entstanden. Den Geburtstag feiern die
Verantwortlichen um Vorsitzenden Andreas Textores
und Geschäftsführer Horst Dupke mit einem
großangelegten Tag der Landwirtschaft am Sonntag,
12. Juni von 13 bis 17 Uhr auf dem Gelände zwischen
dem Reitstall Michel und dem Kulmbacher Flugplatz.
Kulmbach.
Drei Maschinenringe gab es Anfang der 1960er Jahre
auf dem Gebiet des heutigen Landkreises Kulmbach.
Alle drei wurden damals noch von der Sparkasse,
beziehungsweise den Raiffeisenbanken getragen. Mit
dem Zusammenschluss der drei Ringe genau vor 60
Jahren war der Maschinen- und Betriebshilfsring
Kulmbach entstanden. Den Geburtstag feiern die
Verantwortlichen um Vorsitzenden Andreas Textores
und Geschäftsführer Horst Dupke mit einem
großangelegten Tag der Landwirtschaft am Sonntag,
12. Juni von 13 bis 17 Uhr auf dem Gelände zwischen
dem Reitstall Michel und dem Kulmbacher Flugplatz.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring ist als Dienstleister für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum nicht mehr aus Kulmbach wegzudenken. Der Ring hat mittlerweile 850 Mitglieder, sein Angebot reicht von der klassischen Maschinenvermittlung und Betriebshilfe bis hin zur Erschließung neuer Einkommensquellen für die Landwirte. Abgewickelt werden sie über die gewerbliche Tochtergesellschaft MR Oberfranken Mitte zusammen mit den Nachbarringen Bayreuth/Pegnitz und Fränkische Schweiz. Die breite Palette an Dienstleistungen im ländlichen Raum umfasst das Schneeräumen genauso wie die Sportplatzpflege.
Im Mittelpunkt des Tages der Landwirtschaft steht eine große Maschinenausstellung mit der die Leistungsfähigkeit der Selbsthilfeeinrichtung unter Beweis gestellt werden soll. „Vom Baumkletterer über Kehrmaschinen und Klauenpflegestand bis zum Sägespalter werden wir auf einem Rundweg unser gesamtes Programm vorstellen“, sagt Geschäftsführer Dupke. Auch die Heißwasserthermie zur Unkrautbekämpfung sowie Möglichkeiten, dem Eichenprozessionsspinner den Garaus zu machen, gehören zum umfangreichen Portfolio des Maschinenrings. „Wir wollen zeigen, dass wir auch für Privatgärten der richtige Ansprechpartner sind“, so Dupke.
Dazu gibt es mehrere Informationsstände unter anderem des Amtes für Landwirtschaft, des Bauernverbandes und der Waldbesitzervereinigung Kulmbach-Stadtsteinach. Landwirte aus der Region stellen einen kleinen Bauernmarkt zusammen, Ralf Michel vom Reitstall bietet zusammenmit den Bäuerinnen Kaffee und Kuchen, Bratwürste und Getränke an. Für Kinder wird eigens eine Hüpfburg aufgebaut, Hauptpreis einer Verlosung wird ein Rundflug über Kulmbach sein.
Der Tag der Landwirtschaft auf dem Gelände des Reitstalles Michel in Neufang, direkt neben dem Kulmbacher Flugplatz findet am 12. Juni von 13 bis 17 Uhr statt. Am Abend ab 20 Uhr steht für alle Mitglieder die Jahreshauptversammlung am gleichen Ort in der Reithalle auf dem Programm. Für alle Gewerbekunden und sonstige Interessenten gibt es dann am Montag, 13. Juni ab 9 Uhr einen Gewerbetag, bei dem der Maschinenring Oberfranken-Mitte seine umfangreichen Leistungen vorstellen wird. Bei schlechtem Wetter werden weite Teile des Programms in der Reithalle von Ralf Michel stattfinden.
Bild: Mit einer großen Maschinenausstellung feiert der Maschinenring Kulmbach am 12. Juni seinen 60. Geburtstag.
Rekordzahlen trotz Corona / Maschinenring Bayreuth-Pegnitz übertrifft beim Verrechnungswert erstmals die Acht-Millionen-Euro-Grenze – Betriebshelfer dringend gesucht
 Bayreuth/Pegnitz.
Die Corona-Krise ist am Maschinen- und
Betriebshilfering Bayreuth-Pegnitz nicht spurlos
vorübergegangen. „Die Pandemie war eine große
Herausforderung, vor allem für unsere
Betriebshelfer“, sagte der Vorsitzende Reinhard
Sendelbeck bei der ersten Jahreshauptversammlung
seit drei Jahren. Gerade die Helfer hätten alles
möglich gemacht, um den Betrieb auf den Höfen
aufrechtzuerhalten. Trotzdem konnten sich die Zahlen
in den vergangenen Jahren sehen lassen. Beim
Verrechnungswert wurde sogar erstmals die
Acht-Millionen-Grenze deutlich überschritten.
Bayreuth/Pegnitz.
Die Corona-Krise ist am Maschinen- und
Betriebshilfering Bayreuth-Pegnitz nicht spurlos
vorübergegangen. „Die Pandemie war eine große
Herausforderung, vor allem für unsere
Betriebshelfer“, sagte der Vorsitzende Reinhard
Sendelbeck bei der ersten Jahreshauptversammlung
seit drei Jahren. Gerade die Helfer hätten alles
möglich gemacht, um den Betrieb auf den Höfen
aufrechtzuerhalten. Trotzdem konnten sich die Zahlen
in den vergangenen Jahren sehen lassen. Beim
Verrechnungswert wurde sogar erstmals die
Acht-Millionen-Grenze deutlich überschritten.
Nach den Worten von Geschäftsführer Johannes Scherm wurden 2021 über 21700 Stunden soziale Betriebshilfe geleistet, fast 1600 mehr als 2020. Soziale Betriebshilfe heißt, dass ein Helfer einspringt, wenn es auf einem Hof zu krankheitsbedingten Ausfällen kommt. Dazu sind für den Maschinenring Bayreuth-Pegnitz über 40 haupt- und nebenberufliche Kräfte tätig. Viel zu wenig, wie Scherm feststellte. „Wir suchen dringend neue Leute.“ Der Geschäftsführer sprach von einer idealen Möglichkeit, Geld dazu zu verdienen. Als Stundenvergütung werden aktuell stattliche 20,35 Euro ausbezahlt.
Zweites wichtiges Standbein der Maschinenringe ist die Vermietung von Maschinen und schlagkräftiger Technik. Dazu hält der MR Bayreuth-Pegnitz unter anderem Schlepper, Pflüge, eine neue Kurzscheibenegge und einen Grubber vor. Die insgesamt drei Schlepper seien mit fast 2000 Stunden, die beiden Pflüge mit fast 1000 Stunden ausgelastet gewesen. 90 Mitglieder hätten den Maschinenpark bei rund 200 Einsätzen genutzt. Als Leistungsträger beim Verrechnungswert bezeichnete Scherm den Futterbau, die Körnerernte und die organische Düngung.
„Das alles sind Zahlen, die sich absolut sehen lassen können“, sagte der Geschäftsführer. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft sei an diesen Zahlen nicht ablesbar. Auch die Zahl der Mitglieder ist mit 1287 (drei weniger als 2020) nahezu gleich geblieben.
Als „Anwalt der Bauern“ für den gesamten Landkreis bezeichnete der Landtagsabgeordnete Martin Schöffel, der auch stellvertretender Vorsitzender des Landtagsausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ist, den Maschinenring. Schöffel nannte es schlimm genug, dass es erst Corona und den Krieg gebraucht hat, um festzustellen, wie leistungsfähig die heimische Landwirtschaft ist. „Ob Tank, Teller oder Trog, die Bauern können alles“, sagte der Politiker. Einer großen Mehrheit der Bevölkerung sei nun wieder bewusst geworden, dass die Landwirte die Ernährung sichern und den ländlichen Raum gestalten, so Landrat Florian Wiedemann.
Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde der Vorsitzende Reinhard Sendelbeck aus Gottsfeld ohne Gegenstimme in seinem Amt für weitere fünf Jahre bestätigt. Die beiden neuen Stellvertreter sind Martin Freiberger aus Aichig und Michael Seitz aus Nemschenreuth. Sie lösen den bisherigen zweiten Vorsitzenden Matthias Roder aus Würnsreuth ab, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Aufgrund der deutlich gestiegenen Aufgaben des Maschinenrings hatte die Versammlung vorher einer Satzungsänderung zugestimmt, nach der es künftig immer zwei statt bisher einen Stellvertreter geben soll.
Neu gewählt wurden auch die Mitglieder des zehnköpfigen Vorstandsteams: Andreas Weidinger (Weidensees), Daniel Lodes (Hohenmirsberg), Stephan Knopf (Unterölschnitz), Frank Lothes (Schnabelwaid), Jörg Etterer (Kirchenlaibach), Mario Ströbel (Döberschütz), Helmut Hacker (Seulbitz), Helmut Schlegel (Höflas-Gefrees), Johannes Parchent (Hardt) und Martin Hofmann (Mistelbach). Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Reinhard Preißinger (Einziegenhof), Armin Parchent (Hardt) und Harald Baumann (Guttenthau).
Bild: Die Spitze des Maschinenrings Bayreuth-Pegnitz mit den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern und den neuen Stellvertretern (von links): Michael Seitz, Harald Baumann, Reinhard Preissinger, Reinhard Sendelbeck, Johannes Scherm, Matthias Roder, Armin Parchent und Martin Freiberger.
Landwirtschaft hat Zukunft (25):
Nachhaltig und regional: Damwild aus dem Kulmbacher Land / Die Familie Wachter betreibt das Lehenthaler Wildgehege
 Lehenthal.
Das Damwild in Lehenthal ist schon eine kleine
Attraktion. Immer wieder kommen junge Familien mit
kleinen Kindern, um die Tiere zu beobachten, und
auch, um sie zu füttern. „Wir haben da nichts
dagegen. Im Gegenteil, wir freuen uns, dass wir mit
dem Gehege und unseren Tieren auch anderen eine
Freude bereiten können.“, sagen Vater Erwin und Sohn
Marcel Wachter. Erwin (63) ist der Betreiber des
Geheges und Inhaber der 130 Tiere starken Herde.
Marcel kümmert sich zusammen mit Bruder Alexander
und Schwester Julia um die Tiere und um deren
Vermarktung.
Lehenthal.
Das Damwild in Lehenthal ist schon eine kleine
Attraktion. Immer wieder kommen junge Familien mit
kleinen Kindern, um die Tiere zu beobachten, und
auch, um sie zu füttern. „Wir haben da nichts
dagegen. Im Gegenteil, wir freuen uns, dass wir mit
dem Gehege und unseren Tieren auch anderen eine
Freude bereiten können.“, sagen Vater Erwin und Sohn
Marcel Wachter. Erwin (63) ist der Betreiber des
Geheges und Inhaber der 130 Tiere starken Herde.
Marcel kümmert sich zusammen mit Bruder Alexander
und Schwester Julia um die Tiere und um deren
Vermarktung.
In Lehenthal ist das Elternhaus und auch der elterliche Hof von Erwin. Sein inzwischen verstorbener Bruder Herbert war es auch, der 1979 den Grundstein für die Damwildherde legte und die ersten Pflöcke für das Gehege einschlug. Dort wo früher ein Kartoffelacker war, hielten an Ostern 1980 die ersten sieben Tiere Einzug. Eigentlich wollte er einen neuen Rinderstall bauen, doch dann ist er beim Damwild gelandet“, erinnert sich Erwin. Aus einem ersten, zwei Hektar großen Gatter wurden mittlerweile zehn Hektar. Dazu kommen drum herum Flächen von über 20 Hektar, auf denen das Futter, Grünland und Getreide, wächst und gedeiht. „Wir erzeugen fast alles selbst“, sagt Marcel, und der Vorrat reicht für ein ganzes Jahr, was sich besonders in Trockenjahren bezahlt macht.
Auch wenn die Damwildhaltung im Nebenerwerb erfolgt, ist sie doch mehr als ein bloßes Hobby. Die Vermarktung erfolgt zum einen von lebenden Tieren vorwiegend für Zuchtzwecke nach Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen und Thüringen bis Brandenburg. Zum anderen schlachtet und zerlegt Erwin im eigenen EU-zertifizierten Schlachthaus mit Kühlraum in Lehenthal das Fleisch und verkauft es - überwiegend als Direktvermarkter. Mit dem Steakhouse „Müllers-KU“, dem ehemaligen kleinen Rathaus, wird saisonal aber auch die Gastronomie beliefert. Perspektivisch soll das Fleisch zudem über das lokale Erzeugerforum „Marktschwärmer“ in der Mönchshof erhältlich sein.
Ganz so einfach ist das aber auch alles nicht. Vater und Sohn verweisen auf eine eigene Fanganlage, Sachkundeprüfungen, Narkotisierungserlaubnisse, auch den notwendigen Jagdschein haben beide. Der Sohn, der in Stuttgart bei einem großen Konzern im Hauptberuf tätig ist, hat dort an der Abendschule auch die staatlich anerkannte Ausbildung zum Landwirt gemacht.
Höchst professionell wird auch für das Spezialitätenfleisch aus dem Kulmbacher Land geworben. Ob Instagram, Facebook oder Google, überall ist das Lehenthaler Damwild zu finden. Auf der Straße nach Gemlenz gibt es eine große Infotafel, auf der die Geschichte der Ranch mit ihren Facetten ansprechend zusammengefasst wurde.
„Wir wollen den Leuten nichts vormachen“, sagt Marcel Wachter. „Hier findet Natur statt.“ Dazu gehören Revierkämpfe genauso wie die Tatsache, dass das Wild bei Wind und Wetter, bei Regen und Schnee im Freien ist. Und natürlich werden die Tiere auch geschossen. „Das gehört halt auch dazu“, sagt Marcel. Für die Tiere bedeute das aber auch einen absolut stressfreien Tod, zum anderen stehe der Gedanke der Nachhaltigkeit im Vordergrund. Transportwege gibt es praktisch nicht.
Trotzdem müssen entweder Vater oder eines der Kinder jeden Tag mindestens einmal nach dem Rechten sehen. Immer wieder kommt es vor, dass sich beispielsweise ein Jungtier im Zaun verfängt. Auch Ausbrüche gab es schon. „Ich bin täglich ein bis zwei Stunden oben“, sagte Erwin, der mit seiner Familie in Unterdornlach zu Hause ist.Landwirtschaft hat Zukunft (24):
Landwirtschaft am Rande der Stadt / Kerstin und Hermann Grampp bewirtschaften in Melkendorf einen Milchviehbetrieb
 Auch
wenn die Arbeitsbelastung enorm ist und von den
derzeitigen Preissteigerungen beim Bauern kaum etwas
ankommt: „Landwirtschaft, das ist für mich Beruf und
Hobby in einem“, sagt Hermann Grampp (54). Er ist
überzeugt davon, dass es weiter geht, dass
Landwirtschaft Zukunft hat, auch wenn es das Umfeld
einem nicht gerade leicht macht.
Auch
wenn die Arbeitsbelastung enorm ist und von den
derzeitigen Preissteigerungen beim Bauern kaum etwas
ankommt: „Landwirtschaft, das ist für mich Beruf und
Hobby in einem“, sagt Hermann Grampp (54). Er ist
überzeugt davon, dass es weiter geht, dass
Landwirtschaft Zukunft hat, auch wenn es das Umfeld
einem nicht gerade leicht macht.
Mit seiner Nähe zum Stadtrand von Kulmbach, wenige Meter von der Melkendorfer Umgehung entfernt, hat der Hof der Familie Grampp schon eine ganz besondere Lage. Das war nicht immer so. 2007 vom Vater übernommen und im Jahr drauf von der Ortsmitte ausgesiedelt, gab es hier vielfältige Möglichkeiten der Expansion. War die alte Hofstelle, in der noch immer das Jungvieh sein Zuhause hat, gerade mal knapp 0,7 Hektar groß, hat die jetzige Hofstelle eine Fläche von stattlichen 2,7 Hektar.
Rund 200 Hektar bewirtschaftet die Familie, 70 Hektar Grünland, 130 Hektar Ackerland, auf dem Kleegras, Getreide, Mais und künftig auch Soja angebaut werden. Alles zum Eigenbedarf, denn die rund 150 Kühe in dem modernen offenen Laufstall brauchen schließlich genug zu Fressen. Nachdem das automatische Melksystem gut ausgelastet war, wurde später ein zweiter Melkroboter angeschafft. Seit 2017 wird der Betrieb nach den Bioland-Kriterien bewirtschaftet. Die Milch geht an die Milchwerke Oberfranken-West in Meeder bei Coburg.
Zwei Hilfskräfte sind zweitweise auf dem Hof tätig, doch im Wesentlichen erledigt die Familie alles selbst. Da sind die Eltern von Hermann Grampp, die noch auf der alten Hofstelle im Ort wohnen und dort das Jungvieh versorgen. Der Sohn und die große Tochter haben außerlandwirtschaftliche Berufe gefunden. „Wenn man sie braucht, sind sie aber immer zur Stelle““, sagt Hermann Grampp. Die jüngste Tochter Larissa legt heuer ihr Abitur ab .
 Ein ganz
besonderes Steckenpferd hat Ehefrau Kerstin. Sie
engagiert sich seit rund 20 Jahren für das Projekt
„Landfrauen machen Schule“. Dabei geht es darum,
hauptsächlich Erst- bis Viertklässlern
Landwirtschaft zu vermitteln. Kerstin Grampp ist
Ernährungsfachfrau und Meisterin der ländlichen
Hauswirtschaft. „Die Schüler sollen Landwirtschaft
sehen, riechen, schmecken und fühlen, kurz mit allen
Sinnen erfahren.“ Schließlich sei der Bezug zur
Landwirtschaft über weite Strecken völlig
abgerissen, in vielen Köpfen existiere ein völlig
falsches Bild. „Wir sind weder Zoo noch Museum“,
sagt Kerstin Grampp. Die jungen Leute sollen wieder
erfahren, wo die Grundnahrungsmittel herkommen und
was daraus entsteht.
Ein ganz
besonderes Steckenpferd hat Ehefrau Kerstin. Sie
engagiert sich seit rund 20 Jahren für das Projekt
„Landfrauen machen Schule“. Dabei geht es darum,
hauptsächlich Erst- bis Viertklässlern
Landwirtschaft zu vermitteln. Kerstin Grampp ist
Ernährungsfachfrau und Meisterin der ländlichen
Hauswirtschaft. „Die Schüler sollen Landwirtschaft
sehen, riechen, schmecken und fühlen, kurz mit allen
Sinnen erfahren.“ Schließlich sei der Bezug zur
Landwirtschaft über weite Strecken völlig
abgerissen, in vielen Köpfen existiere ein völlig
falsches Bild. „Wir sind weder Zoo noch Museum“,
sagt Kerstin Grampp. Die jungen Leute sollen wieder
erfahren, wo die Grundnahrungsmittel herkommen und
was daraus entsteht.
Trotz der großen Arbeitsbelastung bleibt auch für Hermann Grampp noch Zeit fürs Ehrenamt. Er ist Ortsobmann des Bauernverbandes und gehört auch der BBV-Kreisvorstandschaft an. Er ist außerdem Jagdvorstand und Kassier bei der örtlichen Feuerwehr.
Bild: Hermann Grampp glaubt fest an die Zukunft die Landwirtschaft.
Frischer Wind in der Steuerberatung / Kanzleiverbund Kulmbach der BBJ-Unternehmensgruppe unter neuer Leitung – Mandanten aus der Landwirtschaft im Focus
 Himmelkron
/ Kulmbach. Jörg Deuerling, Martin Dietel und
Michael Schuberth stehen künftig an der Spitze des
Kulmbacher Kanzleiverbundes der BBJ
Unternehmensgruppe. Sie lösen damit Günter Engel ab,
der über zehn Jahre hinweg die Kanzlei erfolgreich
zu einem fränkisch-sächsischen Verbund
weiterentwickelt hatte. Dazu gehören die Kanzleien
in Kulmbach, Scheßlitz, Plauen, Hof und Bayreuth mit
zusammen rund 120 Mitarbeitern. Der Stabwechsel an
der Spitze wurde jetzt bei einer Festveranstaltung
in Himmelkron vollzogen.
Himmelkron
/ Kulmbach. Jörg Deuerling, Martin Dietel und
Michael Schuberth stehen künftig an der Spitze des
Kulmbacher Kanzleiverbundes der BBJ
Unternehmensgruppe. Sie lösen damit Günter Engel ab,
der über zehn Jahre hinweg die Kanzlei erfolgreich
zu einem fränkisch-sächsischen Verbund
weiterentwickelt hatte. Dazu gehören die Kanzleien
in Kulmbach, Scheßlitz, Plauen, Hof und Bayreuth mit
zusammen rund 120 Mitarbeitern. Der Stabwechsel an
der Spitze wurde jetzt bei einer Festveranstaltung
in Himmelkron vollzogen.
Jörg Deuerling, Martin Dietel und Michael Schuberth kennen die Unternehmensgruppe bereits von der Pike auf. Martin Dietel und Michael Schuberth sind bereits seit ihrer Ausbildung zum Fachagrarwirt Rechnungswesen beim LBD (Landwirtschaftlicher Buchführungsdienst) in Kulmbach. Jörg Deuerling fand seinen Einstieg, nach seinem Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Steuern, bei der BERATA Kulmbach. Somit stehen dem Kanzleiverbund zwei Experten in der Landwirtschaft und mit Jörg Deuerling ein Profi im Gewerbe zur Verfügung.
Die BBJ-Unternehmensgruppe blickt auf eine lange Historie zurück. Bereits 1968 wurde der Buchführungsdienst der Bayerischen Jungbauernschaft gegründet, um Landwirte bei der anstehenden Buchführungspflicht zu unterstützen. Aus dem Verein entstanden schnell mehrere Unternehmen: die LBD Landwirtschaftlicher Buchführungsdienst GmbH, die BERATA-GmbH Steuerberatungsgesellschaft und die rwb Revisions- und Wirtschaftsberatungs-GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Mittlerweile ist aus dem Verein eine große Unternehmensgruppe geworden, die an 43 Standorten insgesamt rund 1200 Mitarbeiter beschäftigt. Dabei bündelt die BBJ die Kompetenzen rund um Finanzen, Steuern und Betriebsentwicklung in Bayern, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. „Unser Buchführungsdienst hilft dabei Landwirten bei der Einhaltung ihrer steuerlichen Pflichten“, sagte Geschäftsführer Gunter Nüssel. Die BERATA widmet sich verschiedensten Gewerben und freien Berufen. Außerdem unterstützt sie auch Privatpersonen bei allen Anliegen rund um die Steuererklärung. „Wir haben auch bei Fragen zu Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung sowie -bewertung mit den Fachleuten der rwb die richtigen Ansprechpartner für unsere Mandanten“, so Nüssel.
„Vertrauensvoll legen unsere Mandanten seit Jahrzehnten ihre sensiblen Daten in unsere Hände“, sagte Nüssel. „Stets entwickeln wir neue Lösungen, um die tägliche Arbeit zu vereinfachen und die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Wir nehmen unsere Kunden auf Ihrem Weg in die Digitalisierung und in die Zukunft an die Hand.“ Die rund 120 Mitarbeiter würden die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Mandanten oft aus ihrem eigenen Umfeld kennen, denn viele von ihnen stammen selbst aus der Landwirtschaft oder sind privat eng mit ihr verbunden.
Diese Herkunft spiegelt sich auch im Tätigkeitsfeld des Kanzleiverbundes wider. Der Fokus liege klar auf der Betreuung von Mandanten aus dem landwirtschaftlichen Bereich sowie deren gewerblichen Nebenbetrieben. Die Mitarbeiter helfen den Betrieben bei wirtschaftlichen Fragen und unterstützen bei den strategischen Planungen, wenn es zum Beispiel um Betriebsübergaben oder Verpachtungen geht. Dafür sind Außendienstler in großen Teilen Oberfrankens sowie dem Südwesten von Sachsen und teilweise auch im Südosten von Thüringen unterwegs.
Bild: Martin Dietel, Jörg Deuerling (von links) und Michael Schuberth (rechts) stehen künftig an der Spitze des Kulmbacher Kanzleiverbundes der BBJ Unternehmensgruppe. Sie lösen damit Günter Engel (2. von rechts) ab, der über zehn Jahre hinweg die Kanzlei geleitet hatte.
Landfrauen suchen Dialog mit der Gesellschaft / Keine Veränderungen an der Spitze: Angelika Seyferth als Kreisbäuerin wiedergewählt
.jpg) Bayreuth.
Die bisherige Kreisbäuerin ist auch die neue:
Angelika Seyferth (64) aus Mistelgau ist bei den
turnusmäßigen Verbandswahlen der Landfrauengruppe im
Bauernverband einstimmig für die kommenden fünf
Jahre in ihrem Amt bestätigt worden. Keine
Veränderungen gab es auch im Amt ihrer
Stellvertreterin. Doris Schmidt (54) aus Plech wurde
ebenso wie schon zuvor Angelika Seyferth mit 35 von
35 möglichen Stimmen gewählt.
Bayreuth.
Die bisherige Kreisbäuerin ist auch die neue:
Angelika Seyferth (64) aus Mistelgau ist bei den
turnusmäßigen Verbandswahlen der Landfrauengruppe im
Bauernverband einstimmig für die kommenden fünf
Jahre in ihrem Amt bestätigt worden. Keine
Veränderungen gab es auch im Amt ihrer
Stellvertreterin. Doris Schmidt (54) aus Plech wurde
ebenso wie schon zuvor Angelika Seyferth mit 35 von
35 möglichen Stimmen gewählt.
Eine Verjüngung gab es dagegen bei den fünf Beirätinnen. Sie bilden zusammen mit Kreisbäuerin und deren Stellvertreterin die engere Vorstandschaft der Landfrauen im Landkreis Bayreuth. Mit Johanna Hohlweg aus Bad Berneck (23) und Monika Daubinger (39) aus Höfen wurden zwei Landfrauen jeweils mit großer Mehrheit neu in den Beirat gewählt. In diesem Amt bestätigt wurden Petra Lodes (54) aus Leups, Martina Heintke (39) aus Gebhardshof und Gerlinde Ströbel (43) aus Troschenreuth. Nicht mehr Mitglied des Vorstandes sind Elfriede Adelhardt aus Pottenstein und Hedwig Loos aus Kornbach.
Die alte und neue BBV-Kreisbäuerin Angelika Seyfert sprach von fünf lehrreichen Jahren, die hinter ihr liegen. Die vielen Aufgabenbereiche, die trotz Corona angepackt worden seien, hätten stets Spaß gemacht und seien für alle Beteiligten wertvoll gewesen. Angelika Seyferth ist seit 25 Jahren als Ortsbäuerin aktiv, gehört seit 15 Jahren der Kreisvorstandschaft an und ist seit fünf Jahren Kreisbäuerin. Den Milchviehbetrieb mit Ackerbau, den sie mit ihrem Mann führte, hat sie bereits an die nächste Generation übergeben.
.jpg) Die
Landfrauen seien das zuverlässige Spracherohr der
Landwirtschaft, sagte BBV-Direktor Wilhelm Böhmer.
Er drückte seine Hoffnung aus, dass vor dem
Hintergrund der Ukraine-Krise wieder ein wenig mehr
Vernunft in die Diskussion um die Landwirtschaft
komme. „Unsere Botschaft lautet: bei uns ist die
Ernährung sicher“, so Wilhelm Böhmer. Beim Getreide
liege der Selbstversorgungsgrad bei 100 Prozent, bei
Kartoffeln sogar bei 150 Prozent. Was allerdings
geradezu explodiert sei, sind die Preise für
Düngemittel und Rohstoffe.
Die
Landfrauen seien das zuverlässige Spracherohr der
Landwirtschaft, sagte BBV-Direktor Wilhelm Böhmer.
Er drückte seine Hoffnung aus, dass vor dem
Hintergrund der Ukraine-Krise wieder ein wenig mehr
Vernunft in die Diskussion um die Landwirtschaft
komme. „Unsere Botschaft lautet: bei uns ist die
Ernährung sicher“, so Wilhelm Böhmer. Beim Getreide
liege der Selbstversorgungsgrad bei 100 Prozent, bei
Kartoffeln sogar bei 150 Prozent. Was allerdings
geradezu explodiert sei, sind die Preise für
Düngemittel und Rohstoffe.
Prominenter Gast bei der Wahlversammlung in der Tierzuchtklause war die bayerische Landesbäuerin Anneliese Göller. Sie zitierte aus der jüngsten Bäuerinnenstudie, dass die größte Sorge ihrer Berufskolleginnen eine unzuverlässige Agrarpolitik sei. Hier gelte es sich auch weiterhin einzusetzen und für den Berufsstand am Ball zu bleiben. „Wir werden auch weiterhin den Dialog mit der Gesellschaft suchen“, sagte Anneliese Göller. Projekte und Aktionen wie „Landfrauen machen Schule“ oder der Kindertag auf den Bauernhöfen sollten deshalb unbedingt fortgesetzt werden.
Bild:
1. Die Bayreuther Kreisbäuerin Angelika Seyferth
(links) ist in ihrem Amt für weitere fünf Jahre
bestätigt worden. Prominenteste Gratulantin war die
bayerische Landesbäuerin Anneliese Göller.
2. Die neue Vorstandschaft der Landfrauengruppe im
BBV (von links): BBV-Direktor Wilhelm Böhmer,
Johanna Hohlweg, Doris Schmidt, Gerlinde Ströbel,
Monika Daubinger, Petra Lodes, Kreisbäuerin Angelika
Seyferth, BBV-Geschäftsführer Harald Köppel, Martina
Heintke und Landesbäuerin Anneliese Göller.
Schweinemarkt vor gewaltigem Umbruch: Klasse statt Masse / Insektenfleisch und „Clean Meat“ statt Spanferkel und Schweinesteak – Fachgespräch mit Metzger und Produzenten
 Zettlitz.
Die Schweinehaltung wird sich in den kommenden
Jahren extrem verändern. Davon geht Rüdiger Strobel
von der gleichnamigen Landmetzgerei im Selbitzer
Ortsteil Dörnthal aus. „Die Entwicklung wird weg von
der Masse und dafür hin zur Klasse gehen“, sagt
Strobel, der vor Jahren mit seinen Strohschweinen
bekannt wurde.
Zettlitz.
Die Schweinehaltung wird sich in den kommenden
Jahren extrem verändern. Davon geht Rüdiger Strobel
von der gleichnamigen Landmetzgerei im Selbitzer
Ortsteil Dörnthal aus. „Die Entwicklung wird weg von
der Masse und dafür hin zur Klasse gehen“, sagt
Strobel, der vor Jahren mit seinen Strohschweinen
bekannt wurde.
Bei einem Meinungsaustausch mit dem Kulmbacher BBV-Kreisobmann und Ferkelerzeuger Wilfried Löwinger auf dem Betrieb von Udo Köhler, ebenfalls Ferkelerzeuger, in Zettlitz bei Gefrees sagt Strohschweinmetzger Strobel voraus, dass der typische Kunde der Zukunft nur noch ein- bis zweimal pro Woche Fleisch genießen wird, dafür aber dann ein Top-Produkt für sich in Anspruch nehmen möchte.
Den breiten Markt werden Billigimporte von Tieren abdecken, die nicht mehr aus Deutschland stammen. Auch Insektenfleisch oder sogenanntes „Clean Meat“, also künstlich erzeugtes Fleisch aus dem Labor, wären denkbar. Mit Blick auf die zurückliegenden Jahre sei der Fleischkonsum ohnehin schon deutlich zurückgegangen. Denkbar sei auch, dass im Vergleich zum jetzigen Stand in zehn bis 15 Jahren nur noch halb so viele Schweine aus Deutschland kommen.
Dem pflichtet der Kulmbacher Kreisobmann Wilfried Löwinger bei. So seien bei der letzten Herbstzählung zehn Prozent der Tiere und eineinhalb Prozent der Halter weniger gezählt worden, als noch vor Jahresfrist. „Früher war es stets anders herum“, so Löwinger. „Viele Betriebe hören derzeit auf, das zeigt, wir gehen einem echten Strukturwandel entgegen.“
Als Gründe für die Fleischmisere nennt er unter anderem den zurückgegangenen Fleischverbrauch aufgrund von gestiegenem Gesundheitsbewusstsein und einer wachsenden Zahl von Vegetariern und Veganern. Allerdings ist Löwinger fest überzeugt davon, dass allen Ideologien zum Trotz auch in Zukunft hierzulande Fleischverzehr stattfinden wird.
Viel wichtiger als die Einteilung in Haltungsstufen, wie sie der Lebensmitteleinzelhandel derzeit vornimmt, erachtet Löwinger eine Herkunftskennzeichnung. Haltungsstufen seien austauschbar, das Fleisch könne dann zu günstigeren Preisen auch direkt aus dem Ausland importiert werden. Fleisch aus Deutschland und besonders aus Bayern werde dagegen verstärkt nachgefragt, doch daran hätten die großen Discounter kein Interesse.
Die Landmetzgerei Strobel gibt es bereits seit 40 Jahren. Seit 21 Jahren steht Rüdiger Strobel an der Spitze. Er stellte 2015 auf Strohschweine um und wurde dafür zunächst lange belächelt. Heute gibt ihm der Erfolg Recht. Bis zu 30 Tiere werden pro Woche geschlachtet. Die Tiere kommen von aktuell zehn Bauern aus den Landkreisen Bayreuth, Hof und Wunsiedel. Strobel ist außerdem in der Interessensgemeinschaft Bayerisches Strohschwein aktiv, ein Zusammenschluss, der sich um Kontakte zu Großabnehmern und Produzenten kümmert.
Bild: Der Kulmbacher Kreisobmann Wilfried Löwinger, Strohschweinmetzer Rüdiger Strobel mit Emmi Köhler auf der Schulter und Ferkelerzeuger Udo Köhler (von links) trafen sich zum Fachgespräch über die Zukunft der Schweinehaltung in Zettlitz.
Landwirtschaft hat Zukunft (23):
Klasse statt Masse / Familie Berthold vermarktet Kulmbacher Weideschweine über Ihren Hofladen in Kulmbach und online in ganz Deutschland
.jpg) Eggenreuth.
Regional, transparent und fair: das sind die drei
wichtigsten Kriterien für das Kulmbacher
Weideschwein. Was mit einer Zuchtsau vor
mittlerweile über acht Jahren begann, hat sich
mittlerweile schon fast zum Selbstläufer entwickelt.
200 Schweine umfasst die Herde oberhalb der kleinen
Ortschaft Eggenreuth. Die außerordentliche Qualität
des Fleisches hat sich mittlerweile herumgesprochen,
so dass Kunden aus ganz Deutschland Steaks,
Schäufele, Würste, Koteletts und vieles mehr über
das Internet bestellen. „Kein Wunder,
Schweinehaltung in dieser Form ist nicht wirklich
verbreitet“, sagt Ben Berthold.
Eggenreuth.
Regional, transparent und fair: das sind die drei
wichtigsten Kriterien für das Kulmbacher
Weideschwein. Was mit einer Zuchtsau vor
mittlerweile über acht Jahren begann, hat sich
mittlerweile schon fast zum Selbstläufer entwickelt.
200 Schweine umfasst die Herde oberhalb der kleinen
Ortschaft Eggenreuth. Die außerordentliche Qualität
des Fleisches hat sich mittlerweile herumgesprochen,
so dass Kunden aus ganz Deutschland Steaks,
Schäufele, Würste, Koteletts und vieles mehr über
das Internet bestellen. „Kein Wunder,
Schweinehaltung in dieser Form ist nicht wirklich
verbreitet“, sagt Ben Berthold.
Der 35-jährige stammt aus dem nahen Mainleus, hat in den Niederlanden Physiotherapie studiert und ist noch heute als Yoga-Lehrer tätig. Seine Frau Johanna lernte er in Finnland kennen. Zusammen entschloss sich das Paar, wieder in die Heimat von Ben zurückzukehren. Zunächst pachteten beide den Dörnhof unterhalb von Eggenreuth, 2016 kauften sie dann das zuletzt leer stehende landwirtschaftliche Anwesen in Eggenreuth, um sich hier den Traum von der Direktvermarktung alter Schweinerassen zu erfüllen.
Die Rassen tragen Namen wie Mangalica Wollschweine, Bunte Bentheimer, Deutsches Sattelschwein Iberico oder Duroc. Allen gemeinsam ist, dass sie als besonders widerstandsfähig und robust gelten. Anders wäre es auch nicht möglich, die Tiere ganzjährig im Freien auf der Weide zu halten. Schutz vor Wind und Wetter finden sie in Hütten mit reichlich Stroh. „Wir wollen gutes Fleisch aus anständiger Haltung produzieren“, sagt Ben Berthold.
Auf einem Teil der rund 15 Hektar Fläche tummelt sich die Herde. Für den Nachwuchs sorgen zwei Eber und zehn Zuchtsauen. Angebaut werden vor allem Klee, aber auch verschiedene Getreidesorten, Leguminosen, Wicken oder Sonnenblumen. Bei den benötigten zwei Kilo Futter pro Tag und Tier müssen die Bertholds freilich zukaufen, in der Regel Weizen, Gerste und Erbsen von Bauern aus der Nachbarschaft. Da sich die Tiere ständig bewegen, brauchen sie auch deutlich mehr Energie, als in herkömmlichen Haltungsformen.
.jpg) Einmal
im Monat werden drei bis vier Tiere im nahen
Kulmbach geschlachtet. Sie sind dann circa 14 Monate
alt und bringen rund 120 Kilogramm auf die Waage.
Das Zerlegen, die Verarbeitung und die Verpackung
erfolgt fachgerecht durch einen Metzger auf dem Hof
in Eggenreuth. Auf der Website der Kulmbacher
Weideschweine kann sich jeder sein individuelles
Fleischpaket zusammenzustellen. Großer Verkauf und
Abholung der vorbestellten Waren ist immer am ersten
Samstag im Monat. Tags darauf gibt es dann
allmonatlich eine Art „Tag der offenen Tür“, an dem
Ben Berthold allen Interessierten die
Schweinehaltung und alles, was dazugehört erklärt.
„Das ist aus der Not heraus entstanden, denn
irgendwann wollten immer mehr Menschen wissen, was
wir da so machen“, erinnert sich Ben Berthold.
Einmal
im Monat werden drei bis vier Tiere im nahen
Kulmbach geschlachtet. Sie sind dann circa 14 Monate
alt und bringen rund 120 Kilogramm auf die Waage.
Das Zerlegen, die Verarbeitung und die Verpackung
erfolgt fachgerecht durch einen Metzger auf dem Hof
in Eggenreuth. Auf der Website der Kulmbacher
Weideschweine kann sich jeder sein individuelles
Fleischpaket zusammenzustellen. Großer Verkauf und
Abholung der vorbestellten Waren ist immer am ersten
Samstag im Monat. Tags darauf gibt es dann
allmonatlich eine Art „Tag der offenen Tür“, an dem
Ben Berthold allen Interessierten die
Schweinehaltung und alles, was dazugehört erklärt.
„Das ist aus der Not heraus entstanden, denn
irgendwann wollten immer mehr Menschen wissen, was
wir da so machen“, erinnert sich Ben Berthold.
„Unser Ziel ist Klasse, nicht Masse“, sagt er. Eine Aufstockung der Herde schließt er deshalb auch aus. „Mehr produzieren, das können andere besser“, so Berthold. Dafür sei halt auch nicht immer alles verfügbar. Das wissen die vielen Stammkunden. Sie wissen aber auch die hohe Qualität zu schätzen und sind dafür bereit, einen Preis zu zahlen, der naturgemäß weit über dem des Discounters liegt.
Zweites Standbein ist das Leasen eines kompletten Schweines. Der Kunde sucht sich bei dieser Form der Lohnmast ein acht Wochen altes Ferkel aus, das in Eggenreuth im Familienverband aufwächst. Für Futter und Pflege sind monatlich 85 Euro fällig. Der Kunde selbst bestimmt dann, wann das Schwein geschlachtet wird und wie die Verarbeitung erfolgt.
Bilder:
1. Ein
ganz besonderes Geschmackserlebnis versprechen
Johanna und Ben Berthold mit ihren Spezialitäten vom
Kulmbacher Weideschwein.
2. Die
Weideschweine von Eggenreuth leben das ganze Jahr
über im Freien und sind ständig in Bewegung.
Krieg und Corona rücken Landwirtschaft in die Mitte / Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause: Kulmbacher Bäuerinnen trafen sich erstmals wieder zum Landfrauentag
 Stadtsteinach.
Einen „Blick durchs Schlüsselloch in Richtung
Zukunft der Landwirtschaft“ haben alle Redner beim
Kulmbacher Landfrauentag am Sonntagnachmittag in
Stadtsteinach gewagt. Kreisbäuerin Beate Opel und
der Landtagsabgeordnete Martin Schöffel bedauerten
dabei, dass die Landwirte längst nicht mehr in der
Mitte der Gesellschaft stehen, sondern an den Rand
gedrängt wurden. „Früher war die Landwirtschaft
etwas Besonderes, heute kritisiert man nur noch an
uns herum“, sagte Beate Opel. Martin Schöffel, der
auch stellvertretender Vorsitzender des
Landtagsausschusses für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten ist, sah aber auch eine Trendumkehr in
vielen Bereichen. Die Corona-Krise als auch der
Krieg in der Ukraine hätten gezeigt, wie wichtig
eine zuverlässige Versorgung mit gesunder Ernährung
im eigenen Land ist. „Es muss jetzt jedem bewusst
werden, dass wir eine leistungsfähige Landwirtschaft
brauchen“, so Schöffel.
Stadtsteinach.
Einen „Blick durchs Schlüsselloch in Richtung
Zukunft der Landwirtschaft“ haben alle Redner beim
Kulmbacher Landfrauentag am Sonntagnachmittag in
Stadtsteinach gewagt. Kreisbäuerin Beate Opel und
der Landtagsabgeordnete Martin Schöffel bedauerten
dabei, dass die Landwirte längst nicht mehr in der
Mitte der Gesellschaft stehen, sondern an den Rand
gedrängt wurden. „Früher war die Landwirtschaft
etwas Besonderes, heute kritisiert man nur noch an
uns herum“, sagte Beate Opel. Martin Schöffel, der
auch stellvertretender Vorsitzender des
Landtagsausschusses für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten ist, sah aber auch eine Trendumkehr in
vielen Bereichen. Die Corona-Krise als auch der
Krieg in der Ukraine hätten gezeigt, wie wichtig
eine zuverlässige Versorgung mit gesunder Ernährung
im eigenen Land ist. „Es muss jetzt jedem bewusst
werden, dass wir eine leistungsfähige Landwirtschaft
brauchen“, so Schöffel.
Die Menschen im Landkreis Kulmbach wüssten, was sie an ihren Bauern haben, sagte der Abgeordnete. Mit ihrem Einsatz, ihr hohes Wissen und ihre engagierte Tätigkeit seien die Bauern sehr wohl etwas Besonderes und gehörten auch in die Mitte der Gesellschaft. Schöffel zählte mehrere sogenannte Megatrends auf, die alle mit dem bäuerlichen Berufsstand in Verbindung stehen. Der Trend zu einem gesunden Leben etwa, der ohne Bauern nicht zu verwirklichen sei. Nicht umsonst seien überall neue Hofläden oder andere Vermarktungsformen entstanden.
Viele Megatrends hätten sich aber auch längst umgekehrt. Etwa der Trend zur Urbanisierung. Ein Blick auf die zurückliegenden beiden Jahre zeigt, dass wieder mehr Menschen aus Großstädten und Ballungsräumen weggezogen als zugezogen seien. „Das Leben auf dem Land wird durchaus wieder als wertvoll angesehen. Gleiches treffe auf den Trend zur Globalisierung zu. So habe der Verbraucher erkennen müssen, dass insbesondere Nahrungsmittel aus dem Ausland eben nicht unbegrenzt verfügbar seien. „Es muss jedem bewusst werden, dass wir unseren hohen Selbstversorgungsgrad nicht leichtfertig aufs Spiel setzen dürfen.“
Kreisbäuerin Beate Opel bedauerte, dass viele Grundkenntnisse bei jungen Leuten einfach nicht mehr vorhanden seien. Dies treffe ganz besonders auf Kenntnisse im Zusammenhang mit der Ernährung zu. Da seien die Bäuerinnen gefragt, etwa mit dem Projekt „Landfrauen machen Schule“, mit dem Schülerinnen und Schülern wieder Grundkenntnisse im Umgang mit Lebensmitteln und bei der Nahrungszubereitung nahe gebracht werden sollen. „Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit sind durch den Krieg und durch Corona wieder in den Focus gerückt“, so Beate Opel.
Der ländliche Raum biete viele Vorteile, die gelte es nach außen verstärkt darzustellen, dann werde auch die Bedeutung der Landwirtschaft für unsere Gesellschaft wieder mehr erkannt, sagte Landrat Klaus Peter Söllner. Stadtsteinachs Bürgermeister Roland Wolfrum, freute sich, dass sich die Kulmbacher Landfrauen nach mittlerweile zwei Jahren endlich wieder in der Steinachtalhalle treffen können. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, freute er sich schon auf die nächsten Begegnungen.
Zum Landfrauentag gehört natürlich immer ein Rahmenprogramm. Statt eines Chores sangen diesmal der Bariton Steffen Schmidt begleitet von Ludger Ahrens am E-Piano italienische Lieder, Andrea Greim und Ines Schramm führten einen Sketch auf und das Modegeschäft PriVera Trend & Style aus Kulmbach zeigte eine Modenschau.
Bild: Kreisbäuerin Beate Opel (links) und Stellvertreterin Silvia Schramm bedankten sich beim Referenten, dem Landtagsabgeordneten Martin Schöffel mit einem Präsent für die Übernahme des Referates beim Landfrauentag in Stadtsteinach.
Waldbesitzer planen Neubau / Borkenkäfer sorgte für Rekorde - WBV will von Treppendorf nach Hollfeld umziehen
 Hollfeld.
Die Waldbesitzervereinigung Hollfeld wird in den
kommenden Jahren eine neue Geschäftsstelle
errichten. Der Bau soll in Holzbauweise entstehen
und eine Nutzfläche von 250 bis 280 Quadratmetern
haben. Standort wird die Stadt Hollfeld sein, auf
ein konkretes Grundstück hat man sich allerdings
noch nicht festgelegt. Die WBV erstreckt sich über
drei Landkreise: Bamberg, Bayreuth und Kulmbach.
Hollfeld.
Die Waldbesitzervereinigung Hollfeld wird in den
kommenden Jahren eine neue Geschäftsstelle
errichten. Der Bau soll in Holzbauweise entstehen
und eine Nutzfläche von 250 bis 280 Quadratmetern
haben. Standort wird die Stadt Hollfeld sein, auf
ein konkretes Grundstück hat man sich allerdings
noch nicht festgelegt. Die WBV erstreckt sich über
drei Landkreise: Bamberg, Bayreuth und Kulmbach.
Der Grundstückserwerb soll allerdings der nächste Schritt sein, nachdem die Mitgliederversammlung mit 77 zu 13 Stimmen ihre Zustimmung gegeben hat. Die Kosten sollen weitgehend aus Eigenmitteln bestritten werden. Nachdem es weder ein Grundstück, noch konkrete Planungen gibt, steht die Investitionssumme noch nicht fest. Genauso wenig wie der Zeitplan. „Wir würden gerne baldmöglichst starten“, sagte der wiedergewählte Vorsitzende Christian Dormann. Aufgrund der derzeitigen Situation in der Baubranche könnten allerdings keine verbindlichen Aussagen getroffen werden. „Einen Baubeginn wird es nur geben, wenn die Konditionen annehmbar sind“.
Der Neubau ist notwendig, nachdem die bisherige, angemietete Geschäftsstelle in Treppendorf aus allen Nähten platzt. „Wir stoßen an unsere Grenzen, nachdem die Aufgaben immer mehr werden“, so der Vorsitzende. Deshalb möchte man auch gleich groß genug bauen. „Wir werden keinen Palast hinstellen“, versprach Dormann. „Aber wer weiß, was in den nächsten Jahren noch alles auf uns zukommt“.
Dabei seien bereits die zurückliegenden Jahre überaus fordernd gewesen. „Der Käfer fliegt und fliegt und bohrt auch fleißig.“ Dormann appellierte deshalb an alle Waldbesitzer, Käferholz schnellstmöglich zu entfernen und für Waldhygiene zu sorgen. „Andernfalls wird uns die nächste Käferwelle komplett überrollen.“
Nach den Worten von Stefanie Blumers hat die WBV aktuell 1674 Mitglieder, 20 mehr als vor zwei Jahren. Zusammen bewirtschaften sie eine Waldfläche von knapp 13000 Hektar. Auch Blumers warnte vor dem Borkenkäfer: „Wenn man ihn nicht frühzeitig erwischt, breitet er sich ungehindert aus“, sagte sie. Ab Mitte Juli des zurückliegenden Jahres sei es soweit gewesen. Im Sommer seien teilweise bis zu sieben Harvester im Vereinsgebiet im Einsatz gewesen, um das Schadholz aus dem Wald zu bringen. „Da kamen alle an ihre Grenzen“, sogar Aushilfskräfte habe man einsetzen müssen. Habe die vermarktete Holzmenge 2020 noch bei insgesamt knapp 29000 Festmeter gelegen, seien es 2021 fast 82000 Festmeter, zum weitaus größten Teil Fichten, gewesen. Damit sei der Rekord von 2007 geknackt worden.
Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde Christian Dormann aus Sachsendorf ohne Gegenstimme in seinem Amt bestätigt. Auch der zweite Vorsitzende Matthias Weigand wurde mit 67 von 84 abgegebenen Stimmen wiedergewählt. Für das Amt des dritten Vorsitzenden war mit Harald Gardill ein Gegenkandidat zum bisherigen Amtsinhaber Benjamin Täuber angetreten. Völlig überraschend konnte Gardill, bisher Maschinenwart der WBV aus Drosendorf, die Wahl mit 37 Stimmen für sich entscheiden. Auf Täuber, den bisherigen dritten Vorsitzenden aus Berndorf bei Thurnau, waren nur 23 Stimmen entfallen. Rechnungsführerin bleibt Carola Betz, neuer Schriftführer ist Frank Drentwett aus Bayreuth. Er löst den langjährigen Schriftführer Helmut Stenglein ab, der sein Amt aus Altersgründen zur Verfügung gestellt hatte.
Bild: Helmut Stenglein wurde vom Vorstandsmitglied Carola Betz und vom Vorsitzenden Christian Dormann (von links) mit einem Präsent aus den Reihen des Vorstandes verabschiedet.
Keine Importe aus der Ukraine: Rapsmarkt komplett leergefegt / Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps Oberfranken: Anbaufläche und Vermarktung konnten deutlich zulegen
 Bamberg.
Die leuchtend gelben Rapsfelder sind derzeit kaum zu
übersehen. Das hat seinen Grund: Von einem
signifikanten Anstieg der Vermarktungsmenge konnten
Vorstand und Geschäftsführung der
Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps in
Oberfranken berichten. „Wir sind wieder jemand im
Bereich der Rapsvermarktung“, sagte Vorsitzender
Klaus Siegelin aus Küps bei der Jahresversammlung in
Bamberg.
Bamberg.
Die leuchtend gelben Rapsfelder sind derzeit kaum zu
übersehen. Das hat seinen Grund: Von einem
signifikanten Anstieg der Vermarktungsmenge konnten
Vorstand und Geschäftsführung der
Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps in
Oberfranken berichten. „Wir sind wieder jemand im
Bereich der Rapsvermarktung“, sagte Vorsitzender
Klaus Siegelin aus Küps bei der Jahresversammlung in
Bamberg.
Insgesamt wird die vermarktete Menge aus Oberfranken mit rund 45000 Tonnen angegeben. Nicht alles läuft dabei über die Erzeugergemeinschaft, deren Aufgabe vor allem in der Vermittlung liegt. „Uns geht es darum, den Landwirten zu helfen, den besten Preis zu erzielen“, sagte Geschäftsführer Thorsten Gunselmann vom Bauernverband in Oberfranken. Raps liefert im Wesentlichen Öl, aus dem Schrot wird ein hochwertiges Eiweißfutter gewonnen, außerdem wird Rapshonig immer mehr nachgefragt.
Sorgen bereitet den Verantwortlichen allerding das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Die europäische Produktion (zuletzt 17,4 Millionen Tonnen pro Jahr), deckt den europäischen Bedarf (22,8 Millionen Tonnen) nicht ab. Über fünf Millionen Tonnen Raps müssen importiert werden. Dabei kam bislang am meisten Raps aus der Ukraine, gefolgt von Australien und Kanada. „Der Rapsmarkt ist momentan total leer gefegt“, sagte Geschäftsführer Gunselmann. Seinen Worten zufolge reichen die weltweiten Rapsreserven gerade einmal 20 Tage, so wenig wie selten zuvor.
Auf etwa fünf Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Oberfranken wächst der Raps. Das sind zusammen rund 14000 Hektar, womit wieder das Niveau von 2014 erreicht worden sei. Zwischenzeitlich war die Anbaufläche im Regierungsbezirk sogar auf unter 10000 Hektar gerutscht. Gesunken war allerdings auch im zurückliegenden Jahr die Zahl der Mitglieder in der Erzeugergemeinschaft. Der aktuelle Stand von 561 Mitgliedern bedeutet 33 weniger als noch vor Jahresfrist, was ausnahmslos dem Strukturwandel geschuldet ist.
 Europaweit
ist das größte Anbauland in Europa nach wie vor
Frankreich. Deutschland liegt mit mehr als einer
Million Hektar Raps immerhin wieder auf Platz zwei,
nachdem die Anbaufläche 2019 und 2020 aufgrund der
miserablen Marktsituation nach unten gegangen war.
Auch beim Klimawandel kann Raps durchaus punkten.
Wir sind ein Teil der Lösung“, sagte Vorsitzender
Siegelin. Rapsanbau sei ganz klar als Beitrag zum
Klimaschutz anerkannt.
Europaweit
ist das größte Anbauland in Europa nach wie vor
Frankreich. Deutschland liegt mit mehr als einer
Million Hektar Raps immerhin wieder auf Platz zwei,
nachdem die Anbaufläche 2019 und 2020 aufgrund der
miserablen Marktsituation nach unten gegangen war.
Auch beim Klimawandel kann Raps durchaus punkten.
Wir sind ein Teil der Lösung“, sagte Vorsitzender
Siegelin. Rapsanbau sei ganz klar als Beitrag zum
Klimaschutz anerkannt.
Die Mitgliederversammlung der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps Oberfranken fand diesmal in den Räumen der BayWa am Hafen in Bamberg statt. 56000 Quadratmeter hat der Konzern dort gepachtet. In Bamberg erfasst die BayWa nach den Worten von Regionalagrarleiter Alexander Weiß aus Münchberg rund 65000 Tonnen Getreide pro Jahr, 80 Prozent davon gehen per Schiff an die Weltmärkte.
Laut Günter Schuster, dem Geschäftsführer der Sparten Agrar und Technik in Franken kommen 60 Prozent des Konzernumsatzes nach wie vor aus dem Agrarbereich. In Franken beschäftigt die BayWa an 72 Standorten, davon 35 zur Getreideerfassung, rund 1100 Mitarbeiter, der Jahresumsatz liegt bei rund 500 Millionen Euro
Bilder:
1. Die leuchtend geleben Rapsfelder, wie hier in der
Nähe von Thurnau sind derzeit kaum zu übersehen.
2. Alexander Weiß, der Regionalleiter der Sparte
Agrar, erläuterte den Mitgliedern der
Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps in
Oberfranken die Abläufe von der Anlieferung bis zur
Verladung am BayWa-Standort Bamberg.
Landwirtschaft hat Zukunft (22):
Pensionspferdehaltung: Wichtiger, aber oft vernachlässigter Wirtschaftszweig / Ralf Michel bewirtschaftet in Neufang einen Reitstall mit 60 Pferden
 Neufang.
„Man muss die Arbeit gerne machen“, sagt Ralf Michel
aus Neufang. Der 52-Jährige ist Pferdewirt mit
Meisterprüfung und Chef auf seinem Reitstall in
Neufang nahe des Kulmbacher Flugplatzes. Zur Arbeit
gehört zum Beispiel auch das Aufstehen, jeden Morgen
und Viertel nach fünf. 60 Pferde, sechs eigene und
54 Pensionspferde wollen schließlich versorgt
werden. Doch das ist noch lange nicht alles, was auf
dem schmucken Reitstall oberhalb von Kulmbach so
anfällt.
Neufang.
„Man muss die Arbeit gerne machen“, sagt Ralf Michel
aus Neufang. Der 52-Jährige ist Pferdewirt mit
Meisterprüfung und Chef auf seinem Reitstall in
Neufang nahe des Kulmbacher Flugplatzes. Zur Arbeit
gehört zum Beispiel auch das Aufstehen, jeden Morgen
und Viertel nach fünf. 60 Pferde, sechs eigene und
54 Pensionspferde wollen schließlich versorgt
werden. Doch das ist noch lange nicht alles, was auf
dem schmucken Reitstall oberhalb von Kulmbach so
anfällt.
Seit weit über 30 Jahren werden auf dem landwirtschaftlichen Betrieb Pferde gehalten. Ralf Michel ist hier aufgewachsen. Vater Fritz, der mit seinen 78 Jahren noch immer tatkräftig mit anpackt, und die mittlerweile verstorbene Mutter Margitta haben den Betrieb zuletzt im Nebenerwerb geführt. 1998 übernahm Ralf den Betrieb. Die Milchviehhaltung und auch die Schweine hatte man zu diesem Zeitpunkt längst aufgegeben.
Ralf lernte nach seiner landwirtschaftlichen Ausbildung den Beruf des Pferdewirts, im renommierten Staatsgut Schwaiganger, einem Bildungszentrum für Pferdehaltung am Fuß der Alpen nahe Garmisch-Partenkirchen. „Im Hinterkopf hatte ich es wohl schon, den Betrieb hier in Neufang irgendwann zu übernehmen“, sagt er. Bevor es soweit war, absolvierte er aber noch eine Art Praxisjahr auf einem Pferdebetrieb im fernen Schottland.
Zunächst arbeitete er noch als Betriebshelfer für den Maschinenring, ehe sich Ralf daran machte, den elterlichen Betrieb auszubauen. Und so entstanden nach und nach eine Reithalle, 20 mal 40 Meter groß, eine Longierhalle, 15 mal 15 Meter, und ein großer Reitplatz, 22 mal 50 Meter. Das alles sind Dimensionen, mit denen man professionell arbeiten kann, zumal er schon zuvor auch noch den aufgelassenen Laufstall des Nachbarn pachtete und dort Pferdeboxen einrichtete.
60 Tiere sind also mittlerweile zu versorgen, Kaltblüter, Haflinger sind darunter, relativ viele Westernpferde, insbesondere Quarter Horses und natürlich die Standardrasse Bayerisches Warmblut. Zwei Mitarbeiterinnen beschäftigt er, darunter eine gelernte Pferdewirtin, und der Vater mischt auch noch kräftig mit. Von den sechs eigenen Pferden sind zwei Zuchtstuten, der Nachwuchs wird ausgebildet und dann nach vier bis fünf Jahren verkauft.
„Die Pensionspferdehaltung ist durchaus ein wichtiger Wirtschaftszweig“, sagt Ralf Michel und zählt die vielen Reitställe auf, die es im Kulmbacher Land gibt. Eigentümer der Pferde sind dabei nicht, wie man sich das klischeehaft vorstellt die „Superreichen“, sondern ein ganz normaler Querschnitt der Bevölkerung. „Für viele ist das Pferd eben ein Hobby“, so Michel. Kein Sportgerät, wie vielleicht mancher denken könnte. Jeder zweite Pferdebesitzer kommt täglich, alle anderen mindestens jeden zweiten Tag.
Weil Pferde jede Menge Heu benötigen, bewirtschaftet Ralf Michel 60 Hektar Grünland, teilweise gehört es ihm, teilweise hat er es dazu gepachtet. Beim Mähen und Pressen kommen auch Kräfte des Maschinenrings zum Einsatz, um die Arbeitsspitzen abzudecken. Hafer muss er komplett zukaufen, denn Ackerland bewirtschaftet er nicht. In schlechten Jahren reichen selbst die beiden Schnitte der 60 Hektar nicht aus, so dass er auch das Heu teuer einkaufen muss.
Natürlich gibt es auch Probleme. Zum Beispiel zahlt die Berufsgenossenschaft etwa bei Unfall oder Krankheit keinen Betriebshelfer mehr. Begründung, Pensionspferde sind ja nicht im Eigentum des Reitstallinhabers. Ralf Michel kann das nicht verstehen und würde sich eine Gleichbehandlung mit „normalen“ landwirtschaftlichen Betrieben wünschen. Kaum ein Problem war dagegen die Corona-Pandemie. Man habe sich halt an die üblichen Hygiene-Regelungen gehalten, was auf dem weitläufigen Gelände und der großen Halle gar nicht so schwer gefallen sei.
Bild: Pferdewirtschaftsmeister Ralf Michel ist Eigentümer und Leiter des Reitstalles in Neufang oberhalb von Kulmbach
Landwirtschaft hat Zukunft (21):
Mehr Respekt für die Bauern / Leidenschaftlicher Landwirt: Norbert Erhardt bewirtschaftet in Motschenbach einen Milchviehbetrieb mit 130 Kühen
.jpg) Motschenbach.
„Trotzdem gibt es nichts schöneres, als
Landwirtschaft“. Norbert Erhardt aus Motschenbach
geht mit der Politik und vor allem mit dem
Lebensmitteleinzelhandel hart ins Gericht, wenn es
um die Bauern geht. Doch etwas anderes zu machen,
das wäre für ihn niemals in Frage gekommen. Er
blickt trotz alles „Baustellen“ zuversichtlich in
die Zukunft.
Motschenbach.
„Trotzdem gibt es nichts schöneres, als
Landwirtschaft“. Norbert Erhardt aus Motschenbach
geht mit der Politik und vor allem mit dem
Lebensmitteleinzelhandel hart ins Gericht, wenn es
um die Bauern geht. Doch etwas anderes zu machen,
das wäre für ihn niemals in Frage gekommen. Er
blickt trotz alles „Baustellen“ zuversichtlich in
die Zukunft.
1993 hatte er den Hof mitten in Motschenbach, einem Gemeindeteil von Mainleus, von seinem inzwischen verstorbenen Vater Hans übernommen. Zuvor hatte er nach seiner Landwirtschaftslehre gleich anschließend die Meisterprüfung absolviert. 1988 war das, mit 22 Jahren. Damals hatte der Betrieb 20 Kühe, heute sind es 130. Damals bewirtschaftete die Familie 16 Hektar, heute 150.
Klar, dass dies mitten in der Ortschaft, direkt neben der katholischen Pfarrkirche St. Maternus nicht mehr möglich war, und so siedelte der Betrieb an den Ortsrand aus. Zug um Zug wurde dort gebaut. „Im Schnitt haben wir alle fünf Jahre erweitert“, erinnert sich der heute 57-Jährige. Größter Brocken war der geräumige Laufstall, der 2005 fertig gestellt werden konnte.
.jpg) Auf
den 160 Hektar Fläche, alle im Gemeindegebiet von
Mainleus, von denen 60 Eigenland sind, baut Norbert
Erhardt Weizen, Wintergerste, Mais, Raps und Luzerne
an. Das meiste davon zum Eigenbedarf, also als
Futter für die Milchkühe, Weizen und Raps wird
klassisch über den Landhandel vermarktet. Die Milch
geht nach Coburg an die Milchwerke Oberfranken West
und wird im Wesentlichen zu leckeren
Käsespezialitäten verarbeitet.
Auf
den 160 Hektar Fläche, alle im Gemeindegebiet von
Mainleus, von denen 60 Eigenland sind, baut Norbert
Erhardt Weizen, Wintergerste, Mais, Raps und Luzerne
an. Das meiste davon zum Eigenbedarf, also als
Futter für die Milchkühe, Weizen und Raps wird
klassisch über den Landhandel vermarktet. Die Milch
geht nach Coburg an die Milchwerke Oberfranken West
und wird im Wesentlichen zu leckeren
Käsespezialitäten verarbeitet.
Neben seiner Frau Margit helfen auch die Töchter Katrin, Annika und Laura tatkräftig mit. Während Margit hauptsächlich für das melken zuständig ist, übernimmt Katrin die Büroarbeiten. Und dann gibt es mit Lars Pühlhorn aus Zaubach noch einen Mitarbeiter, der erst im zurückliegenden Sommer seine Lehre abgeschlossen hatte. Auch das ein Zeichen, dass Norbert Erhardt an die Zukunft glaubt: während der zurückliegenden Jahre habe er regelmäßig junge Leute ausgebildet, was längst nicht mehr selbstverständlich ist.
Schon 2018 und 2019 seien für ihn und viele Berufskollegen extrem harte Jahre gewesen. Aufgrund der damaligen Trockenheit habe er Futter in großen Mengen zukaufen müssen. Aktuell explodieren die Preise nicht nur für Energie, sondern auch für Düngemittel. „Effektiv arbeiten mussten wir schon immer, wo sollen wir noch sparen“, sagt Norbert Erhardt. Ganz besonders im Focus seiner Kritik steht der Lebensmitteleinzelhandel: Daneben gehe es nur um Profit. Beim Bauern komme nichts an. „Es ist einfach respektlos gegen die Landwirtschaft, wie die ihr Geld eintreiben“, schimpft er. Die Bauern erzeugten super Nahrungsmittel zu günstigsten Preisen, der Verbraucher könne sich alles leisten und am Ende punkten Aldi, Lidl und Co mit simplen Werbegags. Norbert Erhardt geht sogar so weit zu behaupten, dass leere Regale gewollt sind, um die Preise nach oben treiben zu können. Und trotzdem: auf die Landwirtschaft lässt er nicht kommen.
.jpg) „Wenn
die Landwirtschaft ausstirbt, dass stirbt auch das
Dorf aus“, ist sich Norbert Erhardt sicher. Der
Mainleuser Gemeindeteil Motschenbach ist in dieser
Hinsicht noch ganz gut aufgestellt. Zwei
Milchviehbetriebe gibt es noch und zwei
Ackerbaubetriebe, die im Nebenerwerb geführt werden.
Freilich vor gerade mal 25 Jahren waren es noch neun
Milchviehbetriebe.
„Wenn
die Landwirtschaft ausstirbt, dass stirbt auch das
Dorf aus“, ist sich Norbert Erhardt sicher. Der
Mainleuser Gemeindeteil Motschenbach ist in dieser
Hinsicht noch ganz gut aufgestellt. Zwei
Milchviehbetriebe gibt es noch und zwei
Ackerbaubetriebe, die im Nebenerwerb geführt werden.
Freilich vor gerade mal 25 Jahren waren es noch neun
Milchviehbetriebe.
Ganz so, als hätte er mit seinem Hof nicht schon genug zu tun, engagiert sich Norbert Erhardt seit 2012 ehrenamtlich für die CSU im Gemeinderat, ist seit über 25 Jahren Ortsobmann des Bauernverbandes, wirkt in der Kirchenverwaltung mit und geht auch gerne mal als Jäger auf die Pirsch. Zusammen mit seiner Frau lädt er auch immer wieder Schulklassen und Kindergärten auf den Hof ein, um jungen Leuten Landwirtschaft nahe zu bringen. „Die Öffentlichkeitarbeit hat bei uns schon immer einen hohen Stellenwert“, so der leidenschaftliche Landwirt.
Bilder:
1. Gute
Tradition: viele Abzeichen des Milcherzeugerrings
für herausragende Leistungen hat Norbert
Erhardt an der Stalltüre angebracht.
2.
Landwirt
Norbert Erhardt und Mitarbeiter Lars Pühlhorn im
großzügigen Laufstall des Betriebes.
3. Leidenschaftlicher
Landwirt: Für Norbert Erhardt aus Motschenbach ist
sein Beruf eine echte Berufung.
„Waldumbau tut Not“ / WBV Bamberg vor herausfordernden forstlichen Zeiten
.jpg) Scheßlitz.
Die extremen Schadholzanfälle im Vereinsgebiet haben
die Vermarktungszahlen der Waldbesitzervereinigung
Bamberg gehörig durcheinander gewirbelt. Mit weit
über 73000 Festmetern Holz habe die WBV 2021 fast
die doppelte Menge von 2020 und beinahe die
vierfache Menge eines „normalen“ Jahres vermarktet,
sagte der neue Geschäftsführer Konstantin Meyer bei
der Jahreshauptversammlung in Scheßlitz. Mit der
Steigerung einhergegangen sei ein Anwachsen des
Arbeitspensums weit über die Belastungsgrenze der
mittlerweile sieben angestellten Mitarbeiter.
Scheßlitz.
Die extremen Schadholzanfälle im Vereinsgebiet haben
die Vermarktungszahlen der Waldbesitzervereinigung
Bamberg gehörig durcheinander gewirbelt. Mit weit
über 73000 Festmetern Holz habe die WBV 2021 fast
die doppelte Menge von 2020 und beinahe die
vierfache Menge eines „normalen“ Jahres vermarktet,
sagte der neue Geschäftsführer Konstantin Meyer bei
der Jahreshauptversammlung in Scheßlitz. Mit der
Steigerung einhergegangen sei ein Anwachsen des
Arbeitspensums weit über die Belastungsgrenze der
mittlerweile sieben angestellten Mitarbeiter.
Oberfranken habe mit die höchsten Schadholzmengen in ganz Bayern gehabt, sagte Meyer. „Wir sind eigentlich mehr oder weniger dem Käfer hinterher gejagt.“ Konkret hätten die Zahlen, die von der WBV im Auftrag ihrer Mitglieder vermarktet wurden, 2021 bei 73377, 2020 bei 41747 und 2019 bei 33631 Festmetern Holz gelegen. Den weitaus größten Teil unter den Holzarten machten dabei naturgemäß die Fichten aus.
Die Jahreshauptversammlung in der Turnhalle des TSV Scheßlitz war die erste seit drei Jahren, die wieder in Präsenz stattgefunden hatte. Dementsprechend groß war der Bedarf, sich persönlich auszutauschen und aktuelle Probleme zu diskutieren. Vorsitzende Angelika Morgenroth schwor die Mitglieder vor dem Hintergrund des „European Green Deal“ auf eine „herausfordernde forstliche Zeitenwende“ ein. Ohne ein Gegensteuern würden die Waldbesitzer erschreckende Folgen für die Ressource Holz und den Waldumbau erleben. „Da sind die Politiker gefordert, um die geplanten ideologischen Auswirkungen abzuwenden“, sagte Morgenroth.
Doch auch vor Ort könne man von einer klimabedingten forstlichen Katastrophe sprechen. Nach den Zahlen der Vorsitzenden seien im Amtsbereich Bamberg in den zurückliegenden drei Jahren rund 1000 Hektar Wald verloren gegangen. Schuld daran sei die extreme Ausbreitung der Kalamitäten, schon im Jahr 2019 mit extremer Trockenheit und Wärme. „Viele Fichtenflächen sind in noch nie dagewesener Geschwindigkeit abgestorben“. Als Folge davon sei der Preis für Nadelhölzer bundesweit in Bodenlose gefallen.
„Einen Wald zu besitzen ist kein reines Vergnügen mehr“, hatte bereits zuvor der stellvertretende Bereichsleiter Forsten Gregor Schießl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten festgestellt. Diskussionen fänden immer mehr unter einer „ideologischen Käseglocke“ statt, an deren Ende die Aussage steht: „Baum ab, nein danke“. Doch wer von den Kritikern kümmere sich wirklich um die Sorge und Nöte der Waldbesitzer? Dabei reiche schon der Borkenkäfer aus, um für Frustrationen zu sorgen. Schießl kam auf rund 200000 Kubikmeter reines Käferholz allein im Amtsbereich. „Waldumbau tut Not“ sagte der Forstamtsleiter. „Die Mischung macht´s, wer streut, rutscht nicht.“
Zur aktuellen Situation sagte Geschäftsführer Meyer, dass sich die Preise im ersten Quartal 2022 wieder auf höherem Niveau bewegten. Er rief die Waldbesitzer zu verstärkten Kontrollen der Fichtenbestände in den kommenden Wochen auf. Vor allem die zahlreichen Einzelwürfe vorgeschädigter Fichten nach den Stürmen im Februar machten verstärkten Buchdrucker- und Kupferstecherbefall wahrscheinlich.
Bild: „Arbeitspensum weit über die Belastungsgrenze“: Konstantin Meyer ist der neue Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Bamberg.
Landwirtschaft hat Zukunft (20):
Krisen und Krieg: Wertschätzung für die Landwirtschaft ist wieder gewachsen / Familie Müller bewirtschaftet bei Himmelkron einen klassischen Milchviehbetrieb
.jpg) Schwärzhof.
Landwirtschaft, ganz normal: das ist es, was
Wolfgang Müller und seine Familie in dem zu
Himmelkron gehörenden Weiler Schwärzhof betreiben.
Die Lage ist allerdings außergewöhnlich: von der
unterhalb der Schiefen Ebene gelegenen Ortschaft hat
man einen gigantischen Blick über den Talkessel auf
Himmelkron. Fast könnte man meinen, in der Toskana
gelandet zu sein. „Nur das Meer fehlt“, sagt
Wolfgang Müller augenzwinkernd.
Schwärzhof.
Landwirtschaft, ganz normal: das ist es, was
Wolfgang Müller und seine Familie in dem zu
Himmelkron gehörenden Weiler Schwärzhof betreiben.
Die Lage ist allerdings außergewöhnlich: von der
unterhalb der Schiefen Ebene gelegenen Ortschaft hat
man einen gigantischen Blick über den Talkessel auf
Himmelkron. Fast könnte man meinen, in der Toskana
gelandet zu sein. „Nur das Meer fehlt“, sagt
Wolfgang Müller augenzwinkernd.
Im Grund ist es ein ganz normaler Milchviehbetrieb mit 85 Kühen plus Nachzucht. Vermarktet wird die Milch nicht, wie man meinen könnte an die Käserei Bayreuth, sondern an die Milchwerke Oberfranken West nach Coburg. Als Bayreuth 2010 seine Eigenständigkeit aufgab und Bayernland-Standort wurde, habe man sich Coburg angeschlossen, berichtet Wolfgang Müller. Dabei sei man auch geblieben: „Alles läuft gut, wir sind sehr zufrieden.“
2005 hatte Wolfgang Müller (47) den Betrieb vom Vater Hans übernommen, der trotz seiner mittlerweile 82 Jahre noch immer schwer aktiv ist und mithilft, wo er nur kann. Auf dem Hof ist die ganze Familie im Einsatz, vor allem der älteste Sohn Markus (24), aber wenn irgendwie zeitlich möglich auch die beiden anderen Söhne, von denen einer gerade seinen Lebensmitteltechniker macht und der jüngst noch zur Schule geht. „Alle helfen mit und alle können mit Maschinen umgehen“, so Wolfgang Müller. Ehefrau Kathrin ist sogar als Kreisbäuerin von Himmelkron aktiv. Lediglich zur Abdeckung von Arbeitsspitzen, beim Dreschen und beim Mais häckseln, holt man sich einen Lohnunternehmer zur Hilfe.
2009 wurde der neue Laufstall als Außenklimastall mit Melkroboter errichtet. An Tierwohl mangelt es nicht, die Kühe haben jede Menge Licht und Luft. Insgesamt bewirtschaftet Wolfgang Müller 75 Hektar Land, rund 40 Hektar davon Grünland zum Eigenbedarf, also Futter für die Kühe. Auf den restlichen Flächen wird Silomais, Weizen und Gerste angebaut, vermarktet wird klassisch über den Landhandel. Sämtliche Flächen befinden sich in den Gemeindegebieten von Himmelkron und Trebgast. Bei den derzeitigen Energiepreisen sei es extrem wichtig, dass die Anfahrtswege nicht zu lang sind. Auch sollte man sich jeden einzelnen Bearbeitungsschritt genau überlegen.
.jpg) Wolfgang
Müller hatte nach einer ganz normalen
Landwirtschaftslehre die damalige Technikerschule
für Agrarwirtschaft in Bayreuth besucht und 1985
abgeschlossen. Sohn Markus absolvierte nach der
Realschule ebenfalls eine Lehre und besuchte nach
einem Praxisjahr die Technikerschule im
mittelfränkischen Triesdorf. „Eine Superzeit“,
schwärmt er. Er würde jederzeit wieder nach
Triesdorf gehen und könne die Schule nur
uneingeschränkt weiterempfehlen.
Wolfgang
Müller hatte nach einer ganz normalen
Landwirtschaftslehre die damalige Technikerschule
für Agrarwirtschaft in Bayreuth besucht und 1985
abgeschlossen. Sohn Markus absolvierte nach der
Realschule ebenfalls eine Lehre und besuchte nach
einem Praxisjahr die Technikerschule im
mittelfränkischen Triesdorf. „Eine Superzeit“,
schwärmt er. Er würde jederzeit wieder nach
Triesdorf gehen und könne die Schule nur
uneingeschränkt weiterempfehlen.
Ein wenig sieht Sohn Markus die Wertschätzung der Landwirtschaft wieder im Aufwind. Schuld daran seien die Krisen und der Krieg. Dadurch sei Nahrungsmittelsicherheit wieder ein Thema geworden. „Es hat doch lange keinen mehr interessiert, wo die Lebensmittel herkommen“, so Markus Müller. „Volle Regale waren Standard.“
Schwer aktiv sind Vater und Sohn auch in ihrer Freizeit. Seit 18 Jahren ist Wolfgang Mitglied des Kirchenvorstandes, seit den letzten Wahlen gehört der CSU/FWG-Liste des Gemeinderates an. Und dann hat er noch ein ganz besonderes Hobby: Für die Theatergruppe des Gartenbauvereins Lanzendorf steht er nach der Corona-Pause hoffentlich bald wieder auf den Brettern, die die Welt bedeuten.
Sohn Markus, der drei Tage pro Woche im Büro des Maschinenrings Münchberg unter anderem für Abrechnungen und Düngeberatung arbeitet, ist dritter Vorstand der Landjugend Bad Berneck – Bindlach mit insgesamt rund 60 aktiven Mitgliedern, die nach Corona hoffentlich alle auch wiederkommen. Markus Müller ist zuversichtlich: „Wir haben das Beste daraus gemacht und die Zeit genutzt“, sagt er. Sogar eine Online-Weinprobe habe man arrangiert. Den persönlichen Kontakt, auch das ist sich Markus sicher, könne aber auch das beste Zoom-Meeting nicht ersetzen.
Bilder:
1. Vater
Wolfgang und Sohn Markus Müller im Laufstall auf dem
Schwärzhof bei Hmmelkron.
2. Geschützt
vor Wind und Wetter und trotzdem im Freien hat man
für die Kälberiglus einen guten Platz gefunden.
Weidehaltung im Visier / Oberfränkische Biobauern machen gegen EU-Öko-Verordnung mobil
 Melkendorf.
Kommt die Verpflichtung zur Weidehaltung, befürchten
viele Biomilchlieferanten aus Oberfranken, dass sie
mit allen negativen Konsequenzen wieder auf
konventionelle Erzeugung umstellen müssen. Einer der
betroffenen ist der Landwirt Hermann Grampp aus
Melkendorf bei Kulmbach. Er hat jetzt mehrere
Berufskollegen mobilisiert, um gegenüber Politik und
Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass viele
fränkische Milchviehhalter vor einer unlösbaren
Aufgabe stehen.
Melkendorf.
Kommt die Verpflichtung zur Weidehaltung, befürchten
viele Biomilchlieferanten aus Oberfranken, dass sie
mit allen negativen Konsequenzen wieder auf
konventionelle Erzeugung umstellen müssen. Einer der
betroffenen ist der Landwirt Hermann Grampp aus
Melkendorf bei Kulmbach. Er hat jetzt mehrere
Berufskollegen mobilisiert, um gegenüber Politik und
Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass viele
fränkische Milchviehhalter vor einer unlösbaren
Aufgabe stehen.
Die Europäische Union drängt die deutschen Bauern dazu, die EU-Öko-Verordnung in die Tat umzusetzen. Zentraler Bestandteil der Verordnung ist die Weideverpflichtung für Öko-Milchvieh. „Das ist für uns nicht machbar“, sagen Hermann Grampp und seine Berufskollegen. Ursache dafür sind die kleinteilige Struktur der bewirtschafteten Flächen und die massiven Streulagen aufgrund der typisch fränkischen Realteilungsgebiete.
Die geforderten Weiden müssten in Hofnähe, neben den Stallungen sein, was, anders als zum Beispiel in Norddeutschland oder in Oberbayern, schon aufgrund der örtlichen Gegebenheiten unmöglich ist. Dazu kommt, dass Bauern wie Hermann Grampp in den zurückliegenden Jahren teilweise Millionenbeträge investiert haben, um sämtliche Biostandards zu erfüllen. „Und jetzt soll alles umsonst gewesen sein?“, fragen sich er und seine Berufskollegen.
Markus Küfner aus Bindlach im Landkreis Bayreuth beispielsweise. Zusammen mit einem Partner bewirtschaftet er einen Biobetrieb mit 170 Kühen. „Weidehaltung ist bei uns unmöglich“, so Küfner. Auf der einen Seite grenzt der Hof direkt an die Bundesautobahn A9, auf der anderen Seite an die Eisenbahnlinie Bayreuth – Neuenmarkt. Wo soll er die geforderten Weiden hernehme? Harald Reblitz aus Coburg geht es ähnlich. Er ist Vorstandsvorsitzender bei den Milchwerken Oberfranken-West in Meeder bei Coburg. 15 bis 20 Prozent der angelieferten Milch sei Biomilch. Reblitz befürchtet, dass die Hälfte davon wegfallen würde, wenn die Weideverpflichtung Wirklichkeit wird. Wie das zur politisch geforderten Steigerung des Ökoanteils passen soll, erschließt sich keinem der Beteiligten.
Auch die Verpächter spielten nicht, wenn es darum geht, wertvolles Ackerland in Grünland umzuwandeln, so Harald Küfner aus Untergräfenthal. Er werde die Milchviehhaltung notfalls ganz aufgeben, denn ein zurück auf konventionelle Erzeugung komme für ihn nicht in Frage. Auch Gerd Böhner vom Lärchenhof bei Bindlach würde seine derzeit 180 Milchkühe deutlich reduzieren müssen, wenn er zur Weidehaltung gezwungen würde. Böhner spricht von einem echten K.o.-Kriterium. Dabei hatte er so viel Herzblut in die Milchviehhaltung gesteckt und immer wieder investiert.
„Wir stehen vor dem Nichts“, brachte Holger Hofmann aus Burghaig seine Situation auf den Punkt. Er hatte erst 2015 einen neuen Laufstall gebaut und „aus Überzeugung“ auf bio umgestellt. Direkt an seinen Hof angrenzend hat er überhaupt keine Flächen. Die nächsten seien rund zwei Kilometer entfernt. Ähnlich ergeht es Herbert Kunick aus Sonnefeld. Er müsste vier Kreis- und Staatsstraßen queren, um sein Milchvieh auf eine Weide und zurück zum Melkroboter zu bringen. Er brachte allerdings einen Kompromiss ins Spiel: so könnte man unter Umständen die Trockensteher, oder das Jungvieh auf die Weiden bringen, um die Öko-Verordnung zu erfüllen.
„Europa lässt sich eben nicht überall eins zu eins umsetzen“, sagt Martin Schöffel, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Arbeitskreises Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Er setzt bei der Umsetzung der EU-Öko-Verordnung auf mögliche Ausnahmen sowie auf lange Übergangsfristen. Schließlich komme es auch darauf an, wie der Begriff Weide definiert werden soll, so Harald Köppel, Geschäftsführer des Bauernverbandes. Köppel geht aber auch davon aus, dass der Handel die Daumenschrauben weiter anziehen wird. Klaus Schiffer-Weigand vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, plädierte ebenfalls dafür, nach Kompromissen zu suchen: „Eine Totalverweigerung in Sachen Weide werden wir nicht durchbringen.“
Bild: Zahlreiche betroffene Berufskollegen hatte Hermann Grampp (3. Von links) aus Melkendorf auf seinem Hof versammelt, um Politik und Öffentlichkeit auf die negativen Auswirkungen der geforderten Weidehaltung aufmerksam zu machen.
Landwirtschaft hat Zukunft (19):
Fleckvieh, Angus- und Wagyu-Rinder aus dem Internet/ Hanf, Quinoa, Kühe: Martin Baumgärtner setzt auf Qualität, Nachhaltigkeit und Tierwohl
 Unterzaubach.
Ein autarker Bauernhof, das wäre der Idealfall, den
Martin Baumgärtner in Unterzaubach anstrebt. Wenn
manche auch darüber lächeln mögen, auf dem Weg
dorthin ist er, zumindest theoretisch, schon
ziemlich weit. Strom wird mit einer
100-kw-Freiflächenanlage produziert und in das
öffentliche Netz eingespeist. Eine weitere
Photovoltaikanlage auf dem Stalldach ist geplant.
Nun müssten nur noch die Speichertechnologien so
weit sein. Für die Wasserversorgung gibt es einen
eigenen Brunnen und für die Wärme sorgen die
Holzhackschnitzel aus dem eigenen Wald.
Unterzaubach.
Ein autarker Bauernhof, das wäre der Idealfall, den
Martin Baumgärtner in Unterzaubach anstrebt. Wenn
manche auch darüber lächeln mögen, auf dem Weg
dorthin ist er, zumindest theoretisch, schon
ziemlich weit. Strom wird mit einer
100-kw-Freiflächenanlage produziert und in das
öffentliche Netz eingespeist. Eine weitere
Photovoltaikanlage auf dem Stalldach ist geplant.
Nun müssten nur noch die Speichertechnologien so
weit sein. Für die Wasserversorgung gibt es einen
eigenen Brunnen und für die Wärme sorgen die
Holzhackschnitzel aus dem eigenen Wald.
Wichtig ist für den 38-jährigen Landwirt auch die Kreislaufwirtschaft. Das Futter für die Tiere wächst auf den eigenen Feldern, die wiederum mit den Hinterlassenschaften der Vierbeiner gedüngt werden. Die Pflanzen produzieren Sauerstoff: „Somit haben wir soweit nur irgendwie möglich eine klimaneutrale Produktion“, sagt Baumgärtner, der es als früherer Landesvorsitzender der Bayerischen Jungbauernschaft nicht nur innerhalb des Berufsstandes auch überregional zu Bekanntheit gebracht hat.
2016 hatte er den Hof am Ortsrand von Unterzaubach von den Eltern übernommen. Damals mit 30 Kühen mit Nachzucht in Anbindehaltung. Das hatte keine Zukunft, so erkannte es Martin Baumgärtner schnell. Also stand er vor der Entscheidung, den Betrieb um- und auszubauen und im Vollerwerb weiterzuführen, oder eben nicht.
Nun war es nicht so, dass der Diplom-Agrarwirt keine anderen Optionen gehabt hätte. Martin Baumgartner studierte in Triesdorf Landwirtschaft und war mehrere Jahre lang beim Bayerischen Bauernverband tätig. Anschließend war er Lehrer an den Landwirtschaftsschulen in Bayreuth und Münchberg. Öffentlicher Dienst oder Selbstständigkeit, vor dieser Frage habe er damals gestanden und entschied sich für letzteres. Eigentlich hätte er sogar noch eine weitere Option gehabt, er kandidierte bereits als Kandidat der Freien Wähler für den Landtag und ist heute Stadtrat und 3. Bürgermeister von Stadtsteinach.
Heute ist die Fleischvermarktung das Hauptstandbein seines Betriebs, der 2017 auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt wurde. Martin Baumgartner betreibt im 2019 neugebauten Stall Mutterkuhhaltung mit 70 Tieren der Rassen Fleckvieh und Angus. Auch zwei Wagyu-Edelrinder sind dabei. Dazu kommen etwa 30 Jungtiere. Auf das vielzitierte Tierwohl legte der Landwirt von Anfang an größten Wert. „Die Kühe haben ein Maximum an Licht, Luft und Freiraum und können ihr Sozialverhalten so natürlich wie irgendwie möglich ausleben“.
Eine weitere Besonderheit auf dem Baumgärtner-Hof ist die Saisonabkalbung. Der Natur folgend, kommt der Bulle im Juli, August zur Herde. Die Kälber kommen dann so ab Mai auf die Welt. Vorteil ist, dass alle gleichzeitig das Licht der Welt erblicken, und zwar in der angehenden warmen Jahreszeit, meist sogar auf der Weide. . Man müsse normalerweise keine Sorge haben, dass ein Kalb nicht durchkommt, was in einem strengen Winter schon mal passieren kann. Danach bleiben sie dann solange wie nur irgendwie möglich bei der Mutter, meist bis in die Wintermonate hinein. Dann benötigt die Mutterkuh eine Erholungsphase. 28 Kälber plus drei Nachzügler haben so im zurückliegenden Jahr das Licht der Welt erblickt. Geschlachtet werden sie in der Regel erst nach drei Jahren.
Martin Baumgärtner legt bei allem, was er macht, höchsten Wert auf Qualität. So haben die bei einem Metzger in Himmelkron geschlachteten, zerlegten und vakuum verpackten Fleischpakete eben auch ihren Preis. Das Fünf-Kilo-Paket kostet 85 Euro und enthält unter anderem 500 Gramm Steaks, Braten, Rouladen und Beinscheiben. Vermarktet wird direkt, das heißt bei Martin Baumgartner übers Internet. Er hat eine eigene Website mit Online-Hofladen (hofgut-baumgaertner.friedhold.de) und ist mit seiner eigens geschaffenen Marke Hofgut Baumgärtner auf Facebook und Instagram präsent. Die Pakete liefert er im Umkreis selbst aus, auch ein Versand ist möglich.
30 Prozent der bewirtschafteten Fläche ist Grünland. Auf weiteren 60 Hektar Ackerland baut Martin Baumgartner Kleegras, Luzerne, Dinkel, Roggen, Hafer und Sommergerste an. Die Vermarktung erfolgt, wenn nicht zum Eigenbedarf als Futter benötigt, klassisch über den Landhandel. Doch der 38-Jährige experimentiert auch gerne und so reserviert er regelmäßig einige wenige Hektar für Sonderkulturen, wie zum Beispiel Quinoa oder Hanf.
Die Kulturpflanze Quinoa ist für Müsli-Mischungen interessant und aus Hanf wird Öl hergestellt. Wer jetzt glaubt, er könne sich seine Joints künftig auf den Feldern in Unterzaubach pflücken hat sich getäuscht. Der Tetrahydrocannabinol-Gehalt (THC), der bei Hanf für die berauschende Wirkung sorgt, ist bei dem angebauten Hanf so verschwindend gering, dass er zum Rauchen nicht taugt. Weitere Sonderfrüchte, wie etwa Lupinen oder Buchweizen sind in Planung, wobei verlässliche Erträge aufgrund der extremen Frostempfindlichkeit aller dieser Arten in unseren Breiten extrem schwierig sind. Man könne sie erst nach den Eisheiligen aussäen und im Oktober ernten
Einziger Wermutstropfen bei allem Bemühungen um Nachhaltigkeit: Diesel wird wohl auch weiterhin benötigt, bei einem Biobetrieb sogar noch im stärkeren Umfang als bei einem konventionellen Betrieb. Die Bodenbearbeitung erfolgt intensiver mit Striegel, Hacke und Co. Gepflügt werden muss auch. Das tut bei den derzeitigen Dieselpreisen so richtig weh, gehöre aber eben auch zur Wahrheit.
Bild: Martin Baumgärtner kümmert sich um die Kälber in seinem Stall am Ortsrand von Unterzaubach.
Landwirtschaft hat Zukunft (18):
Landwirtschaft als Grundlage des Lebens / Ackerbau, Biogas und Lohnarbeiten: Agrarbetrieb Hahn in Dörnhof bei Kupferberg
.jpg) Dörnhof.
Immer schon innovativ und der Zeit etwas voraus. Das
könnte gleichsam ein Motto sein, für den
Agrarbetrieb der Familie Hahn in Dörnhof bei
Kupferberg. Bis 1992 Milchviehhaltung, bis 2011
Schweinemast wurde aus dem Hof bis heute ein breit
aufgestelltes Lohnunternehmen mit Wirkungskreis vom
Kulmbacher und Hofer Land aus bis weit nach Sachsen,
Thüringen und Sachsen-Anhalt hinein. Auf den gut 300
Hektar Fläche wird allerhand Getreide angebaut und
klassisch vermarktet. Die Energiepflanze Silphie und
das Grüngut gehen in eine Biogasanlage, die
mittlerweile auf 420 kW aufgerüstet wurde.
Dörnhof.
Immer schon innovativ und der Zeit etwas voraus. Das
könnte gleichsam ein Motto sein, für den
Agrarbetrieb der Familie Hahn in Dörnhof bei
Kupferberg. Bis 1992 Milchviehhaltung, bis 2011
Schweinemast wurde aus dem Hof bis heute ein breit
aufgestelltes Lohnunternehmen mit Wirkungskreis vom
Kulmbacher und Hofer Land aus bis weit nach Sachsen,
Thüringen und Sachsen-Anhalt hinein. Auf den gut 300
Hektar Fläche wird allerhand Getreide angebaut und
klassisch vermarktet. Die Energiepflanze Silphie und
das Grüngut gehen in eine Biogasanlage, die
mittlerweile auf 420 kW aufgerüstet wurde.
„Weitergehen wird es auf jeden Fall, aber es wird anspruchsvoller“, sagt Junior Dominik (29), der als Landwirtschaftsmeister die Zügel schon fest in der Hand hat und genau weiß, was er will. „Immer nur alles billiger und immer mehr, das kann es doch nicht sein.“ Vater Gerhard (57) hat schon allerhand turbulente Zeiten in der Landwirtschaft erlebt und kann es nicht verstehen, dass die Gesellschaft die Bauern heutzutage als Sündenbock für alles hernimmt. „Ich bin mir sicher, dass ein Teil unseres Wohlstandes auf den Bauernstand aufgebaut ist“, sagt er. Für ihn ist Landwirtschaft die Grundlage allen Lebens. „Nahrungsmittel sind ein Grundbedürfnis des Menschen und trotzdem wird der Nahrungsmittelproduzent nur noch niedergemacht.“
.jpg) Im
Jahr 2000 hatte Gerhard den Betrieb von seinem
inzwischen verstorbenen Vater Robert übernommen. Die
Milchviehhaltung mit zuletzt 26 Kühen war damals
schon längst Geschichte. Stattdessen setzte man
damals noch auf Schweinemast mit 800 Mastplätzen im
umgebauten Rinderstall damals schon auf Halbspalten
mit Stroheinlage. Damit war Gerhard Hahn
beispielsweise auch einer der Gründungsväter der
Frankenfarm in Himmelkron.
Im
Jahr 2000 hatte Gerhard den Betrieb von seinem
inzwischen verstorbenen Vater Robert übernommen. Die
Milchviehhaltung mit zuletzt 26 Kühen war damals
schon längst Geschichte. Stattdessen setzte man
damals noch auf Schweinemast mit 800 Mastplätzen im
umgebauten Rinderstall damals schon auf Halbspalten
mit Stroheinlage. Damit war Gerhard Hahn
beispielsweise auch einer der Gründungsväter der
Frankenfarm in Himmelkron.
Erst 2011 hängte Gerhard auch das an den Nagel. „Wir hätten technisch einfach zu viel umbauen müssen.“ Er ist froh über diese Entscheidung, zumal die Schweinepreise heute ein nie dagewesenes Tief erreicht haben. Stattdessen konzentrierte sich der Landwirt auf das, was ihn schon immer fasziniert hat, auf die vielfältigsten Lohnarbeiten, also Dreschen, Ballen pressen, Mais häckseln, die gesamte Erntelogistik eben, aber auch das Ausbringen von Gülle und vieles mehr, und stets auch Waldarbeiten wie etwas Holz rücken.
„Das Lohngeschäft steht bei uns im Mittelpunkt“, sagt Gerhard Hahn. Und so ist auch das technische Aufgebot außergewöhnlich. Zwei große Häcksler stehen im ehemaligen Stallgebäude, zwei 350-PS-Schlepper, zwei 300-PS-Schlepper, ein Agro-Truck und noch das eine oder andere. Zwei Vollzeitkräfte beschäftigt die Familie, der eine Landwirt, der andere Landmaschinenmechatroniker. Dazu kommen je nach Lage mehrere geringfügig beschäftigte Aushilfen. Mit dem Lohnunternehmen von Jürgen Brendel in Presseck verbindet dem Agrarbetrieb Hahn eine langjährige und enge Zusammenarbeit.
.jpg) Bereits
auf das Jahr 2005 geht der Bau der Biogasanlage
zurück, ursprünglich auf 180 kW geplant, dann gleich
mit 240 kW gebaut und mittlerweile auf 420 kW
aufgerüstet. Der gewonnene Strom wird komplett in
das öffentliche Netz eingespeist. Bestückt wird die
Anlage mit dem zweiten Schnitt des Grünlandes und
der Energiepflanze Nachwachsende Silphie (Silphium
perfoliatum), die auf stattlichen 40 Hektar angebaut
und biologisch, ohne Pflanzenschutz, bewirtschaftet
wird.
Bereits
auf das Jahr 2005 geht der Bau der Biogasanlage
zurück, ursprünglich auf 180 kW geplant, dann gleich
mit 240 kW gebaut und mittlerweile auf 420 kW
aufgerüstet. Der gewonnene Strom wird komplett in
das öffentliche Netz eingespeist. Bestückt wird die
Anlage mit dem zweiten Schnitt des Grünlandes und
der Energiepflanze Nachwachsende Silphie (Silphium
perfoliatum), die auf stattlichen 40 Hektar angebaut
und biologisch, ohne Pflanzenschutz, bewirtschaftet
wird.
Auf den restlichen Flächen wächst Winterraps, Sommergerste, Mais, Dinkel, Weizen, Körnersenf. Das Getreide wird konventionell über den Landhandel vermarktet. Weil das alles noch nicht genug ist, betreibt Gerhard Hahn auch die Kompostieranlage in Untersteinach im Auftrag des Landkreises. Die Anlage selbst ist in seinem Besitz.
Bilder:
1. „Technisch sind wir schon gut ausgerüstet“,
sagten Gerhard und Dominik Hahn, hier in der
Maschinenhalle ihres Agrarbetriebs.
2. Dominik Hahn bestückt die Biogasanlage in Dörnhof
bei Kupferberg.
3. Vater und Sohn: Gerhard und Dominik Hahn haben
einen echten Vorzeigebetrieb aufgebaut.
Im Einsatz für Wettervorhersage und Klimaüberwachung / Deutscher Wetterdienst sucht ehrenamtlichen Wetterbeobachter für Niederschlagsstation im Raum Kulmbach
 Kulmbach.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) betreibt in ganz
Deutschland ein Netz von knapp 1800 nebenamtlichen
Wetter- und Niederschlagsstationen. Für dieses
flächendeckende Messnetz sucht die Bundesbehörde im
Raum Kulmbach wetterbegeisterte Bürgerinnen oder
Bürger, die als ehrenamtliche Beobachter des
nationalen Wetterdienstes zur Wetter- und
Klimaüberwachung in Deutschland beitragen möchten.
Kulmbach.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) betreibt in ganz
Deutschland ein Netz von knapp 1800 nebenamtlichen
Wetter- und Niederschlagsstationen. Für dieses
flächendeckende Messnetz sucht die Bundesbehörde im
Raum Kulmbach wetterbegeisterte Bürgerinnen oder
Bürger, die als ehrenamtliche Beobachter des
nationalen Wetterdienstes zur Wetter- und
Klimaüberwachung in Deutschland beitragen möchten.
Die jetzige Beobachterin, Abiturientin Larissa Grampp aus Melkendorf, muss zum 30. September aufhören, da sie im Oktober ein Studium „Ernährungs- und Versorgungsmanagement“ im mittelfränkischen Triesdorf aufnimmt. Vater Hermann Grampp ist mit seinem Milchviehbetrieb am Ortsrand von Melkendorf komplett ausgelastet. „Viel Arbeit ist es zwar nicht, aber es muss jeden Tag gemacht werden“, so Larissa und Hermann Grampp. Früher war die Station in Burghaig untergebracht.
Aktuell gibt es oberfrankenweit im Schnitt alle 15 Kilometer eine Station, so Frank Sievers von der zuständigen regionalen Messgruppe des Deutschen Wetterdienstes in München. Wettermelder zu finden sei nicht ganz einfach, da die Station möglichst frei stehen muss, damit die Messungen nicht beeinträchtigt werden. Landwirte seien geradezu prädestiniert dafür, da sie über entsprechende Flächen in geeigneten Lagen verfügen und die Daten ja ohnehin auch für sich benötigen. Im Übrigen handle es sich um ein Ehrenamt, bei dem lediglich der Aufwand entschädigt werde. Ein ehrenamtlicher Beobachter erhält derzeit eine jährliche Aufwandsentschädigung von 760 Euro im Jahr.
Jede ehrenamtliche konventionelle Niederschlagsstation wird mit einem Niederschlagsmesser ausgerüstet, erklärt Frank Sievers. Voraussetzungen für die Übernahme dieser verantwortungsvollen Tätigkeit seien neben dem geeigneten Grundstück ein internetfähiger Computer. Aufgabe der ehrenamtlichen Beobachter ist es, jeden Tag möglichst genau um 06.50 Uhr (Sommerzeit um 07.50 Uhr), die Niederschlagshöhe mit dem Hellmann-Niederschlagsmesser und im Winter die Schneedeckenhöhe zu messen.
Nach den Worten von Frank Sievers sollten alle vom ehrenamtlichen Beobachter erfassten Daten täglich, spätestens bis 08.15 Uhr (Sommerzeit bis 9.15 Uhr) über eine Web-Anwendung in den heimischen Computer eingegeben werden. „Das ist ein ganz einfaches Programm, das auch ohne Computerkenntnisse jeder ausführen kann.“ Notfalls sei dies auch mit einem Smartphone möglich. Bei Urlaub oder Krankheit sollte ein geeigneter Vertreter zur Verfügung stehen.
Die vor Ort gemessenen Daten und die Beobachtungen der Wetterbeobachter werden vom nationalen Wetterdienst zum Beispiel für die Wettervorhersage oder für Gutachten bei Wetterschäden genutzt. Sie sollen aber auch helfen, die Klimaveränderung in Deutschland genau zu erfassen und deren Folgen besser einschätzen zu können. Bei der Kulmbacher Station handelt es sich um eine konventionelle Niederschlagsstation, wie sie zum Beispiel auch Fischer in Marktleuthen-Neudorf betreibt.
Ansprechpartner bei Interesse: Frank Sievers vom der regionalen Messgruppe des Deutschen Wetterdienstes, in der Helene-Weber-Allee 21 in 80637 München. Telefon: 069/8062-9254, E-Mail: frank.sievers@dwd.de.
Bild: Bei der Kulmbacher Wetterstation von Larissa Grampp und Vater Hermann Grampp in Melkendorf handelt es sich um eine konventionelle Niederschlagsstation, so wie sie der Deutsche Wetterdienst an mehreren Stationen in Oberfranken betreibt.
Corona, Krieg und explodierende Kosten belasten die Bauern / Maschinenring Bamberg konnte sich trotz leichter Rückgänge bislang gut behaupten
 Bamberg.
„Die Unsicherheit ist auf jeden Fall spürbar, man
weiß nicht, wo geht es hin.“ Andreas Hoffmann aus
Sassendorf, Vorsitzender des Maschinenrings Bamberg
e.V. und gleichzeitig Geschäftsführer der MR Bamberg
Dienstleistungs GmbH, bringt auf den Punkt, was die
Landwirte nicht nur im Landkreis Bamberg derzeit
umtreibt. Die Kosten für Dünger, Diesel und Energie
explodierten regelrecht, die Bauern hätten keine
Alternativen. Von den steigenden Preisen im
Lebensmittelhandel komme nichts bei den Landwirten
an und das Regelkorsett, in dem die Bauern stecken,
werde immer enger.
Bamberg.
„Die Unsicherheit ist auf jeden Fall spürbar, man
weiß nicht, wo geht es hin.“ Andreas Hoffmann aus
Sassendorf, Vorsitzender des Maschinenrings Bamberg
e.V. und gleichzeitig Geschäftsführer der MR Bamberg
Dienstleistungs GmbH, bringt auf den Punkt, was die
Landwirte nicht nur im Landkreis Bamberg derzeit
umtreibt. Die Kosten für Dünger, Diesel und Energie
explodierten regelrecht, die Bauern hätten keine
Alternativen. Von den steigenden Preisen im
Lebensmittelhandel komme nichts bei den Landwirten
an und das Regelkorsett, in dem die Bauern stecken,
werde immer enger.
Dazu komme die vor der Tür stehende Reform der europäischen Agrarpolitik, bei der noch vieles im Ungewissen sei. „Kein anderer Industriezweig wird in ein dermaßen enges Regelwerk gesteckt, wie die Landwirtschaft“, so Andreas Hoffmann. Dabei seien die Folgen der Corona-Krise noch längst nicht überwunden. Auch beim Maschinenring sei Corona durch einen Rückgang bei der Betriebshilfe spürbar geworden. Viele Operationen und Rehabilitationsmaßnahmen seien verschoben worden, so dass gar kein Betriebshelfer in Spruch genommen werden musste. Auch die Kommunikation mit Fremdfirmen sei vielfach schwieriger geworden, zum Beispiel deshalb, weil sich die Ansprechpartner im Home Office befanden.
Der Maschinenring Bamberg hat aktuell einen Verrechnungswert von rund 2,04 Millionen Euro (Vorjahr 2,28 Millionen Euro). Den Rückgang macht Vorsitzender Hoffmann am klassischen Maschinengeschäft aufgrund der Wetter- und Erntesituation fest. Schwerpunkte waren die Bereiche Körnerernte, Futterbau und Strohernte sowie organische Düngung. Bei der sozialen Betriebshilfe kommt Andreas Hoffmann auf gut 12700 Einsatzstunden, die von zusammen 37 Einsatzkräften geleistet wurden. Dabei gehe es einzig und allein um die Aufrechterhaltung des Betriebsablaufs in sozialen Notfällen. Die wirtschaftliche Betriebshilfe spielt beim MR Bamberg dagegen kaum eine Rolle.
Als Schwerpunkte in der alltäglichen Arbeit der GmbH, in der die gewerblichen Aktivitäten ausgelagert sind, bezeichnete der Vorsitzende unter anderem den Winterdienst und die Grünanlagenpflege, die Pflege von Obstbäumen, sie Betreuung von Parkplätzen sowie die Beteiligung an den zwei Biomasseheizwerken am Schwimmbad Bambados“ in der Stadt Bamberg und an einer klassischen Hackschnitzelheizung in Breitengüßbach. Kunden seien in erster Linie Firmen und Kommunen, mittlerweile würden aber auch immer mehr Privatleute auf die Dienste des Maschinenrings zurückgreifen.
Der Maschinenring Bamberg hatte nach den letzten vorliegenden Zahlen 714 Mitglieder, was einen leichten Rückgang um 34 Mitglieder binnen Jahresfrist bedeutet. Sie alle bewirtschaften zusammen eine Fläche von knapp 32300 Hektar, rund 900 Hektar weniger als im Vorjahr. Eine Besonderheit gibt es beim Maschinenring Bamberg: Das Ringgebiet ist nicht ganz deckungsgleich mit dem Landkreis Bamberg, weil der Teil des früher eigenständigen Landkreises Ebermannstadt zum Maschinenring Fränkische Schweiz gehört. Bereits seit 1. September 2019 ist der MR Bamberg in den Geschäftsräumen im Industriegebiet Laubanger zu finden. Dort sind vier Vollzeit und zwei Teilzeitkräfte beschäftigt.
Bild: „Man weiß nicht, wo geht es hin“: Andreas Hoffmann aus Sassendorf, Vorsitzender des Maschinenrings Bamberg e.V. und gleichzeitig Geschäftsführer der MR Bamberg Dienstleistungs GmbH.
Landwirtschaft hat Zukunft (17):
Galaktisch gut aus Himmelkron: Aus Sojabohnen wird „Ufotofu“ / Christopher Schramm aus Himmelkron hat die „Tofurei“ erfunden
.jpg) Himmelkron.
Damit liegt Christopher Schramm voll im Trend: auf
rund einem Hektar Fläche bei Himmelkron baut der
32-Jährige Soja an und stellt aus den Bohnen die
Fleischalternative Tofu sowie einen Sojadrink her.
„Ich sehe durchaus Potential, denn fleischlos ist im
Kommen“, sagt der Landwirtssohn. Vermarktet wird
die, zugegeben derzeit noch recht überschaubare
Produktion entweder direkt ab Hof oder über den
Unverpackt-Laden „Hamsterbacke“, über den
Naturkostladen „Hollerbusch“, beide in Bayreuth, und
seit neuestem auch über den Hofladen der Frankenfarm
in Himmelkron. Pro Woche produziert Christopher
Schramm rund zehn Kilogramm sowie einige
Halbliterflachen Sojadrink.
Himmelkron.
Damit liegt Christopher Schramm voll im Trend: auf
rund einem Hektar Fläche bei Himmelkron baut der
32-Jährige Soja an und stellt aus den Bohnen die
Fleischalternative Tofu sowie einen Sojadrink her.
„Ich sehe durchaus Potential, denn fleischlos ist im
Kommen“, sagt der Landwirtssohn. Vermarktet wird
die, zugegeben derzeit noch recht überschaubare
Produktion entweder direkt ab Hof oder über den
Unverpackt-Laden „Hamsterbacke“, über den
Naturkostladen „Hollerbusch“, beide in Bayreuth, und
seit neuestem auch über den Hofladen der Frankenfarm
in Himmelkron. Pro Woche produziert Christopher
Schramm rund zehn Kilogramm sowie einige
Halbliterflachen Sojadrink.
Erst habe er Käse produzieren wollen, schließlich stehen gleich nebenan im Hof der Eltern die Milchkühe im Stall. Doch die Investitionen seien zu groß, der zeitliche Aufwand nicht zu stemmen gewesen. Ein Beitrag im Landwirtschaftlichen Wochenblatt habe dann den Ausschlag gegeben, es einmal mit Soja zu versuchen, damit war die Idee eine „Tofurei“, ausgerechnet im ehemaligen Schlachtraum des Hofes, geboren.
Dabei ist Christopher Schramm weder Vegetarier noch Veganer. „Ich wollte halt etwas machen, was noch keiner macht“, sagt er und startete damals noch in der eigenen Küche die ersten Versuche. „Ich habe mich da ganz langsam herangetastet“, sagt er. Christopher Schramm räumt ein, dass das Ganze derzeit eigentlich nur „ein sehr zeitaufwändiges Hobby“ ist. Was nicht heißt, dass noch viel mehr draus werden könnte. „Es soll schon mal ein eigener Betriebszweig werde“, so Schramm. Die Grundlagen sind gelegt, die Ausrüstung ist bereits überaus professionell.
.jpg) Hauptberuflich
ist Christopher Schramm seit zwei Jahren im
Ingenieurbüro GeoTeam in Bayreuth tätig und arbeitet
dort an der Schnittstelle zwischen Wasserversorgern
und Landwirten. Er ist gelernter Chemielaborant und
hat im Rahmen des „BiLa“-Programms eine Ausbildung
zum Landwirt absolviert. Die Eltern bewirtschaften
einen klassischen Milchviehbetrieb mit 65 Hektar
Fläche und 70 Kühen im Stall.
Hauptberuflich
ist Christopher Schramm seit zwei Jahren im
Ingenieurbüro GeoTeam in Bayreuth tätig und arbeitet
dort an der Schnittstelle zwischen Wasserversorgern
und Landwirten. Er ist gelernter Chemielaborant und
hat im Rahmen des „BiLa“-Programms eine Ausbildung
zum Landwirt absolviert. Die Eltern bewirtschaften
einen klassischen Milchviehbetrieb mit 65 Hektar
Fläche und 70 Kühen im Stall.
Im zurückliegenden Jahr hat er Ende April zum ersten Mal Soja ausgesät. Ernte war relativ spät Anfang Oktober. Der gesamte Anbau erfolgte absolut biologisch, also komplett ohne chemischen Pflanzenschutz. „Wenn schon, denn schon“, sagt Christopher Schramm.
Immer montags geht es in der „Tofurei“ hoch her. Die in Wasser aufgequollenen Bohnen werden in einem 60-Liter-Kessel eingekocht und mit einer Art Entsafter in dickflüssige Soja-„Milch“ verwandelt. Die „Milch“ wird dann rund 30 Minuten lang auf über 90 Grad erhitzt und unter Zugabe von aus Meersalz gewonnenem Magnesiumchlorid als Gerinnungsmittel gerührt und in Formen gepresst, ehe die 200-Gramm-Stücke im Glas oder im Becher mit Salzlake verpackt werden. Hört sich auf den ersten Blick leicht an, ist in Wirklichkeit aber gar nicht so einfach. Bis die Konsistenz stimmte und der cremige Eigengeschmack da war, habe es schon gedauert.
.jpg) Bis
es soweit war, hat sich Christopher Schramm sein
Wissen nicht nur mit Hilfe umfangreicher
Fachliteratur angelesen, sondern auch Tofu-Betriebe
besucht. Auch einen eigenen Markennamen hat er
schon: „Ufotofu“. Das zeigt, dass Christopher
Schramm auch Humor hat, schließlich lautet der
augenzwinkernde Zusatz „galaktisch gut aus
Himmelkron“. „Da kommt man so in einer Bierlaune
drauf“, sagt er.
Bis
es soweit war, hat sich Christopher Schramm sein
Wissen nicht nur mit Hilfe umfangreicher
Fachliteratur angelesen, sondern auch Tofu-Betriebe
besucht. Auch einen eigenen Markennamen hat er
schon: „Ufotofu“. Das zeigt, dass Christopher
Schramm auch Humor hat, schließlich lautet der
augenzwinkernde Zusatz „galaktisch gut aus
Himmelkron“. „Da kommt man so in einer Bierlaune
drauf“, sagt er.
Auch die Soja-Herstellung ist ein gutes Beispiel für Nachhaltigkeit. So werden beispielsweise die Schalen der Bohnen an die Kühe verfüttert. Ausbaufähig ist das Ganze auch: „Ich könnte mir vorstellen, künftig auch Sojajoghurt, oder Tofu in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Kräuter oder Bärlauch herzustellen“. Räuchertofu hat er bereits produziert. Nur eines will er garantiert nicht: Fleischesser überzeugen, Vegetarier oder Veganer zu werden.
Bilder:
1. Christopher
Schramm zeigt in seiner „Tofurei“ die quellenden
Sojabohnen. Bis zum fertigen Tofu ist es noch ein
langer Weg.
2. Das
gab es bisher noch nicht: Tofu aus der Region und
für die Region: In Himmelkron produziert Christopher
Schramm derzeit eine noch recht überschaubare Menge.
Landwirtschaft hat Zukunft (16):
Tierwohl wird groß geschrieben / Thomas Erlmann bewirtschaftet in Waldau einen Milchviehbetrieb und die ganze Familie hilft mit
.jpg) Waldau.
„Ohne Leidenschaft geht es nicht“, sagt Thomas
Erlmann. 2012 hat er den Hof am Ortsrand von Waldau
komplett übernommen. Heute bewirtschaftet er ihn
zusammen mit seinem Eltern Helmut und Getrud, seiner
Frau Anja, den drei Söhnen Lukas (15), Alexander
(13), Sebastian (10) und dem Auszubildenden Jan
Morath. 175 Hektar und 150 Kühe plus weiblicher und
männlicher Nachzucht im Stall kann man nicht so
nebenbei machen. Da muss alles gut organisiert sein.
Einfach mal so wegfahren, das geht nicht. „Man muss
auch schon mal bereit sein, einen Handgriff mehr zu
machen“, so Erlmann. „Und ohne die Unterstützung der
ganzen Familie wäre es ohnehin nicht zu schaffen.“
Waldau.
„Ohne Leidenschaft geht es nicht“, sagt Thomas
Erlmann. 2012 hat er den Hof am Ortsrand von Waldau
komplett übernommen. Heute bewirtschaftet er ihn
zusammen mit seinem Eltern Helmut und Getrud, seiner
Frau Anja, den drei Söhnen Lukas (15), Alexander
(13), Sebastian (10) und dem Auszubildenden Jan
Morath. 175 Hektar und 150 Kühe plus weiblicher und
männlicher Nachzucht im Stall kann man nicht so
nebenbei machen. Da muss alles gut organisiert sein.
Einfach mal so wegfahren, das geht nicht. „Man muss
auch schon mal bereit sein, einen Handgriff mehr zu
machen“, so Erlmann. „Und ohne die Unterstützung der
ganzen Familie wäre es ohnehin nicht zu schaffen.“
Am Tag zehn Tonnen Futter, im Jahr 40000 Liter Diesel: Ein Außenstehender würde das gar nicht verstehen, ist sich der 42-Jährige sicher. Zu sehr hätten sich weite Teil der Bevölkerung von der Landwirtschaft entfernt. Auch was das viel zitierte Tierwohl angeht. Dabei gehe es den Tieren so gut wie nie zuvor.
Davon kann man sich im großen Laufstall auf dem Hof nahe der Bundesautobahn A70 überzeugen. Schon vor 22 Jahren wurde der Stall gebaut, ursprünglich für 60 Kühe konzipiert, wurde er zwischenzeitlich zwei Mal erweitert. Alle Tiere können sich frei bewegen, die Anbindehaltung hatte bereits Vater Helmut vor Jahrzehnten abgeschafft. Vor zwei Jahren kam dann ein hochmoderner Melkstand dazu, mit dem es möglich ist, zu zweit 150 Kühe in eineinhalb Stunden zu melken.
Mit der vielgescholtenen Massentierhaltung hat das alles nichts zu tun. „Wir stehen jeden Morgen um sechs Uhr auf, und bevor wir selbst frühstücken, werden unsere Tiere komplett versorgt“, sagt Thomas Erlmann. 1998/1999 hatte er die Landwirtschaftsschule absolviert, in den darauffolgenden Jahren die damalige Höhere Landbauschule (HLS) in Bayreuth und anschließend folgte auch noch die Meisterprüfung. Zehn Jahre lang führte er den Hof zusammen mit dem Vater als GbR, nun ist Thomas Erlmann alleiniger Betriebsleiter.
Zehn
Lehrlinge hat er in den zurückliegenden zwölf Jahren
ausgebildet. Eine ungewöhnlich hohe
Ausbildungsleistung, zumal es im Raum Kulmbach nur
wenige landwirtschaftliche Ausbildungsbetriebe gibt.
Eine Besonderheit ist auch Lehrling Jan Morath aus
der Nähe von Himmelkron. Der 21-jährige hat bereits
eine abgeschlossene Ausbildung, und zwar als
Bauzeichner. Obwohl er im Gegensatz zu vielen
anderen Landwirtschafts-Azubis keinen elterlichen
Betrieb vorweisen kann, wollte er die Ausbildung
unbedingt absolvieren.
Die Milch geht komplett an die Bayernland-Käserei in Bayreuth. Auf den 175 Hektar Fläche, die sich nahezu ausschließlich über den Gemeindebereich von Neudrossenfeld erstrecken, baut Thomas Erlmann im Wesentlichen Gerste, Kleegras, Mais, Raps und Weizen an. Der größte Teil als Futtergetreide für den eigenen Betrieb. Ein kleiner Teil geht an einen nahegelegenen Schweinebetrieb
Eine Besonderheit ist auch die mit zweieinhalb Hektar fast schon riesige Hofstelle. Ein Teil davon hat einen prominenten Vorbesitzer: auf etwa einem Hektar davon hatte vor Jahrzehnten der ehemalige bayerische Bauernverbandspräsident und Bundestagsabgeordnete Gustav Sühler (1922 – 1998) gewirtschaftet, der aus dem benachbarten Lindau stammte.
Die Vielzahl seiner Ehrenämter zeigt, dass Thomas Erlmann über seinen Betrieb hinaus ein gefragter Mann ist. Bereits in der zweiten Wahlperiode sitzt er für die Wählergemeinschaft Waldau im Gemeinderat von Neudrossenfeld, er ist Vorsitzender der Kulmbacher Rinderzüchter und stellvertretender Vorsitzender des oberfränkischen Rinderzuchtverbandes, Vorstandsmitglied der Besamungsstation Neustadt, Jagdvorstand und stellvertretender Feuerwehrkommandant. Seine Mitarbeit im oberfränkischen Meisterprüfungsausschuss hat Thomas Erlmann jetzt aufgegeben, denn auch sein Tag hat nur 24 Stunden.
Bilder:
1.
Sie sind mit der Landwirtschaft aufgewachsen: die
drei Söhne Lukas, Alexander und Sebastian im
großzügig angelegten Laufstall, in dem Tierwohl groß
geschrieben wird.
2. Sie
alle helfen tatkräftig mit, damit alles rund läuft
auf dem Betrieb (von links): Lukas, Thomas,
Alexander, Anja, Getrud, Sebastian und Helmut
Erlmann, sowie Azubi Jan Morath.
Wald vor Wild: Schwerwiegende ökonomische und ökologische Auswirkungen / Forstliche Gutachten zur Situation der Waldverjüngung: Rehwild-Abschusspläne sollen deutlich erhöht werden
Kulmbach. Die Wälder im Landkreis Kulmbach sind in schlechtem Zustand. Die Verbiss-Situation hat im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zugenommen und liegt meist deutlich über dem bayerischen Durchschnitt. Im forstlichen Gutachten zur Situation der Waldverjüngung („Vegetationsgutachten“ oder „Verbissgutachten“), das Michael Schmidt vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach unlängst vorgelegt hat, ist nicht nur die Rede von schwerwiegenden ökonomischen Auswirkungen für die Waldbesitzer, etwa durch hohe Kosten für dringend notwendigen Bau von Schutzzäunen, sondern auch von ökologischen Auswirkungen etwa durch das Aussterben mancher Baumarten.
Laut Gutachten, das immer im dreijährigen Turnus erstellt wird, sind die Rehwildbestände im Landkreis Kulmbach zuletzt deutlich angestiegen. Mit den Rehwildbeständen steigt natürlich auch die Verbiss-Problematik. Teilweise liegt der Verbiss sogar deutlich über den bayerischen Durchschnitt, der mit 40 Prozent angegeben wird. Ein wichtiges Ziel des Gutachtens ist es, die Rehwild-Abschusspläne für die kommenden drei Jahre zu erstellen. Eine weitere Konsequenz ist es deshalb, dass die Abschussempfehlung deutlich erhöht werden muss. Dramatisch verschärft wurde die Situation zusätzlich durch die großen Borkenkäferschäden der zurückliegenden Jahre. Dadurch waren riesige Kahlflächen entstanden, allein im Landkreis Kulmbach rund 2000 Hektar.
Sechs Hegegemeinschaften gibt es im Landkreis Kulmbach, bei allen sechs liegt der Verbiss deutlich über dem bayerischen Schnitt. Im Einzelnen liegen die Zahlen für die Hegegemeinschaft (HG) Kulmbach bei 70 Prozent, für die HG Roter Main bei 64 Prozent, für die HG Jura bei 73 Prozent, für die HG Trebgast bei 65 Prozent, für die HG Frankenwald bei 51 Prozent und für die HG Frankenwald-Oberland bei 50 Prozent. Die offizielle Abschussempfehlung lautet bei sämtlichen Hegegemeinschaften „erhöhen“, bei der HG Kulmbach sogar „deutlich erhöhen“.
„Damit ist der Verbiss in allen sechs Hegegemeinschaft zu hoch“, sagt Forstdirektor Michael Schmidt. Er zitiert das Bayerische Waldgesetz, dass ganz klar die Priorität „Wald vor Wild“ definiert habe. Das bedeute nicht Wald ohne Wild, so Schmidt, lege aber eine klare Priorität zu Gunsten des Waldes durch den Gesetzgeber fest. Deshalb sei auch die Abschussplanung als Grundlage einer objektiven Beurteilung der Waldverjüngung von so großer Bedeutung. Für das forstliche Gutachten haben Michael Schmidt und seine Mannschaft rund 14000 Pflanzen auf 200 Verjüngungsflächen auf Verbiss-Schäden im gesamten Landkreis Kulmbach untersucht.
Mit Schrecken hat Burkhard Hartmann, Vorsitzender der AG Jagdgenossenschaft, das forstliche Gutachten bereits vor Wochen zur Kenntnis genommen. Nicht nur, dass die Mehrzahl der Reviere in den sechs Hegegemeinschaft mittlerweile zu hohe, teilweise sogar deutlich zu hohe Verbiss-Zahlen aufweisen, sondern auch, dass meist der besonders wichtige Leittrieb betroffen sei. Damit sei der Baum von vornherein nutzlos und wertlos und tauge später allenfalls noch als Brennholz. „Die Situation ist wirklich gravierend“, sagte Hartmann. Man müsse aktiv nachpflanzen, anders gehe es nicht.
Nicht nur die Jäger seien für den Wildbestand und einen angemessenen Lebensraum für das Rehwild verantwortlich, auch Waldbesitzer und Landwirte, gibt Peter Müller, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Kulmbach, zu Bedenken. Großflächige und relativ monotone Feldstrukturen hätten das Rehwild immer stärker zurückgedrängt, so dass einzig die Waldfläche noch als Rückzugsmöglichkeit und Lebensraum für das Rehwild bleibt. Dazu würden nicht alle Waldbesitzer ihre Wälder optimal bewirtschaften, so dass das Rehwild auf die verbleibenden relativ kleinen, aber attraktiven Flächen zurückgedrängt wird. „Rehe sind schließlich absolute Feinschmecker“, gibt der Vorsitzende zu bedenken. Für die Jägerschaft verspricht Peter Müller dennoch: „Wir werden die Abschüsse stark nach oben treiben“. Die offiziell geforderte Erhöhung der Abschussempfehlung bedeute in Zahlen in etwa zehn Prozent mehr Abschüsse bezogen auf die jeweilige Fläche. Trotzdem könne die Gewährleistung „ordentlicher Rehwildzahlen“ nicht alleinige Aufgabe der Jagd sein.
Die Bayerische Forstverwaltung erstellt alle drei Jahre für die rund 750 bayerischen Hegegemeinschaften Gutachten zur Situation der Waldverjüngung. Darin äußern sich die Forstbehörden zum Zustand der Waldverjüngung und ihre Beeinflussung durch Schalenwildverbiss. Sie beurteilen die Verbiss-Situation in den Hegegemeinschaften und geben Empfehlungen zur künftigen Abschusshöhe ab. Die Forstlichen Gutachten 2021 sollen die Beteiligten vor Ort in die Lage versetzen, für die Schalenwild-Abschussplanperiode 2022/25 einvernehmlich gesetzeskonforme Abschusspläne aufzustellen. Für die unteren Jagdbehörden stellen sie eine wichtige Entscheidungsgrundlage bei der behördlichen Abschussplanung dar. Bayernweit ergibt sich laut einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums folgendes Bild: Der Anteil der Laubbäume hat weiter zugenommen und liegt jetzt bei 52 Prozent.Landwirtschaft hat Zukunft (15):
Vom Milchbauer zum Christbaumerzeuger / Uwe Witzgall produziert im Oberland Christbäume für ganz Deutschland
.jpg) Petschen.
„Wenn, dann mit aller Konsequenz“. Das dachte sich
Uwe Witzgall in den Jahren 2013/2014, als er die von
seinen Eltern übernommene Milchviehhaltung aufgab
und auf die Produktion von Christbäumen setzte. Ein
gewagter Schritt in der kleinen Einöde Petschen,
weit oberhalb von Stadtsteinach, direkt auf der
Fränkischen Linie, rund 540 Meter über Normalnull.
Heute gibt ihn der Erfolg Recht. Der 51-Jährige baut
auf rund 30 Hektar Fläche hauptsächlich
Nordmanntannen, in geringerer Stückzahlen auch
Nobilis-Tannen, Blaufichten und Schwarzkiefern an
und beliefert damit Händler in ganz Deutschland.
Aber auch direkt auf der Plantage kann man sich in
der Adventszeit seinen Baum aussuchen.
Petschen.
„Wenn, dann mit aller Konsequenz“. Das dachte sich
Uwe Witzgall in den Jahren 2013/2014, als er die von
seinen Eltern übernommene Milchviehhaltung aufgab
und auf die Produktion von Christbäumen setzte. Ein
gewagter Schritt in der kleinen Einöde Petschen,
weit oberhalb von Stadtsteinach, direkt auf der
Fränkischen Linie, rund 540 Meter über Normalnull.
Heute gibt ihn der Erfolg Recht. Der 51-Jährige baut
auf rund 30 Hektar Fläche hauptsächlich
Nordmanntannen, in geringerer Stückzahlen auch
Nobilis-Tannen, Blaufichten und Schwarzkiefern an
und beliefert damit Händler in ganz Deutschland.
Aber auch direkt auf der Plantage kann man sich in
der Adventszeit seinen Baum aussuchen.
Ackerbau betreibt der gelernte Landwirt immer noch. Auf weiteren rund 30 Hektar Fläche baut er Roggen, Dinkel und Braugerste an. Der Roggen geht zum Vollkorn-Spezialitäten-Hersteller Pema nach Weißenstadt, Der Dinkel wird klassisch über den hiesigen Landhandel vermarktet und die Braugerste findet sich in den Bierspezialtäten der Altenkunstädter Brauerei Leikeim wieder.
Doch Uwe Witzgall ist mit Leib und Seele Christbaumerzeuger. Über 5500 Bäume wachsen auf einem Hektar. Wer glaubt, das wäre ein schnelles Geschäft, der hat sich allerdings getäuscht. Die Jungpflanzen, meist von örtlichen Händlern, werden mit drei Jahren gesetzt. Die Ernte ist erst Jahre später möglich. „Unsere Bäume wachsen im Schnitt sieben bis zehn Jahre“, erklärt Uwe Witzgall. Bei ihm gibt es auch Christbäume, die vier bis fünf Meter hoch sind und die meist von Firmen oder der öffentlichen Hand bestellt werden. Sie brauchen dann natürlich entsprechend länger.
Zwei Drittel der Bäume gehen an Wiederverkäufer in ganz Deutschland. „Wir beliefern Christbaummärkte von Rosenheim bis Niedersachsen“, sagt er. Aber auch in der Region gibt es die Bäume aus dem Oberland an vielen Verkaufsstellen. Ein Drittel vermarktet Uwe Witzgall direkt an Endkunden. An jedem zweiten und dritten Advent auch zum selbst aussuchen und zum selbst schlagen. Alle Bäume werden bereits im Sommer nach Größe und Qualität ausgezeichnet, ehe sie dann im November gefällt, verpackt und verladen werden.
Um sich von der Billigkonkurrenz der Baumärkte abzugrenzen, legt Uwe Witzgall allergrößten Wert auf Qualität. Das beweist schon die Tatsache, dass in der Regel rund 20 Prozent aller Bäume als Ausschuss eingestuft und als Schnittgrün vermarktet werden. „Schrott geben wir nicht raus“, macht Uwe Witzgall unmissverständlich klar und ist fest davon überzeugt: Wer einmal einen Qualitätsbaum aus seinen Plantagen hat, der kommt immer wieder.
.jpg) Qualitätsbaum
heißt, dass alle Bäume aus Petschen seit 2018 das
Siegel „geprüfte Qualität Bayern” tragen dürfen. Das
Gütesiegel besagt, dass festgelegte
Produktionskriterien eingehalten und auch regelmäßig
kontrolliert werden. Dazu gehört zum Beispiel ein
später Schnittzeitpunkt ab dem 15. November.
Außerdem wurde der Betrieb nach den Standards von
GLOBAL G.A.P. zertifiziert, was die Erfüllung noch
höherer Standards bedeutet. Sie beginnen von der
Anpflanzung über die Produktion bis hin zur Ernte,
praktisch in allen Bereichen. „Somit kann man jedem
Baum einen eigenen Lebenslauf ausstellen“, erläutert
Uwe Witzgall.
Qualitätsbaum
heißt, dass alle Bäume aus Petschen seit 2018 das
Siegel „geprüfte Qualität Bayern” tragen dürfen. Das
Gütesiegel besagt, dass festgelegte
Produktionskriterien eingehalten und auch regelmäßig
kontrolliert werden. Dazu gehört zum Beispiel ein
später Schnittzeitpunkt ab dem 15. November.
Außerdem wurde der Betrieb nach den Standards von
GLOBAL G.A.P. zertifiziert, was die Erfüllung noch
höherer Standards bedeutet. Sie beginnen von der
Anpflanzung über die Produktion bis hin zur Ernte,
praktisch in allen Bereichen. „Somit kann man jedem
Baum einen eigenen Lebenslauf ausstellen“, erläutert
Uwe Witzgall.
Von Mitte November bis zum zweiten Advent geht es in und um Petschen rund. „In diesen Wochen haben wir so richtig Stress“, sagt Uwe Witzgall, der vier Mitarbeiter beschäftigt. Doch eigentlich gibt es das ganze Jahr über viel zu tun. Im Moment ist er mit der Entnahme von Bodenproben beschäftigt. Ist eine Fläche erst einmal gerodet wird sie mit einer Zwischenfrucht wie etwa Kleegras begrünt, ehe sie im Herbst neu gepflanzt wird. Düngen, Pflanzenschutz und Baumpflege sind ganzjährig ein Thema.
Auch technisch ist der Christbaumproduzent bestens ausgerüstet. Da gibt es neben den üblichen Gerätschaften, mit denen auch Waldbauern arbeiten, Pflanzmaschinen, Netzautomaten und Palettiermaschinen. 80 bis 100 Bäume passen auf eine Palette, zehn Paletten auf einen Lkw, so rechnet Uwe Witzgall vor. Daraus wird auch die Dimension ersichtlich, in der sich der Christbaumerzeuger bewegt.
Natürlich ist auch Uwe Witzgall, wie jeder andere Landwirt auch, von Boden, Klima, Temperaturen, und Niederschlägen abhängig. „Die Natur kann auch unser Gegner sein“, sagt er und erinnert sich an die Eisheiligen im Jahr 2020, als es Mitte Mai noch einmal einen Nachfrost gab. Die Knospen waren damals schon offen, die frostempfindlichen Triebe schon draußen und so entstand großer Schaden an vielen Bäumen. Auch die Trockenjahre 2018 bis 2020 hätten sich in den Kulturen bemerkbar gemacht, indem es massive Ausfälle bei den Jungpflanzen gab. Das zurückliegende Jahr sei dagegen klimatisch ganz gut verlaufen und aktuell habe es im Winter genügend Feuchtigkeit gegeben.
Eine schlechte Nachricht hat Uwe Witzgall aber dann doch: Nachdem die Preise im zurückliegenden Winter gehalten werden konnten, wird er um eine moderate Erhöhung zum nächsten Weihnachtsfest wohl nicht herum kommen. Grund: Die Preise für Dünger und Diesel steigen derzeit immens an und obwohl er seine Mitarbeiter längst über Mindestlohn bezahlt, wird es auch Lohnsteigerungen geben müssen, um die besten Kräfte für die schwere Arbeit halten zu können.
Bilder:
1. Uwe
Witzgall inmitten einer Plantage, an der die
Jungpflanzen heranwachsen.
2. High
Tech für das Weihnachtsfest: hier werden die
Christbäume zur Verladung in die Netze gezogen.
Landwirtschaft hat Zukunft (14):
Landschaftspflege und Lohnunternehmen / Baumpflege, Baggern, Bierfestfahnen: Der Betrieb von Andreas Textores ist breit aufgestellt
.jpg) Gemlenz.
Es gibt nichts, was wir nicht machen“, sagt Andreas
Textores. Der 43-Jährige gelernte Landwirt betreibt
seit 2003 einen Landschaftspflegebetrieb und ein
Lohnunternehmen mit Sitz in Gemlenz bei Lehenthal.
Hervorgegangen aus dem elterlichen Hof mit zuletzt
25 Kühen und 40 Hektar Fläche ist der Betrieb heute
ungewöhnliche breit aufgestellt, vielfältig
technisiert und auch für den einen oder anderen
ungewöhnlichen Auftrag zu haben.
Gemlenz.
Es gibt nichts, was wir nicht machen“, sagt Andreas
Textores. Der 43-Jährige gelernte Landwirt betreibt
seit 2003 einen Landschaftspflegebetrieb und ein
Lohnunternehmen mit Sitz in Gemlenz bei Lehenthal.
Hervorgegangen aus dem elterlichen Hof mit zuletzt
25 Kühen und 40 Hektar Fläche ist der Betrieb heute
ungewöhnliche breit aufgestellt, vielfältig
technisiert und auch für den einen oder anderen
ungewöhnlichen Auftrag zu haben.
Eigentlich hatte er damals nach der Übernahme des Betriebes von den Eltern einen Milchviehstall bauen wollen. Doch es kam anders. Nach dem Besuch der Winterschule in Coburg 1999 arbeitete er zunächst drei Jahre als angestellter Schlepperfahrer und kam so mit dem Thema Landschaftspflege in Verbindung.
Die Flächen rund um Gemlenz bewirtschaftet er noch immer und baut darauf Braugerste, Kleegras, Mais an. Auch Grünland gehört dazu. Während die Braugerste über den Landhandel vermarktet wird, beliefert Andreas Textores mit dem Rest die Biogasanlage in Gössersdorf im Nachbarlandkreis Kronach.
.jpg) Eine
wichtige Säule seiner Arbeit ist seit fast 20 Jahren
der Winterdienst. Von den größeren Unternehmen in
der Stadt Kulmbach greifen alle auf die Schlagkraft
und Erfahrung von Andreas Textores zurück. Seit
einiger Zeit ist beispielsweise der neue Schneepflug
mit einer Breite von fünf Metern im Einsatz, der
sich optimal für die Räumung von
Supermarktparkplätzen eignet.
Eine
wichtige Säule seiner Arbeit ist seit fast 20 Jahren
der Winterdienst. Von den größeren Unternehmen in
der Stadt Kulmbach greifen alle auf die Schlagkraft
und Erfahrung von Andreas Textores zurück. Seit
einiger Zeit ist beispielsweise der neue Schneepflug
mit einer Breite von fünf Metern im Einsatz, der
sich optimal für die Räumung von
Supermarktparkplätzen eignet.
Darüber hinaus gehören Gülle- und Silage-Transporte zu den Aufgaben, die Andreas Textores zusammen mit seinem Angestellten Max Weigel, einem gelernten Nutzfahrzeugmechatroniker, ausführt. Für Arbeitsspitzen greift Textores in der Regel auf Kräfte aus dem Maschinenring zurück.
Für die vielen Pferdebetriebe in der Umgebung bietet er eine umfangreiche Palette an Dienstleistungen an, vom Mähen des Grünlandes bis hin zum Aufstapeln der Heuballen in den Scheunen gehört alles dazu. Gute Kunden sind die Verbrauchermärkte für die er auch im Sommer die Anlagen rund um die Parkplätze pflegt, Kehrdienste übernimmt und wenn es sein muss sogar den Müll einsammelt. „Wir bieten einen Rund-um-Service für unsere Kundschaft“, sagt Andreas Textores und hat dabei nicht nur Firmen- sondern auch Privatkunden im Blick.
Meist arbeitet er dabei mit der Maschinenring Oberfranken Mitte GmbH zusammen, in der die Ringe Bayreuth, Kulmbach und Fränkische Schweiz ihre gewerblichen Aktivitäten gebündelt haben. Textores ist seit gut zehn Jahren Vorsitzender des Kulmbacher Maschinenrings, der heuer seinen 60-jähriges Bestehen feiert. Die Zusammenarbeit mit dem Maschinenring biete Riesenvorteile für alle Beteiligten, sagt er.
Kontinuierlich gewachsen ist der Maschinenpark. Vom kleinen Aufsitzmäher bis zur Quaderballenpresse, ein Bagger, fünf Schlepper, ein Holzhäcksler, das und vieles mehr steht in der Maschinenhalle in Gemlenz. Gleich daneben will er im kommenden Jahr eine neue beheizbare Halle errichten, in der auch im Winter und bei Nacht schrauben, schweißen oder flexen kann.
Auch für ungewöhnliche Aufträge ist sich Andreas Textores nicht zu schade. Im Gegenteil: Zur Kulmbacher Bierwoche war er es, der die Fahnen in der gesamten Stadt aufgehängt hat. Mit der Corona-bedingten Absage des Bierfestes wurden in den beiden vergangenen Jahren zwar auch die Flaggen weniger, doch irgendwann werden seine Dienste bestimmt wieder gebraucht. Auf dem EKU-Platz ist er im Sommer trotzdem unterwegs gewesen, um die neu gesetzten Platanen im Auftrag der Stadt zu gießen. „Der Platz ist ein Aushängeschild für die Stadt“, sagt Andreas Textores. Eigens für diesen Auftrag hatte er sich ein neues und größeres Wasserfass angeschafft. „Wir haben auch schon viele Problembäume gefällt, Hochregale abgebaut Baggerarbeiten durchgeführt und Baukräne versetzt“, sagt er, dessen Eigenwerbung im Wesentlichen aus Mund-zu-Mund-Propaganda besteht. Um auch gewerbliche Transporte durchführen zu können, ist er sogar in Besitz eines Güterverkehrsscheins.
.jpg) Die
steigende Nachfrage im privaten Bereich erklärt
Andreas Textores damit, dass man sich gerade in
einer dörflichen Gemeinschaft früher viel mehr
selbst geholfen hat. Heute hätten viele Menschen gar
nicht mehr die Zeit dazu und würden beispielsweise
ihren Rasen viel lieber mähen lassen, als selbst
Hand anzulegen.
Die
steigende Nachfrage im privaten Bereich erklärt
Andreas Textores damit, dass man sich gerade in
einer dörflichen Gemeinschaft früher viel mehr
selbst geholfen hat. Heute hätten viele Menschen gar
nicht mehr die Zeit dazu und würden beispielsweise
ihren Rasen viel lieber mähen lassen, als selbst
Hand anzulegen.
Andreas Textores ist in der Szene bestens vernetzt. Als Maschinenringvorsitzender gehört er automatisch der Kreisvorstandschaft des Bauernverbandes an. Früher war er in der Landjugend aktiv die er auch heute noch, genauso wie die Traktorfreunde Kirchleus-Lösau oder die Dorfgemeinschaft Lehenthal unterstützt.
Bilder:
1. Andreas
Textores ist mit seinem Landschaftspflegebetrieb und
Lohnunternehmen technisch auf dem neuesten Stand.
2. Andreas
Textores und sein Mitarbeiter Max Weigel.
3. Die
Holzbearbeitung gehört zu den Kernaufgaben von
Andreas Textores aus Gemlenz.
Landwirtschaft hat Zukunft (13):
Ehrlichkeit und Verlässlichkeit / Die Familie Unger bewirtschaftet in Leesau einen klassischen Milchviehbetrieb
 Leesau.
Den Landwirten wird es nicht leicht gemacht in
diesen Zeiten. Die einen fordern mehr Klimaschutz,
die anderen mehr Tierwohl. Stets sind es die Bauern,
die in die Schusslinie von Politik, Handel und
Verbraucher geraten. Bezahlen will den geforderten
Mehraufwand keiner. Die Familie Unger aus Leesau bei
Thurnau glaubt trotzdem fest daran, dass die
Landwirtschaft Zukunft hat. Allerdings fordern Heike
und Harald Unger sowie Sohn Markus, zwei Dinge:
Verlässlichkeit von der Politik und Ehrlichkeit vom
Verbraucher.
Leesau.
Den Landwirten wird es nicht leicht gemacht in
diesen Zeiten. Die einen fordern mehr Klimaschutz,
die anderen mehr Tierwohl. Stets sind es die Bauern,
die in die Schusslinie von Politik, Handel und
Verbraucher geraten. Bezahlen will den geforderten
Mehraufwand keiner. Die Familie Unger aus Leesau bei
Thurnau glaubt trotzdem fest daran, dass die
Landwirtschaft Zukunft hat. Allerdings fordern Heike
und Harald Unger sowie Sohn Markus, zwei Dinge:
Verlässlichkeit von der Politik und Ehrlichkeit vom
Verbraucher.
„Wir müssen schließlich auch langfristig planen können, und es muss bezahlbar sein“, sagt Harald Unger an die Politik gerichtet. Schließlich sei jede Investition im Schnitt auf 20 Jahre ausgerichtet. Was aber, wenn sich innerhalb dieser 20 Jahre die politischen Vorgaben mehrfach ändern? Auch das Verbraucherverhalten sieht er kritisch. Die Menschen forderten immer mehr Tierwohl, gleichzeitig würden sie immer weniger für gesunde Nahrungsmittel ausgeben. In Vorleistung sind die Bauern längst gegangen: waren früher pro Tier zwei Quadratmeter Standard, sind es heute über acht Quadratmeter, und das mit Licht und Luft, wie es die engen dunklen Ställe der vergangenen Jahrzehnte nie bieten konnten.
Zug um Zug hat die Familie den Kuhstall von einst 16 Meter auf mittlerweile stattliche 100 Meter Länge vergrößert. Bis 1991, als Haralds Schwiegereltern den Hof noch bewirtschafteten, waren es 24 Kühe im Anbindestall plus Jungvieh und 20 Bullen in der Mast. Heute sind es 90 Kühe und die weibliche Nachzucht. Schon 1996 baute die Familie den Stall teilweise zum Laufstall um und setzten einen Melkstand ein. „Damals war schon Überzeugungsarbeit notwendig“, erinnert sich Harald Unger (51). Die heute so verpönte Anbindehaltung war damals schließlich Stand der Dinge und auch in Leesau waren die Trockensteher bis 2010 noch angebunden.
2006 übergaben die Schwiegereltern dann den Betrieb an Heike und Harald, der den Hof mittlerweile mit Sohn Markus (24) als GbR führt. Klaus, der jüngere Bruder von Markus ist als Elektriker außerhalb der Landwirtschaft tätig. Bestimmt ist es kein Zufall, dass auch Harald den Beruf des Elektrikers gelernt hat, ehe er Anfang der 1990er Jahre in den Hof einheiratete, nicht ohne eine ordentliche Ausbildung zum Landwirt zu machen, die er, genauso wie inzwischen Sohn Markus, mit dem Meister abgeschlossen hat.
„Es verging praktisch kein Jahr, in dem wir nicht gebaut haben“, sagt Harald. Nach dem Wohnhausbau im Jahr 2001 wurde 2010 erst der Laufstallbereich erweitert, dann kamen Abkalbeboxen dazu und die Anbindehaltung wurde für Jungvieh umgebaut, bis schließlich zuletzt 2020 ein Außenklimabereich mit Laufhof am Stallende dazu kam um künftig die Forderungen des Lebensmitteleinzelhandels erfüllen zu können.
Auf den rund 100 Hektar Fläche, die sich im Wesentlichen um die Hofstelle herum erstrecken, bauen Harald und Markus Unger Weizen, Braugerste und Winterraps an, der Ertrag wird klassisch über den Landhandel vermarktet. Auf den übrigen Flächen wachsen Kleegras, Mais und Wintergerste. Zusammen mit dem Grünland wird der Ertrag als Eigenbedarf, also als Futter für die Kühe, gebraucht. Überhaupt stellt die Wirtschaftsweise den Idealfall einer Kreislaufwirtschaft dar. Sowohl der Biertreber, die beim Brauen anfallenden Rückstände des Malzes, als auch der Rapsextraktionsschrot, der bei der Herstellung von Rapsöl entsteht, werden wieder an die Kühe verfüttert.
Auch in Sachen Energie kann die Familie Unger punkten: Ein großer Teil des Stalldaches ist mit Fotovoltaikmodulen versehen. „Ab 2003 waren wir damit eine der ersten“, sagt Harald Unger. Natürlich wird der Strom ins öffentliche Netz eingespeist, doch zumindest rechnerisch wird der gesamte Stromverbrauch des Hofes selbst erzeugt. Derzeit denkt man im Hause Unger über die Anschaffung eines Speichers nach.
Symptomatisch für die Entwicklung der Landwirtschaft stehen die Betriebs- und Viehzahlen in Thurnau: Gab es vor zehn Jahren noch 17 Betriebe, sind es heute nur mehr sechs. Auch die Kühe sind weniger geworden, wenngleich ihre Zahl nicht in der gleichen Dimension abgenommen hat. Hier waren es vor zehn Jahren 618 Kühe, heute sind es immerhin noch 407. Insgesamt hören offiziellen Zahlen zufolge jährlich 60 bis 70 Milchviehbetriebe in Oberfranken auf. „Auch das sind alles Arbeitsplätze und Existenzen, die still und heimlich wegbrechen“, sagt Harald Unger, der eine Periode lang auch stellvertretender BBV-Kreisobmann im Kulmbacher Land war und der aktuell die Freien Wähler im Thurnauer Marktgemeinderat vertritt.
Bild: Harald, Heike und Markus Unger im neuen Außenbereich des zuletzt 2020 erweiterten Kuhstalles.
Braugerstenanbau in Gefahr / BBV-Kreisversammlung: Ernährung sicherstellen, statt Flächen stillzulegen
Kulmbach. Die Landwirtschaft steht vor riesigen Herausforderungen. „Es ist nicht fünf vor, sondern bereits fünf nach zwölf“, sagte BBV-Kreisobmann Wilfried Löwinger bei der öffentlichen Online-Kreisversammlung. Der Strukturwandel setze sich derzeit in ungeahnter Art und Weise fort. Vor allem tierhaltende Betriebe blieben auch im Kulmbacher Land auf der Strecke.
„Da kommt einiges auf uns zu“, so Löwinger mit Blick auf die geplante Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) der Jahre 2023 bis 2027. Bewegte Zeiten gebe es derzeit freilich nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch durch den Krieg in der Ukraine, dessen Auswirkungen derzeit noch gar nicht abzusehen sind. „Vor diesem Hintergrund müssen wir die Bedeutung der Ernährungssicherung völlig neu bewerten“, sagte der Kreisobmann. Zwangsstilllegungen, wie sie mit vier Prozent vorgesehen sind, würden da so gar nicht mehr in die Zeit passen. Löwinger rief deshalb dazu auf, die künftige Ausrichtung der europäischen Agrarpolitik noch einmal völlig neu zu überdenken.
Zu den bewegten Zeiten gehöre derzeit auch die Tatsache, dass alles extrem teurer werde. Alle spürten den Preisschock, bei den Bauern schlage besonders die Kostenexplosion bei den Betriebsmitteln zu Buche. Der Preis für Düngemittel habe sich beispielsweise binnen der zurückliegenden zwölf Monate glatt verdreifacht. Gleichzeitig bleiben den Landwirten die Einnahmen weg. „Bei uns kommt nichts an“, so Löwinger. Die großen Gewinne gehen in die Taschen der Handelskonzerne.
Konkret kritisierte Löwinger unter anderem, dass mit dem Ziel des Erosionsschutzes eine künftige Winterbegrünung vorgeschrieben ist. Das sei mit dem für das Kulmbacher Land so wichtigen Braugerstenanbau nicht vereinbar, weil es bei der Bewirtschaftung erhebliche Probleme mit sich bringt. Neben einer Rücknahme überzogener Forderungen, Vorschriften und Gesetze forderte der Kreisobmann deshalb, Ausnahmeregelungen für bestimmt Gebiete von der Winterbegrünung. „Es kann ja niemand daran Interesse haben, dass die Braugerste bei uns vor dem Aus steht.“
Im Mittelpunkt der Kreisversammlung stand die zukünftige gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union für den Förderzeitraum 2023 bis 2027. Matthias Borst vom Fachbereich Agrar- und Umweltpolitik des BBV kam dabei zu dem Schluss, dass die künftige EU-Agrarpolitik noch komplexer und von den Bauern noch mehr abverlangen werde. Zwar hätten ein solider Finanzrahmen gesichert und eine ursprünglich geplante 30-prozentige pauschale Kürzung verhindert werden können. Trotzdem werde die Förderung für manche Betriebe geringer ausfallen.
Schuld daran seien neue Vorhaben, die unter Schlagworten wie Konditionalität oder ECO-Schemes („Öko-Regelungen“) fester Bestandteil der neuen EU-Agrarpolitik werden sollen. Dabei geht es im Wesentlichen um Natur-, Landschafts- und Klimaschutzmaßnahmen, zu denen die Bauern teilweise verpflichtet werden sollen oder deren freiwillige Umsetzung extra entlohnt werden soll. Erosionsschutzmaßnahmen gehören genauso dazu, wie der Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel.
Aufgrund der Niederschlagssituation ging Borst davon aus, dass die neuen Vorgaben für den Erosionsschutz in Nordbayern nicht so ins Gewicht fallen. Trotzdem sei festgelegt, dass, vereinfacht gesagt, immer etwas auf dem Feld stehen muss, entweder eine Zwischenfrucht oder Getreidestoppeln. Eine raue Pflugfurch genüge dann zwischen dem 1 Dezember und dem 15. Januar nicht mehr. Sonderregelungen gebe es allerdings bereits, etwa für „spät räumende Kulturen“ (ab 1. Oktober), wie Körnermais oder Zuckerrüben,
Die geplanten verpflichtenden Stilllegungen von besten Ackerflächen seien auf jeden Fall noch einmal zu hinterfragen, sagte der Landtagsabgeordnete Martin Schöffel. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse muss auf EU-Ebene kurzfristig reagiert werden“, so Schöffel. In der jetzigen Situation stehe die Versorgung im Mittelpunkt. Bleibe zu hoffen, dass die Menschen jetzt wieder den Wert der Landwirtschaft und der eigenen Nahrungsmittelversorgung erkennen.
.jpg) Die
Baumart, die bei der Vermarktung mit rund 90 Prozent
zu Buche schlägt, ist einmal mehr die Fichte,
gefolgt von der Kiefer. Auch sie ist nach den Worten
Dormanns „definitiv kein Zukunftsbaum mehr“.
Ziemlich überlaufen ist er Markt mit Hackschnitzeln.
Die
Baumart, die bei der Vermarktung mit rund 90 Prozent
zu Buche schlägt, ist einmal mehr die Fichte,
gefolgt von der Kiefer. Auch sie ist nach den Worten
Dormanns „definitiv kein Zukunftsbaum mehr“.
Ziemlich überlaufen ist er Markt mit Hackschnitzeln..jpg) Veitlahm.
1985 beginnt die Geschichte eines echten Kleinods im Kulmbacher
Land. Damals hatte Alwin Schneider, der als Entwicklungshelfer in
Ecuador arbeitete, den Patersberghof übernommen. Was bis dahin ein
konventioneller Schweinezuchtbetrieb mit 25 Hektar
landwirtschaftliche Nutzfläche war, wurde von nun an Zug um Zug in
eine Solidarische Landwirtschaft (SoLawi) verwandelt, die heute
Vorbildcharakter hat.
Veitlahm.
1985 beginnt die Geschichte eines echten Kleinods im Kulmbacher
Land. Damals hatte Alwin Schneider, der als Entwicklungshelfer in
Ecuador arbeitete, den Patersberghof übernommen. Was bis dahin ein
konventioneller Schweinezuchtbetrieb mit 25 Hektar
landwirtschaftliche Nutzfläche war, wurde von nun an Zug um Zug in
eine Solidarische Landwirtschaft (SoLawi) verwandelt, die heute
Vorbildcharakter hat..jpg) Auf
dem Patersberghof werden 15 Milchkühe mit dem nachwachsenden
Jungvieh, einige Legehühner und vier Schafe zur Grünlandpflege
gehalten. Die Kühe der Rasse „Fränkisches Gelbvieh“ leben in einem
großzügigen Laufstall am Ortsrand und werden zwei Mal am Tag
gemolken. Eine Besonderheit ist die „muttergebundene
Kälberaufzucht". Dabei sind die Kälber zunächst komplett mit dem
Muttertier in der Herde dabei. Dann kommen sie zu den älteren
Kälbern in einen separaten Stall und haben zunächst zweimal, dann
einmal pro Tag Kontakt zur Mutter. „So kann die Entwöhnung von
Mutter und Kalb langsam erfolgen“, erklärt Christian Jundt.
Insgesamt bekommen die Kälber zwölf Wochen lang Milch.
Auf
dem Patersberghof werden 15 Milchkühe mit dem nachwachsenden
Jungvieh, einige Legehühner und vier Schafe zur Grünlandpflege
gehalten. Die Kühe der Rasse „Fränkisches Gelbvieh“ leben in einem
großzügigen Laufstall am Ortsrand und werden zwei Mal am Tag
gemolken. Eine Besonderheit ist die „muttergebundene
Kälberaufzucht". Dabei sind die Kälber zunächst komplett mit dem
Muttertier in der Herde dabei. Dann kommen sie zu den älteren
Kälbern in einen separaten Stall und haben zunächst zweimal, dann
einmal pro Tag Kontakt zur Mutter. „So kann die Entwöhnung von
Mutter und Kalb langsam erfolgen“, erklärt Christian Jundt.
Insgesamt bekommen die Kälber zwölf Wochen lang Milch.  Bamberg.
Die Stürme der zurückliegenden Tage und Wochen haben in den
oberfränkischen Wäldern immense Schäden hinterlassen. Für Johann
Koch sind sie ein klares Zeichen für den Klimawandel. Trotzdem
glaubt der Waldreferent des Bayerischen Bauernverbandes, fest daran,
dass die Waldbesitzer nicht nur Opfer sind, sondern vielmehr die
Retter des Klimas sein könnten. Voraussetzung dafür sei es, dass
eine nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird. Waldstilllegungen
und neue Schutzgebiete seien der falsche Weg, so Koch bei einer
Veranstaltung des BBV Oberfranken. Bayernweit gibt es etwa 700000
Waldbesitzer. Im Schnitt bewirtschaftet jeder eine Fläche von 2,3
Hektar.
Bamberg.
Die Stürme der zurückliegenden Tage und Wochen haben in den
oberfränkischen Wäldern immense Schäden hinterlassen. Für Johann
Koch sind sie ein klares Zeichen für den Klimawandel. Trotzdem
glaubt der Waldreferent des Bayerischen Bauernverbandes, fest daran,
dass die Waldbesitzer nicht nur Opfer sind, sondern vielmehr die
Retter des Klimas sein könnten. Voraussetzung dafür sei es, dass
eine nachhaltige Forstwirtschaft betrieben wird. Waldstilllegungen
und neue Schutzgebiete seien der falsche Weg, so Koch bei einer
Veranstaltung des BBV Oberfranken. Bayernweit gibt es etwa 700000
Waldbesitzer. Im Schnitt bewirtschaftet jeder eine Fläche von 2,3
Hektar. Kulmbach.
Steigende Zahlen in der Maschinenvermittlung und ein deutlicher
Anstieg in der Betriebshilfe: die Arbeit des Maschinen- und
Betriebshilfsrings Kulmbach ist auch oder gerade in Corona-Zeiten
sehr gefragt. „Die Tendenz zeigt nach oben“, sagt Geschäftsführer
Horst Dupke. Wenn die Jahreshauptversammlung auch diesmal erneut
angesagt werden musste, sind die Verantwortlichen aber trotzdem
optimistisch, Mitte Juni das 60-jährige Bestehen des Maschinenrings
mit einem Tag der Landwirtschaft feiern zu können, und zwar nicht
virtuell, sondern in Präsenz mit Ausstellungen und Aktionen.
Kulmbach.
Steigende Zahlen in der Maschinenvermittlung und ein deutlicher
Anstieg in der Betriebshilfe: die Arbeit des Maschinen- und
Betriebshilfsrings Kulmbach ist auch oder gerade in Corona-Zeiten
sehr gefragt. „Die Tendenz zeigt nach oben“, sagt Geschäftsführer
Horst Dupke. Wenn die Jahreshauptversammlung auch diesmal erneut
angesagt werden musste, sind die Verantwortlichen aber trotzdem
optimistisch, Mitte Juni das 60-jährige Bestehen des Maschinenrings
mit einem Tag der Landwirtschaft feiern zu können, und zwar nicht
virtuell, sondern in Präsenz mit Ausstellungen und Aktionen..jpg) Marktschorgast.
Auf dem Hof der Familie Greim war man schon immer der Zeit voraus:
1988, als das noch keiner so recht ernst nahm stellte Senior Martin
Greim auf Bio um, seitdem gehört der Betrieb dem
Demeter-Anbauverband an. Im Jahr 2000, lange vor dem Boom der
Biogasanlage, wurde auf dem Hof die erste Anlage in Betrieb
genommen, damals noch mit 30, heute aufgerüstet auf 75 kW.
Schließlich wurden ab 2009 Zug und Zug sämtliche Dächer,
mittlerweile sogar die Nordseiten, mit Photovoltaik-Anlagen
ausgestattet. Der erzeugte Strom wird teilweise zum Eigenverbrauch
genutzt, aber größtenteils ins Netz eingespeist. Ein eigenes
Windrad, das wäre noch der Traum, sagt Junior Michael Greim.
Marktschorgast.
Auf dem Hof der Familie Greim war man schon immer der Zeit voraus:
1988, als das noch keiner so recht ernst nahm stellte Senior Martin
Greim auf Bio um, seitdem gehört der Betrieb dem
Demeter-Anbauverband an. Im Jahr 2000, lange vor dem Boom der
Biogasanlage, wurde auf dem Hof die erste Anlage in Betrieb
genommen, damals noch mit 30, heute aufgerüstet auf 75 kW.
Schließlich wurden ab 2009 Zug und Zug sämtliche Dächer,
mittlerweile sogar die Nordseiten, mit Photovoltaik-Anlagen
ausgestattet. Der erzeugte Strom wird teilweise zum Eigenverbrauch
genutzt, aber größtenteils ins Netz eingespeist. Ein eigenes
Windrad, das wäre noch der Traum, sagt Junior Michael Greim.
.jpg) Die
Geschichte des Demeter-Biohofs Greim an seinem jetzigen Standort
hinter dem Marktschorgaster Sportplatz und fast schon in Sichtweite
zu den Landkreisgrenzen in Richtung Bayreuth und Hof, beginnt
eigentlich schon im Jahr 1979. Die Hofstelle lag damals noch mitten
im Ort, die Eigentumsfläche betrug damals zwölf Hektar mit 30 Stück
Vieh. „Als die Flurbereinigung kam, ging es so langsam los“,
erinnert sich Michael, der damals noch ein Kind war. Nach dem Besuch
der Wirtschaftsschule absolvierter er seine Ausbildung zum Landwirt
und schloss mit der damaligen Technikerschule in Bayreuth ab.
Die
Geschichte des Demeter-Biohofs Greim an seinem jetzigen Standort
hinter dem Marktschorgaster Sportplatz und fast schon in Sichtweite
zu den Landkreisgrenzen in Richtung Bayreuth und Hof, beginnt
eigentlich schon im Jahr 1979. Die Hofstelle lag damals noch mitten
im Ort, die Eigentumsfläche betrug damals zwölf Hektar mit 30 Stück
Vieh. „Als die Flurbereinigung kam, ging es so langsam los“,
erinnert sich Michael, der damals noch ein Kind war. Nach dem Besuch
der Wirtschaftsschule absolvierter er seine Ausbildung zum Landwirt
und schloss mit der damaligen Technikerschule in Bayreuth ab.
.jpg) Eine
Vollzeithilfskraft beschäftigt Michael Greim, ansonsten hilft die
Familie, allen voran die Eltern und auch Bruder Dominik, der ganz in
der Nähe einen ökologischen Ackerbaubetrieb mit Schweinehaltung
betreibt. Arbeitsspitzen werden mit Saisonarbeitskräften oder durch
Lohnunternehmer abgedeckt. Die Direktvermarktung hatte die Familie
allerdings schon vor mittlerweile neun Jahren aufgegeben. „Da war
der zeitliche Aufwand dann doch zu groß“, sagt Michael Greim, der
mittlerweile auch schon acht Lehrlinge auf seinem Betrieb
ausgebildet hat.
Eine
Vollzeithilfskraft beschäftigt Michael Greim, ansonsten hilft die
Familie, allen voran die Eltern und auch Bruder Dominik, der ganz in
der Nähe einen ökologischen Ackerbaubetrieb mit Schweinehaltung
betreibt. Arbeitsspitzen werden mit Saisonarbeitskräften oder durch
Lohnunternehmer abgedeckt. Die Direktvermarktung hatte die Familie
allerdings schon vor mittlerweile neun Jahren aufgegeben. „Da war
der zeitliche Aufwand dann doch zu groß“, sagt Michael Greim, der
mittlerweile auch schon acht Lehrlinge auf seinem Betrieb
ausgebildet hat..jpg) Von
der großen Politik, aber auch von der Kommunalpolitik, würde sich
Michael Greim nur eines wünschen, dass sie endlich hinter den Bauern
steht. Seiner eigenen Verantwortung ist sich Michael Greim durchaus
bewusst: „Dem Klimawandel müssen wir uns stellen“, sagte er und
denkt dabei an das absolute Trockenjahr 2018, das damals vielen
Landwirten schwer zu schaffen gemacht hatte.
Von
der großen Politik, aber auch von der Kommunalpolitik, würde sich
Michael Greim nur eines wünschen, dass sie endlich hinter den Bauern
steht. Seiner eigenen Verantwortung ist sich Michael Greim durchaus
bewusst: „Dem Klimawandel müssen wir uns stellen“, sagte er und
denkt dabei an das absolute Trockenjahr 2018, das damals vielen
Landwirten schwer zu schaffen gemacht hatte. Münchberg.
Beim Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg stehen die Zeichen
auf Wechsel. Nicht nur Vorstand Siegfried Hüttner aus Mühldorf bei
Schauenstein wird nach 15 Jahren im Amt bei den anstehenden
Neuwahlen in diesem Jahr nicht mehr antreten, auch Geschäftsführer
Patrick Heerdegen wechselt bereits im März an die
Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken nach
Bayreuth.
Münchberg.
Beim Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg stehen die Zeichen
auf Wechsel. Nicht nur Vorstand Siegfried Hüttner aus Mühldorf bei
Schauenstein wird nach 15 Jahren im Amt bei den anstehenden
Neuwahlen in diesem Jahr nicht mehr antreten, auch Geschäftsführer
Patrick Heerdegen wechselt bereits im März an die
Landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Oberfranken nach
Bayreuth.  Bayreuth.
Die Kritik an den Geschäftspraktiken des Lebensmitteleinzelhandels
wächst. Nach den Demonstrationen der Landwirte vor den Aldi-Filialen
in den zurückliegenden Tagen fanden auch beim Bayreuther
Online-Bauerntag sämtliche Redner klare Worte. Es könne nicht sein,
so hieß es, dass immer höhere Anforderungen an die Bauern gestellt
werden, aber immer weniger bei den Landwirten hängen bleibt.
Bayreuth.
Die Kritik an den Geschäftspraktiken des Lebensmitteleinzelhandels
wächst. Nach den Demonstrationen der Landwirte vor den Aldi-Filialen
in den zurückliegenden Tagen fanden auch beim Bayreuther
Online-Bauerntag sämtliche Redner klare Worte. Es könne nicht sein,
so hieß es, dass immer höhere Anforderungen an die Bauern gestellt
werden, aber immer weniger bei den Landwirten hängen bleibt. Aufseß.
Eine verstärkte Nachfrage nach seinem Beratungsangebot stellt der
Maschinenring Fränkische Schweiz fest. „Wir müssen an den Leuten
dranbleiben und unsere Volksnähe beibehalten, aber gleichzeitig auch
verstärkt über den Tellerrand blicken“, sagt Geschäftsführer Manuel
Appel. Trotz Corona kann der Ring mit Sitz in Aufseß auf ein
erfolgreiches Jahr zurückblicken. „Corona hat uns wenig
beeinträchtigt, die Arbeit in der Landwirtschaft muss schließlich
weitergehen“, so der Vorsitzende Bernhard Hack aus Weilersbach.
Aufseß.
Eine verstärkte Nachfrage nach seinem Beratungsangebot stellt der
Maschinenring Fränkische Schweiz fest. „Wir müssen an den Leuten
dranbleiben und unsere Volksnähe beibehalten, aber gleichzeitig auch
verstärkt über den Tellerrand blicken“, sagt Geschäftsführer Manuel
Appel. Trotz Corona kann der Ring mit Sitz in Aufseß auf ein
erfolgreiches Jahr zurückblicken. „Corona hat uns wenig
beeinträchtigt, die Arbeit in der Landwirtschaft muss schließlich
weitergehen“, so der Vorsitzende Bernhard Hack aus Weilersbach..jpg) Oberlangenroth.
„Wir haben keine großen Hobbys, außer der Landwirtschaft“. In diesem
Punkt sind sich Christoph und Michael Jurkat absolut einig. Zusammen
mit den Eltern Rosa und Ulrich bewirtschaften sie das Gut
Oberlangenroth, das zur Gemeinde Neuenmarkt gehört und das eine
Jahrtausend alte Tradition besitzt. Ein Blick auf das breite
Tätigkeitsfeld, in dem sich der über 100 Hektar große Betrieb
bewegt, zeigt allerdings schnell, dass es sich bei dem Gutshof und
weit mehr als um eine Hobby-Landwirtschaft, sondern um einen überaus
professionellen Betrieb handelt.
Oberlangenroth.
„Wir haben keine großen Hobbys, außer der Landwirtschaft“. In diesem
Punkt sind sich Christoph und Michael Jurkat absolut einig. Zusammen
mit den Eltern Rosa und Ulrich bewirtschaften sie das Gut
Oberlangenroth, das zur Gemeinde Neuenmarkt gehört und das eine
Jahrtausend alte Tradition besitzt. Ein Blick auf das breite
Tätigkeitsfeld, in dem sich der über 100 Hektar große Betrieb
bewegt, zeigt allerdings schnell, dass es sich bei dem Gutshof und
weit mehr als um eine Hobby-Landwirtschaft, sondern um einen überaus
professionellen Betrieb handelt..jpg) Nebenerwerb
bedeutet aber auch, dass sie sich nahezu jede freie Minute um den
Ackerbau, das Grünland und die Tiere kümmern. Vater Ulrich (68) ist
der Herr der Brennerei, Mutter Rosa, die hauptberuflich in der
Landwirtschaftsverwaltung tätig ist, verarbeitet die Brände und das
Obst, bereitet die Fruchtaufstriche zu und organisiert Blumenfelder,
Hofladen und das kleine Verkaufshäuschen an der
Gemeindeverbindungsstraße zwischen See und Neuenmarkt.
Nebenerwerb
bedeutet aber auch, dass sie sich nahezu jede freie Minute um den
Ackerbau, das Grünland und die Tiere kümmern. Vater Ulrich (68) ist
der Herr der Brennerei, Mutter Rosa, die hauptberuflich in der
Landwirtschaftsverwaltung tätig ist, verarbeitet die Brände und das
Obst, bereitet die Fruchtaufstriche zu und organisiert Blumenfelder,
Hofladen und das kleine Verkaufshäuschen an der
Gemeindeverbindungsstraße zwischen See und Neuenmarkt..jpg) Nicht
aufgegeben hat man die biologische Färsenmast, die Tiere gehören der
Rasse Fleckvieh an. Außer einer kurzen Winterstallphase, in der die
rund 40 Kühe über einen großzügigen Außenfreilaufbereich verfügen,
verbringen sie das Jahr über auf der vier Hektar großen Weidefläche.
Daneben gibt es auch einen 14 Hektar großen Wald ganz unmittelbar in
der Nähe. In Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt wurden
Biotopbäume ausgewiesen. Damit hat sich die Familie verpflichtet,
diese Bäume nicht zu fällen, um Lebensraum für seltene Tiere wie den
Specht zu erhalten. Baum- und Heckenschnitt werden in der hofeigenen
Hackschnitzelheizung verwertet.
Nicht
aufgegeben hat man die biologische Färsenmast, die Tiere gehören der
Rasse Fleckvieh an. Außer einer kurzen Winterstallphase, in der die
rund 40 Kühe über einen großzügigen Außenfreilaufbereich verfügen,
verbringen sie das Jahr über auf der vier Hektar großen Weidefläche.
Daneben gibt es auch einen 14 Hektar großen Wald ganz unmittelbar in
der Nähe. In Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsamt wurden
Biotopbäume ausgewiesen. Damit hat sich die Familie verpflichtet,
diese Bäume nicht zu fällen, um Lebensraum für seltene Tiere wie den
Specht zu erhalten. Baum- und Heckenschnitt werden in der hofeigenen
Hackschnitzelheizung verwertet..jpg) Wickenreuth.
Sechs Stunden am Tag komplett mit den Tieren beschäftigt, dazu kommt
die Außenwirtschaft, 125 Hektar wollen schließlich bewirtschaftet
werden, wenn der Ertrag und die Qualität stimmen soll. Doch für Hans
Hermann Reinhardt aus Wickenreuth bei Kulmbach ist die
Landwirtschaft viel mehr als nur sein Beruf. „Es macht einfach
Spaß“, sagt er, trotz aller Probleme und Herausforderungen, denen
sich die Bauern tagtäglich stellen müssen.
Wickenreuth.
Sechs Stunden am Tag komplett mit den Tieren beschäftigt, dazu kommt
die Außenwirtschaft, 125 Hektar wollen schließlich bewirtschaftet
werden, wenn der Ertrag und die Qualität stimmen soll. Doch für Hans
Hermann Reinhardt aus Wickenreuth bei Kulmbach ist die
Landwirtschaft viel mehr als nur sein Beruf. „Es macht einfach
Spaß“, sagt er, trotz aller Probleme und Herausforderungen, denen
sich die Bauern tagtäglich stellen müssen. .jpg) Schon
1987 hatte der inzwischen verstorbene Vater einen neuen Stall,
damals für 25 Kühe, errichtet. 1997, und damit lange vor der
jetzigen Diskussion um die Anbindehaltung, baute Hans Hermann
Reinhardt den Stall zum Laufstall um, 2010 kam ein Laufhof für die
Kühe im Freien dazu. „Mehr geht halt am Standort leider nicht, denn
sonst müsste man komplett neu bauen“, sagt Hans Hermann Reinhardt.
Auch der Umstieg auf ökologischen Landbau ist wegen fehlender
Weideflächen nicht durchführbar. Überhaupt hält er nichts von der
Bevorzugung der biologischen Wirtschaftsweise durch die Politik und
weite Teile der Öffentlichkeit, zum Beispiel durch überzogene
Förderungen. „Ehrlich ist das nicht“, stellt er unmissverständlich
fest.
Schon
1987 hatte der inzwischen verstorbene Vater einen neuen Stall,
damals für 25 Kühe, errichtet. 1997, und damit lange vor der
jetzigen Diskussion um die Anbindehaltung, baute Hans Hermann
Reinhardt den Stall zum Laufstall um, 2010 kam ein Laufhof für die
Kühe im Freien dazu. „Mehr geht halt am Standort leider nicht, denn
sonst müsste man komplett neu bauen“, sagt Hans Hermann Reinhardt.
Auch der Umstieg auf ökologischen Landbau ist wegen fehlender
Weideflächen nicht durchführbar. Überhaupt hält er nichts von der
Bevorzugung der biologischen Wirtschaftsweise durch die Politik und
weite Teile der Öffentlichkeit, zum Beispiel durch überzogene
Förderungen. „Ehrlich ist das nicht“, stellt er unmissverständlich
fest. Breitengüßbach/Himmelkron/Hollfeld.
Gegen das Preisdumping bei Aldi haben Landwirte aus dem Raum Bamberg
protestiert. Mit Schleppern und Transparenten zogen sie vor die
Filiale des Discounters in Breitengüßbach (Landkreis Bamberg),
Himmelkron (Landkreis Kulmbach) und Hollfeld (Landkreis Bayreuth)
und machten ihrem Ärger Luft. Corona-bedingt fanden die Aktionen
ganz bewusst nicht im großen Stil statt. Allerdings gab es auch an
vielen anderen Orten Bayerns ähnliche Proteste.
Breitengüßbach/Himmelkron/Hollfeld.
Gegen das Preisdumping bei Aldi haben Landwirte aus dem Raum Bamberg
protestiert. Mit Schleppern und Transparenten zogen sie vor die
Filiale des Discounters in Breitengüßbach (Landkreis Bamberg),
Himmelkron (Landkreis Kulmbach) und Hollfeld (Landkreis Bayreuth)
und machten ihrem Ärger Luft. Corona-bedingt fanden die Aktionen
ganz bewusst nicht im großen Stil statt. Allerdings gab es auch an
vielen anderen Orten Bayerns ähnliche Proteste. Der
Bayreuther Kreisobmann Karl Lappe kritisierte auch, dass
Markenhersteller mittlerweile bedrängt werden, für ihre Produkte
weniger zu verlangen, als sie für Produkte erhalten, die unter dem
Eigennamen der Discounter verkauft werden. Bei den Eigenmarken sei
der Produzent aber völlig austauschbar und der Verbraucher könne in
der Regel gar nicht nachvollziehen, woher das Produkt kommt.
Kreisbäuerin Angelika Seyfferth sprach genauso wie ihre Kulmbacher
Kollegin Beate Opel von einem Etikettenschwindel, der auf den Rücken
der Bauern ausgetragen werde.
Der
Bayreuther Kreisobmann Karl Lappe kritisierte auch, dass
Markenhersteller mittlerweile bedrängt werden, für ihre Produkte
weniger zu verlangen, als sie für Produkte erhalten, die unter dem
Eigennamen der Discounter verkauft werden. Bei den Eigenmarken sei
der Produzent aber völlig austauschbar und der Verbraucher könne in
der Regel gar nicht nachvollziehen, woher das Produkt kommt.
Kreisbäuerin Angelika Seyfferth sprach genauso wie ihre Kulmbacher
Kollegin Beate Opel von einem Etikettenschwindel, der auf den Rücken
der Bauern ausgetragen werde. In Bamberg
bekamen die Landwirte vom Discounter ein Hausverbot ausgesprochen,
obwohl die Aktion vom Landratsamt mit zehn Teilnehmern und zwei
Schleppern genehmigt wurde. Die Bauern ließen sich davon aber nicht
beirren. Auch nicht von den beiden Polizeifahrzeugen, mit jeweils
zwei Beamten, die schon lange vor der Aktion aufgefahren waren und
das Geschehen genau beobachteten. In Himmelkron und Hollfeld gab es
dagegen keine Probleme, was wohl auch daran lag, dass dort bewusst
nur eine jeweils kleine Gruppe mit einem einzigen Schleppern auf den
Parkplätzen vorgefahren war.
In Bamberg
bekamen die Landwirte vom Discounter ein Hausverbot ausgesprochen,
obwohl die Aktion vom Landratsamt mit zehn Teilnehmern und zwei
Schleppern genehmigt wurde. Die Bauern ließen sich davon aber nicht
beirren. Auch nicht von den beiden Polizeifahrzeugen, mit jeweils
zwei Beamten, die schon lange vor der Aktion aufgefahren waren und
das Geschehen genau beobachteten. In Himmelkron und Hollfeld gab es
dagegen keine Probleme, was wohl auch daran lag, dass dort bewusst
nur eine jeweils kleine Gruppe mit einem einzigen Schleppern auf den
Parkplätzen vorgefahren war..jpg) Kleinrehmühle.
Das ist der Idealfall regionaler Vermarktung: „Der Bedarf ist so
groß, dass wir über einen Umkreis von höchstens 100 Kilometer hinaus
gar nicht verkaufen“, sagt Daniel Wagner von der Fischzucht
Kleinrehmühle. Viele der produzierten Fische gehen an die eigene
Ausflugsgaststätte vor Ort. Damit fällt überhaupt kein Transportweg
an, mehr Tierwohl geht nicht.
Kleinrehmühle.
Das ist der Idealfall regionaler Vermarktung: „Der Bedarf ist so
groß, dass wir über einen Umkreis von höchstens 100 Kilometer hinaus
gar nicht verkaufen“, sagt Daniel Wagner von der Fischzucht
Kleinrehmühle. Viele der produzierten Fische gehen an die eigene
Ausflugsgaststätte vor Ort. Damit fällt überhaupt kein Transportweg
an, mehr Tierwohl geht nicht. Bayreuth.
Trotz Corona und aller damit verbundenen Einschränkungen konnte der
Rinderzuchtverband Oberfranken sein Ergebnis im zurückliegenden
Zuchtjahr um 1,6 Millionen Euro auf insgesamt rund 16,5 Millionen
Euro steigern. Das ist umso erfreulicher, als dass in den
vergangenen beiden Jahren das Ergebnis rückläufig war. Wie aus dem
druckfrisch vorliegenden Jahresbericht hervorgeht, sind die
Vermarktungszahlen um gut 500 auf exakt 30968 Tiere aller Kategorien
(Nutzkälber, Zuchtkälber, Jungrinder, Jungkühe und Bullen)
gestiegen. Das Geschäftsjahr des Rinderzuchtverbandes ist nicht
identisch mit dem Kalenderjahr. Es beginnt am 1. Oktober und endet
am 30. September.
Bayreuth.
Trotz Corona und aller damit verbundenen Einschränkungen konnte der
Rinderzuchtverband Oberfranken sein Ergebnis im zurückliegenden
Zuchtjahr um 1,6 Millionen Euro auf insgesamt rund 16,5 Millionen
Euro steigern. Das ist umso erfreulicher, als dass in den
vergangenen beiden Jahren das Ergebnis rückläufig war. Wie aus dem
druckfrisch vorliegenden Jahresbericht hervorgeht, sind die
Vermarktungszahlen um gut 500 auf exakt 30968 Tiere aller Kategorien
(Nutzkälber, Zuchtkälber, Jungrinder, Jungkühe und Bullen)
gestiegen. Das Geschäftsjahr des Rinderzuchtverbandes ist nicht
identisch mit dem Kalenderjahr. Es beginnt am 1. Oktober und endet
am 30. September. Bamberg.
Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die
Forstwirtschaft. Das sagt Hans-Joachim Klemmt, neuer Leiter der
Abteilung Waldbau und Bergwald an der Landesanstalt für Wald- und
Forstwirtschaft in Freising-Weihenstephan. Einzige wirksame Maßnahme
ist dabei der frühzeitige Aufbau klimastabiler und zukunftsfähiger
Wälder, so der Fachmann bei einer Online-Veranstaltungsreihe zum
Thema Klima des BBV Oberfranken.
Bamberg.
Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die
Forstwirtschaft. Das sagt Hans-Joachim Klemmt, neuer Leiter der
Abteilung Waldbau und Bergwald an der Landesanstalt für Wald- und
Forstwirtschaft in Freising-Weihenstephan. Einzige wirksame Maßnahme
ist dabei der frühzeitige Aufbau klimastabiler und zukunftsfähiger
Wälder, so der Fachmann bei einer Online-Veranstaltungsreihe zum
Thema Klima des BBV Oberfranken.  Neudorf.
Ihren Viehbestand haben sie schon drastisch reduziert. Waren es im
Herbst noch 350 Schweine auf dem Ferkelerzeugungsbetrieb von Dagmar
und Jörg Deinlein in Neudorf, nahe Scheßlitz, sind es mittlerweile
nur mehr 190. Die Preise sind einfach zu schlecht. Wie es
weitergehen soll, ist völlig offen. „Die ständig neuen Anforderungen
machen uns schon schwer zu schaffen“, sagte Jörg Deinlein beim
„Stallgespräch“ des BBV Bamberg.
Neudorf.
Ihren Viehbestand haben sie schon drastisch reduziert. Waren es im
Herbst noch 350 Schweine auf dem Ferkelerzeugungsbetrieb von Dagmar
und Jörg Deinlein in Neudorf, nahe Scheßlitz, sind es mittlerweile
nur mehr 190. Die Preise sind einfach zu schlecht. Wie es
weitergehen soll, ist völlig offen. „Die ständig neuen Anforderungen
machen uns schon schwer zu schaffen“, sagte Jörg Deinlein beim
„Stallgespräch“ des BBV Bamberg..jpg) Stadtsteinach.
Aus der Region für die Region: das könnte ein Slogan sein, mit dem
Dirk Partheimüller Werbung für seine Produkte macht. Doch der
Inhaber der historischen Partheimühle in Stadtsteinach hat das ganz
nicht nötig. Über ein gutes Dutzend Landwirte aus den Landkreisen
Bayreuth, Kronach und Kulmbach gehören seit eh und je zu seinen
Lieferanten. Das Korn kommt also von den Feldern der Region. Das
produzierte Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl findet nahezu
ausschließlich in Bäckereien und Pizzerien Oberfrankens Verwendung.
Nahezu heißt, dass auch Privatleute ihr Mehl entweder direkt beim
Partheimüller oder bei Rewe- und Edeka-Märkten in und um Kulmbach
erwerben können.
Stadtsteinach.
Aus der Region für die Region: das könnte ein Slogan sein, mit dem
Dirk Partheimüller Werbung für seine Produkte macht. Doch der
Inhaber der historischen Partheimühle in Stadtsteinach hat das ganz
nicht nötig. Über ein gutes Dutzend Landwirte aus den Landkreisen
Bayreuth, Kronach und Kulmbach gehören seit eh und je zu seinen
Lieferanten. Das Korn kommt also von den Feldern der Region. Das
produzierte Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl findet nahezu
ausschließlich in Bäckereien und Pizzerien Oberfrankens Verwendung.
Nahezu heißt, dass auch Privatleute ihr Mehl entweder direkt beim
Partheimüller oder bei Rewe- und Edeka-Märkten in und um Kulmbach
erwerben können..jpg) Feste
und zuverlässige Lieferanten, „auf die man sich verlassen kann“, das
ist für Dirk Partheimüller wichtig. Schließlich hat auch er mit
stark schwankenden Rohstoffpreisen zu tun, wenn zum Beispiel wie im
zurückliegenden Jahr die Preise gewaltig steigen, weil deutsches
Getreide ins Ausland abwandert.
Feste
und zuverlässige Lieferanten, „auf die man sich verlassen kann“, das
ist für Dirk Partheimüller wichtig. Schließlich hat auch er mit
stark schwankenden Rohstoffpreisen zu tun, wenn zum Beispiel wie im
zurückliegenden Jahr die Preise gewaltig steigen, weil deutsches
Getreide ins Ausland abwandert. .jpg) Dirk
Partheimüller stellt bereits die 18. Generation in diesem
außergewöhnlichen Familienbetrieb. Mit seiner Frau Sonja hat der
54-Jährige schon für die nächste Generation vorgesorgt, Sohn Luca
(14) kennt sich im Betrieb jedenfalls bestens aus.
Dirk
Partheimüller stellt bereits die 18. Generation in diesem
außergewöhnlichen Familienbetrieb. Mit seiner Frau Sonja hat der
54-Jährige schon für die nächste Generation vorgesorgt, Sohn Luca
(14) kennt sich im Betrieb jedenfalls bestens aus. .jpg) Was
bei vielen Bauern der Hofladen, ist bei Dirk Partheimüller das
Mühlenlädla gleich am Eingang, das täglich geöffnet hat. Im Angebot
hat er auch die Produkte der befreundeten Minderleinsmühle bei
Neunkirchen am Brand. Dirk Partheimüller hat auch beobachtet, dass
gerade jüngere Leute verstärkt wieder selbst backen, eine
Entwicklung, die durch Corona noch forciert worden ist und die der
Stadtsteinacher Partheimühle nur zu Gute kommt.
Was
bei vielen Bauern der Hofladen, ist bei Dirk Partheimüller das
Mühlenlädla gleich am Eingang, das täglich geöffnet hat. Im Angebot
hat er auch die Produkte der befreundeten Minderleinsmühle bei
Neunkirchen am Brand. Dirk Partheimüller hat auch beobachtet, dass
gerade jüngere Leute verstärkt wieder selbst backen, eine
Entwicklung, die durch Corona noch forciert worden ist und die der
Stadtsteinacher Partheimühle nur zu Gute kommt. Ottowind.
Die Schweinerhalter sind seit Monaten die eigentlichen Sorgenkinder.
„Derzeit werden die Kosten nicht annähernd gedeckt“, sagte der
Coburger Kreisobmann Martin Flohrschütz beim traditionellen
Pressegespräch, das viele Kreisverbände alljährlich im Umfeld der
Grünen Woche veranstalten. Wenn es heuer Corona-bedingt auch schon
zum zweiten Mal hintereinander keine Grüne Woche gibt, so hält der
BBV trotzdem an seinen „Stallgesprächen“ fest, um auf die
dringendsten Probleme der Branche hinzuweisen.
Ottowind.
Die Schweinerhalter sind seit Monaten die eigentlichen Sorgenkinder.
„Derzeit werden die Kosten nicht annähernd gedeckt“, sagte der
Coburger Kreisobmann Martin Flohrschütz beim traditionellen
Pressegespräch, das viele Kreisverbände alljährlich im Umfeld der
Grünen Woche veranstalten. Wenn es heuer Corona-bedingt auch schon
zum zweiten Mal hintereinander keine Grüne Woche gibt, so hält der
BBV trotzdem an seinen „Stallgesprächen“ fest, um auf die
dringendsten Probleme der Branche hinzuweisen. Bad
Staffelstein/Marktleuthen. Der Deutsche Wetterdienst sucht in
Oberfranken einen Wetterbeobachter. Hintergrund ist, dass Waldfried
Männlein aus Königsfeld im Landkreis Bamberg aus Altersgründen seine
ehrenamtliche Tätigkeit vor kurzem eingestellt hat. Er betreute
zuletzt eine der ältesten Stationen überhaupt, die bereits im Jahr
1899 ihren Betrieb aufgenommen hatte.
Bad
Staffelstein/Marktleuthen. Der Deutsche Wetterdienst sucht in
Oberfranken einen Wetterbeobachter. Hintergrund ist, dass Waldfried
Männlein aus Königsfeld im Landkreis Bamberg aus Altersgründen seine
ehrenamtliche Tätigkeit vor kurzem eingestellt hat. Er betreute
zuletzt eine der ältesten Stationen überhaupt, die bereits im Jahr
1899 ihren Betrieb aufgenommen hatte.  Die
Station selbst ist eigentlich ganz unscheinbar mit Erdbodenfeld,
Niederschlags- und Luftfeuchtigkeitsmesser. Vollautomatisch wird
hier 320 Meter über Normalnull die Lufttemperatur fünf Zentimeter
über dem Boden gemessen, werden Frosttemperaturen festgestellt und
die Regenmengen bestimmt.
Die
Station selbst ist eigentlich ganz unscheinbar mit Erdbodenfeld,
Niederschlags- und Luftfeuchtigkeitsmesser. Vollautomatisch wird
hier 320 Meter über Normalnull die Lufttemperatur fünf Zentimeter
über dem Boden gemessen, werden Frosttemperaturen festgestellt und
die Regenmengen bestimmt. .jpg) Waldau.
„Gesunde Lebensmittel in den eigenen Teichen zu produzieren, das
erfüllt einen auch mit Stolz“, sagt Edwin Hartmann (66) aus Waldau.
Sein Lebensmittel sind die Karpfen, die in den vier eigenen Teichen
am Ortsrand des Neudrossenfelder Gemeindeteils heranreifen.
Vermarktet werden sie im Wesentlichen über die für ihre
Fischspezialitäten weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannte und
bereits mehrfach ausgezeichnete Gaststätte Fuchs direkt in der
Nachbarschaft der Familie Hartmann. Noch kürzer können Transportwege
kaum ausfallen, liegen doch zwischen Teich und Wirtshaus nicht
einmal 500 Meter Luftlinie.
Waldau.
„Gesunde Lebensmittel in den eigenen Teichen zu produzieren, das
erfüllt einen auch mit Stolz“, sagt Edwin Hartmann (66) aus Waldau.
Sein Lebensmittel sind die Karpfen, die in den vier eigenen Teichen
am Ortsrand des Neudrossenfelder Gemeindeteils heranreifen.
Vermarktet werden sie im Wesentlichen über die für ihre
Fischspezialitäten weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannte und
bereits mehrfach ausgezeichnete Gaststätte Fuchs direkt in der
Nachbarschaft der Familie Hartmann. Noch kürzer können Transportwege
kaum ausfallen, liegen doch zwischen Teich und Wirtshaus nicht
einmal 500 Meter Luftlinie..jpg) Die
eigene Teichanlage besteht aus vier Karpfenweihern mit einer
Gesamtwasserfläche von einem Hektar. Der erste Teich wurde bereits
1982 gebaut und bereits mehrfach erweitert. 1990 und in den Jahren
2019 und 2020 entstanden die weiteren drei Weiher, die jeder
Autofahrer kennt, der auf der A70 kurz nach der Auffahrt
Kulmbach/Neudrossenfeld in Richtung Bayreuth unterwegs ist.
Die
eigene Teichanlage besteht aus vier Karpfenweihern mit einer
Gesamtwasserfläche von einem Hektar. Der erste Teich wurde bereits
1982 gebaut und bereits mehrfach erweitert. 1990 und in den Jahren
2019 und 2020 entstanden die weiteren drei Weiher, die jeder
Autofahrer kennt, der auf der A70 kurz nach der Auffahrt
Kulmbach/Neudrossenfeld in Richtung Bayreuth unterwegs ist..jpg) In
einem guten Jahr werden bis zu 500 kg schlachtreife dreijährige
Karpfen (K3) geerntet und verkauft. „Das sind zwischen 250 und 300
Karpfen“, sagt Edwin Hartmann. Wenn etwas für den Eigenbedarf übrig
bleibt, kommen die von Ehefrau Claudia zubereiteten Karpfen blau,
gebacken oder heiß geräuchert gerne auch auf den heimischen Tisch.
Heuer seien es allerdings deutlich weniger Karpfen gewesen, da die
Temperaturen den Sommer über einfach zu kalt waren. Auch in den
beiden Jahren davor habe es aufgrund der Trockenheit eine geringere
Ausbeute gegeben.
In
einem guten Jahr werden bis zu 500 kg schlachtreife dreijährige
Karpfen (K3) geerntet und verkauft. „Das sind zwischen 250 und 300
Karpfen“, sagt Edwin Hartmann. Wenn etwas für den Eigenbedarf übrig
bleibt, kommen die von Ehefrau Claudia zubereiteten Karpfen blau,
gebacken oder heiß geräuchert gerne auch auf den heimischen Tisch.
Heuer seien es allerdings deutlich weniger Karpfen gewesen, da die
Temperaturen den Sommer über einfach zu kalt waren. Auch in den
beiden Jahren davor habe es aufgrund der Trockenheit eine geringere
Ausbeute gegeben..jpg) Die
Freude und der Erfolg in der Teichwirtschaft würden allerdings von
mehreren Fischprädatoren getrübt, sagt Edwin Hartmann. Neben Grau-
und Silberreiher dezimieren alljährlich auch Kormorane die
eingesetzten Fische. 2016 wurde die Teichanlage von Bibern
heimgesucht, dabei wurden die Teichdämme durch eine Vielzahl von
Biberröhren zerstört. „Die haben immensen Schaden angerichtet“,
erinnert sich der Teichwirt. Erst nach der vom Landratsamt Kulmbach
genehmigten Entnahme konnte diesem Spuk ein Ende bereitet werden.
Zwar sei er zu einem gewissen Teil finanziell entschädigt worden,
der Arbeitsaufwand sei aber trotzdem enorm gewesen. Auch Spuren des
Fischotters wurden im vorbei fließenden Schlitterbach schon
gesichtet.
Die
Freude und der Erfolg in der Teichwirtschaft würden allerdings von
mehreren Fischprädatoren getrübt, sagt Edwin Hartmann. Neben Grau-
und Silberreiher dezimieren alljährlich auch Kormorane die
eingesetzten Fische. 2016 wurde die Teichanlage von Bibern
heimgesucht, dabei wurden die Teichdämme durch eine Vielzahl von
Biberröhren zerstört. „Die haben immensen Schaden angerichtet“,
erinnert sich der Teichwirt. Erst nach der vom Landratsamt Kulmbach
genehmigten Entnahme konnte diesem Spuk ein Ende bereitet werden.
Zwar sei er zu einem gewissen Teil finanziell entschädigt worden,
der Arbeitsaufwand sei aber trotzdem enorm gewesen. Auch Spuren des
Fischotters wurden im vorbei fließenden Schlitterbach schon
gesichtet..jpg) Gößmannsreuth.
Der Blick über den Tellerrand, das ist heute das Wichtigste für
jeden landwirtschaftlichen Unternehmer. Gerhard Reif aus
Gößmannsreuth, weiß ganz genau, wovon er spricht. Sein Betrieb hat
sich seit der Übernahme 1997 vom kleinen Bauernhof zum breit
aufgestellten landwirtschaftlichen Unternehmen entwickelt und ist
durch Höhen und Tiefen gegangen. „Man muss neue Wege gehen und sich
auch mal was trauen“, sagt der 55-Jährige. Ein „weiter so“ werde
heute nicht mehr funktionieren. Dafür sei schon die Zeit viel zu
schnelllebig geworden.
Gößmannsreuth.
Der Blick über den Tellerrand, das ist heute das Wichtigste für
jeden landwirtschaftlichen Unternehmer. Gerhard Reif aus
Gößmannsreuth, weiß ganz genau, wovon er spricht. Sein Betrieb hat
sich seit der Übernahme 1997 vom kleinen Bauernhof zum breit
aufgestellten landwirtschaftlichen Unternehmen entwickelt und ist
durch Höhen und Tiefen gegangen. „Man muss neue Wege gehen und sich
auch mal was trauen“, sagt der 55-Jährige. Ein „weiter so“ werde
heute nicht mehr funktionieren. Dafür sei schon die Zeit viel zu
schnelllebig geworden..jpg) Der
erstmalige Anbau von Sonnenblumen auf 20 Hektar in diesem Jahr sei
ein vielversprechender Versuch gewesen, einmal eine neue Kultur zu
testen. Gefragt sind die Kerne nicht nur in der Backindustrie oder
bei Müsliherstellern, sondern auch bei Privatleuten als Vogelfutter.
Die Ein-, Fünf- oder 15-Kilo-Säcke gehen jedenfalls ganz gut weg und
das blühende Sonnenblumenfeld hat den ganzen Sommer über als prima
Kulisse für private Fotoshootings gedient.
Der
erstmalige Anbau von Sonnenblumen auf 20 Hektar in diesem Jahr sei
ein vielversprechender Versuch gewesen, einmal eine neue Kultur zu
testen. Gefragt sind die Kerne nicht nur in der Backindustrie oder
bei Müsliherstellern, sondern auch bei Privatleuten als Vogelfutter.
Die Ein-, Fünf- oder 15-Kilo-Säcke gehen jedenfalls ganz gut weg und
das blühende Sonnenblumenfeld hat den ganzen Sommer über als prima
Kulisse für private Fotoshootings gedient..jpg) Ködnitz.
„Ich war zehn Jahre lang nur unterwegs“, sagt Michael Sack. Jetzt,
mit 34, ist er angekommen, und zwar auf dem Maierhof, ein Einzelhof
nahe der Kulmbacher Stadtgrenze, der zur Gemeinde Ködnitz gehört.
2016 hat er den Betrieb, den bis dahin seine Eltern Anita und
Gerhard Sack führten, übernommen. Der Milchviehbetrieb mit
ausgelagertem Jungvieh und dem Schwerpunkt Futterbau ist seitdem zum
Lebensmittelpunkt geworden.
Ködnitz.
„Ich war zehn Jahre lang nur unterwegs“, sagt Michael Sack. Jetzt,
mit 34, ist er angekommen, und zwar auf dem Maierhof, ein Einzelhof
nahe der Kulmbacher Stadtgrenze, der zur Gemeinde Ködnitz gehört.
2016 hat er den Betrieb, den bis dahin seine Eltern Anita und
Gerhard Sack führten, übernommen. Der Milchviehbetrieb mit
ausgelagertem Jungvieh und dem Schwerpunkt Futterbau ist seitdem zum
Lebensmittelpunkt geworden. .jpg) Jetzt
bewirtschaftet Michael Sack den Betrieb mit seinen 120 Kühen im
Stall und einer Fläche von 80 Hektar, auf der Hauptsächlich
Kleegras, Mais und Roggen angebaut werden. Vater Gerhard wird noch
kräftig eingesetzt, Mutter Anita hat seit der Wahl zur Ködnitzer
Bürgermeisterin im März 2020 nur noch wenig Zeit, managt aber noch
immer die vier Ferienwohnungen direkt auf dem Hof. Die Wohnungen
sind komplett im fränkischen Stil gehalten und tragen Namen wie
Schwalbennest, Kuckucksnest, Spatzennest oder Taubenschlag. Dazu
kommen noch zwei geringfügig Beschäftigte, die mithelfen, den
Betrieb am Laufen zu halten.
Jetzt
bewirtschaftet Michael Sack den Betrieb mit seinen 120 Kühen im
Stall und einer Fläche von 80 Hektar, auf der Hauptsächlich
Kleegras, Mais und Roggen angebaut werden. Vater Gerhard wird noch
kräftig eingesetzt, Mutter Anita hat seit der Wahl zur Ködnitzer
Bürgermeisterin im März 2020 nur noch wenig Zeit, managt aber noch
immer die vier Ferienwohnungen direkt auf dem Hof. Die Wohnungen
sind komplett im fränkischen Stil gehalten und tragen Namen wie
Schwalbennest, Kuckucksnest, Spatzennest oder Taubenschlag. Dazu
kommen noch zwei geringfügig Beschäftigte, die mithelfen, den
Betrieb am Laufen zu halten..jpg) Schon
Vater Gerhard wollte immer auf ökologischen Landbau umstellen. Doch
erst mit dem neuen Stall, der von vornherein auf 120 Milchkühe
ausgelegt war, wurde die Umstellung mit Hilfe des
Bioland-Anbauverbandes Wirklichkeit. Michael Sack lobt besonders die
hervorragende Beratungsleistung von Bioland, dem führenden Verband
für ökologischen Landbau in Deutschland. Zwei Jahre hat das
gedauert. Den weitaus größten Teil der Bio-Milch liefert der
Maierhof zur Bayernland-Käserei nach Bayreuth. Nur ein ganz geringer
Teil wird selbst vermarktet, einer der Abnehmer ist die Eisdiele San
Remo in Kulmbach.
Schon
Vater Gerhard wollte immer auf ökologischen Landbau umstellen. Doch
erst mit dem neuen Stall, der von vornherein auf 120 Milchkühe
ausgelegt war, wurde die Umstellung mit Hilfe des
Bioland-Anbauverbandes Wirklichkeit. Michael Sack lobt besonders die
hervorragende Beratungsleistung von Bioland, dem führenden Verband
für ökologischen Landbau in Deutschland. Zwei Jahre hat das
gedauert. Den weitaus größten Teil der Bio-Milch liefert der
Maierhof zur Bayernland-Käserei nach Bayreuth. Nur ein ganz geringer
Teil wird selbst vermarktet, einer der Abnehmer ist die Eisdiele San
Remo in Kulmbach..jpg) Döllnitz.
Kesselfleisch, Blut- und Leberwürste und die Döllnitzer Bratwürste:
für diese und viele andere typisch fränkische Spezialitäten ist die
Metzgerei Rahm bekannt. Hinter der Metzgerei steht ein
landwirtschaftlicher Betrieb mit langer Geschichte und Tradition.
Döllnitz.
Kesselfleisch, Blut- und Leberwürste und die Döllnitzer Bratwürste:
für diese und viele andere typisch fränkische Spezialitäten ist die
Metzgerei Rahm bekannt. Hinter der Metzgerei steht ein
landwirtschaftlicher Betrieb mit langer Geschichte und Tradition.
.jpg) Geschlachtet
wird in Kulmbach, was wiederum kurze Transportzeiten und eine
schnelle Zerlegung und Verarbeitung garantiert. Gewürzt wird zum
großen Teil nach einem alten fränkischen Hausschlachtrezept.
Zusammen mit den eigenen Familienangehörigen sind aktuell neun
Mitarbeiter als Voll- oder Teilzeitkräfte in der Direktvermarktung
Rahm tätig. Die Metzgerei beliefert auch die Edeka-Märkte in
Kulmbach, Neuenmarkt und Thurnau, die Bäckereien Kreuzer,
Grünwehrbeck und Dippold sowie den Getränkehandel Dresel in
Guttenberg. Auch ein Automat, der mit Nudeln und Eier aus Kasendorf
aufgestockt wird, bietet jeden Tag 24 Stunden lang seine Dienste an.
Geschlachtet
wird in Kulmbach, was wiederum kurze Transportzeiten und eine
schnelle Zerlegung und Verarbeitung garantiert. Gewürzt wird zum
großen Teil nach einem alten fränkischen Hausschlachtrezept.
Zusammen mit den eigenen Familienangehörigen sind aktuell neun
Mitarbeiter als Voll- oder Teilzeitkräfte in der Direktvermarktung
Rahm tätig. Die Metzgerei beliefert auch die Edeka-Märkte in
Kulmbach, Neuenmarkt und Thurnau, die Bäckereien Kreuzer,
Grünwehrbeck und Dippold sowie den Getränkehandel Dresel in
Guttenberg. Auch ein Automat, der mit Nudeln und Eier aus Kasendorf
aufgestockt wird, bietet jeden Tag 24 Stunden lang seine Dienste an..jpg) Windischenhaig.
Nudeln, Eier, komplette Hähnchen, Kartoffeln und demnächst auch
Eierlikör: Der Nebenerwerbsbetrieb der Familie Kaßel in
Windischenhaig setzt zum größten Teil auf Direktvermarktung. Obwohl
ziemlich ab vom Schuss gelegen, ist das „Eierhaisla“ weit und breit
bekannt. Jeder, der hier einkauft kann sich davon überzeugen, dass
die Hühner optimalen Auslauf haben.
Windischenhaig.
Nudeln, Eier, komplette Hähnchen, Kartoffeln und demnächst auch
Eierlikör: Der Nebenerwerbsbetrieb der Familie Kaßel in
Windischenhaig setzt zum größten Teil auf Direktvermarktung. Obwohl
ziemlich ab vom Schuss gelegen, ist das „Eierhaisla“ weit und breit
bekannt. Jeder, der hier einkauft kann sich davon überzeugen, dass
die Hühner optimalen Auslauf haben..jpg) Die
Nachfrage gibt den Kaßels recht. Rund 2000 Eier werden pro Woche
vermarktet. Die Kunden kommen nicht nur aus Kulmbach, sondern aus
dem gesamten Landkreis. Zweimal im Jahr werden 120 zudem frisch
geschlachtete Masthähnchen aus dem neuen Hähnchenmobil in der
Direktvermarktung angeboten. Die Werbung läuft im Wesentlichen über
Mund-zu-Mund-Propaganda und natürlich über Facebook und Instagram.
Seit geraumer Zeit sind die Kaßel-Eier auch bei der Bäckerei Dippold
in Melkendorf zu haben.
Die
Nachfrage gibt den Kaßels recht. Rund 2000 Eier werden pro Woche
vermarktet. Die Kunden kommen nicht nur aus Kulmbach, sondern aus
dem gesamten Landkreis. Zweimal im Jahr werden 120 zudem frisch
geschlachtete Masthähnchen aus dem neuen Hähnchenmobil in der
Direktvermarktung angeboten. Die Werbung läuft im Wesentlichen über
Mund-zu-Mund-Propaganda und natürlich über Facebook und Instagram.
Seit geraumer Zeit sind die Kaßel-Eier auch bei der Bäckerei Dippold
in Melkendorf zu haben..jpg) „Die
ganze Familie hilft mit“, erläuterte Junior Daniel. Dazu gehört auch
Mutter Gudrun und wenn es notwendig ist, etwa zur Kartoffelernte,
auch die beiden Schwestern. Zum Beispiel muss der über Photovoltaik
komplett autarke Stall einmal pro Woche versetzt werden. Wenn sich
zwischen den Hühnern manchmal mehrere Ziegen tummeln, dann deshalb,
um dadurch den Habicht fernzuhalten. Trotzdem hat der Raubvogel
gerade in den zurückliegenden Wochen wieder mehrfach zugeschlagen.
„Die
ganze Familie hilft mit“, erläuterte Junior Daniel. Dazu gehört auch
Mutter Gudrun und wenn es notwendig ist, etwa zur Kartoffelernte,
auch die beiden Schwestern. Zum Beispiel muss der über Photovoltaik
komplett autarke Stall einmal pro Woche versetzt werden. Wenn sich
zwischen den Hühnern manchmal mehrere Ziegen tummeln, dann deshalb,
um dadurch den Habicht fernzuhalten. Trotzdem hat der Raubvogel
gerade in den zurückliegenden Wochen wieder mehrfach zugeschlagen.
.jpg) Marktleugast.
„Unvergessliche Momente inmitten des Naturparks Frankenwald“. Mit
diesem Slogan verspricht die Familie Schramm aus Marktleugast nicht
zu viel. Aus einem einfachen landwirtschaftlichen Betrieb mitten im
Ort hervorgegangen, hat die Familie auf dem Hochplateau nahe der
Ortschaft ein ganzes Feriendorf mit über 50 Betten verteilt auf neun
Häusern errichtet. Die klassische Landwirtschaft kommt dabei nicht
zu kurz. Noch immer bewirtschaften Sylvia und Ferdinand Schramm 180
Hektar Land, betreiben Viehzucht und Rindermast. „Wir sind eben ein
innovativer Betrieb in alle Richtungen“, sagte Ferdinand Schramm
(53).
Marktleugast.
„Unvergessliche Momente inmitten des Naturparks Frankenwald“. Mit
diesem Slogan verspricht die Familie Schramm aus Marktleugast nicht
zu viel. Aus einem einfachen landwirtschaftlichen Betrieb mitten im
Ort hervorgegangen, hat die Familie auf dem Hochplateau nahe der
Ortschaft ein ganzes Feriendorf mit über 50 Betten verteilt auf neun
Häusern errichtet. Die klassische Landwirtschaft kommt dabei nicht
zu kurz. Noch immer bewirtschaften Sylvia und Ferdinand Schramm 180
Hektar Land, betreiben Viehzucht und Rindermast. „Wir sind eben ein
innovativer Betrieb in alle Richtungen“, sagte Ferdinand Schramm
(53)..jpg) Zwei
Portale gibt es zwar noch, die das Feriendorf bewerben, doch im
Wesentlichen läuft mittlerweile alles über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Vor allem Gäste aus dem Osten Deutschlands, aus Berlin und aus dem
Rhein-Main-Gebiet wüssten die herrliche Lage zu schätzen. An den
Erfolg des Feriendorfes hatte Ferdinand Schramm von Anfang an
geglaubt: „Dort wo es landwirtschaftlich schwierig wird, ist es
landschaftlich eine super Gegend, um Urlaub zu machen.“
Zwei
Portale gibt es zwar noch, die das Feriendorf bewerben, doch im
Wesentlichen läuft mittlerweile alles über Mund-zu-Mund-Propaganda.
Vor allem Gäste aus dem Osten Deutschlands, aus Berlin und aus dem
Rhein-Main-Gebiet wüssten die herrliche Lage zu schätzen. An den
Erfolg des Feriendorfes hatte Ferdinand Schramm von Anfang an
geglaubt: „Dort wo es landwirtschaftlich schwierig wird, ist es
landschaftlich eine super Gegend, um Urlaub zu machen.“.jpg) Die
touristische Schiene macht freilich nur einen Teil, wenn auch den
augenfälligsten, aus. Auf einem großen Teil der 180 Hektar Ackerland
wird Braugerste angebaut, die Ferdinand Schramm an die Augustiner
Brauerei in München vermarktet. Neben einem Drittel Grünland wird
auf den Flächen auch Raps, Dinkel. Emmer und Leinsamen produziert.
Mehr und mehr soll eine eigene Vermarktung entstehen, nach den
Richtlinien des ökologischen Landbaus.
Die
touristische Schiene macht freilich nur einen Teil, wenn auch den
augenfälligsten, aus. Auf einem großen Teil der 180 Hektar Ackerland
wird Braugerste angebaut, die Ferdinand Schramm an die Augustiner
Brauerei in München vermarktet. Neben einem Drittel Grünland wird
auf den Flächen auch Raps, Dinkel. Emmer und Leinsamen produziert.
Mehr und mehr soll eine eigene Vermarktung entstehen, nach den
Richtlinien des ökologischen Landbaus. .jpg) Er
bedauert, dass der Bezug zur Landwirtschaft in der Gesellschaft
größtenteils verlorengegangen ist. Egal ob lila Kuh oder die Milch,
die von den Bären kommt, bis hin zu unberechtigten Vorwürfen in
Sachen Tierwohl sei alles dabei. Doch Ferdinand Schramm versucht
gegenzusteuern. „Wir zeigen, wie es früher war und wie es heute
ist.“ Grund und Boden bezeichnet er als das wichtigste
Produktionsgut. Kein verantwortungsvoller Landwirt würde das kaputt
fahren, verdichten, Erosionen verursachen. Vielmehr gelte es, das
natürliche Bodenleben anzuregen. Dann habe man den Ertrag, auch wenn
man wenig düngt. Ferdinand Schramm: „Am wichtigsten ist es, mit der
Natur und nicht gegen sie zu arbeiten.“
Er
bedauert, dass der Bezug zur Landwirtschaft in der Gesellschaft
größtenteils verlorengegangen ist. Egal ob lila Kuh oder die Milch,
die von den Bären kommt, bis hin zu unberechtigten Vorwürfen in
Sachen Tierwohl sei alles dabei. Doch Ferdinand Schramm versucht
gegenzusteuern. „Wir zeigen, wie es früher war und wie es heute
ist.“ Grund und Boden bezeichnet er als das wichtigste
Produktionsgut. Kein verantwortungsvoller Landwirt würde das kaputt
fahren, verdichten, Erosionen verursachen. Vielmehr gelte es, das
natürliche Bodenleben anzuregen. Dann habe man den Ertrag, auch wenn
man wenig düngt. Ferdinand Schramm: „Am wichtigsten ist es, mit der
Natur und nicht gegen sie zu arbeiten.“ Kulmbach
Kaum eine Branche steht so im Kreuzfeuer der Kritik, wie die
Landwirtschaft. Doch stimmen die Vorwürfe wirklich? In einigen
wenigen Fällen mag dies zutreffen. Der weitaus größte Teil der
Betriebe steht genau für das Gegenteil. Denn viele Landwirte in
Bayern und auch im Kulmbacher Land haben pfiffige und auch
nachhaltige Ideen.
Kulmbach
Kaum eine Branche steht so im Kreuzfeuer der Kritik, wie die
Landwirtschaft. Doch stimmen die Vorwürfe wirklich? In einigen
wenigen Fällen mag dies zutreffen. Der weitaus größte Teil der
Betriebe steht genau für das Gegenteil. Denn viele Landwirte in
Bayern und auch im Kulmbacher Land haben pfiffige und auch
nachhaltige Ideen. .jpg) Kulmbach,
Bayreuth, Bamberg. Tannenzweige, Lichterketten, bunt blinkende LEDs
in den riesigen Rädern: Nachdem die Traktorkorsos im vergangenen
Jahr auf großen Anklang gestoßen waren, haben sich auch in diesem
Jahr Bauern aus Bamberg, Bayreuth und Kulmbach wieder zusammengetan,
ihre Bulldogs festlich geschmückt und sich am zweiten Adventssamstag
auf eine Rundfahrt durch die Städte gemacht.
Kulmbach,
Bayreuth, Bamberg. Tannenzweige, Lichterketten, bunt blinkende LEDs
in den riesigen Rädern: Nachdem die Traktorkorsos im vergangenen
Jahr auf großen Anklang gestoßen waren, haben sich auch in diesem
Jahr Bauern aus Bamberg, Bayreuth und Kulmbach wieder zusammengetan,
ihre Bulldogs festlich geschmückt und sich am zweiten Adventssamstag
auf eine Rundfahrt durch die Städte gemacht. .jpg) In
Kulmbach war der Traktorkorso mit ungefähr 30 Fahrzeugen im Ortsteil
Melkendorf gestartet. Nach einer Fahrt quer durch die Innenstadt
machten die Schlepper in der Oberen Stadt halt, wo es Gelegenheit
gab, die Fahrzeuge zu fotografieren und mit den Bauern ins Gespräch
zu kommen. Hauptorganisatoren waren Kathrin Erhardt aus Motschenbach
und Stefan Seidel aus Wacholder. Während der Fahrt machten die
Schlepper einen Stopp am Kinderhaus „Sternstunden“ der
Geschwister-Gummi-Stiftung, wo Schokonikoläuse, Süßigkeiten und
weitere Spenden überreicht wurden.
In
Kulmbach war der Traktorkorso mit ungefähr 30 Fahrzeugen im Ortsteil
Melkendorf gestartet. Nach einer Fahrt quer durch die Innenstadt
machten die Schlepper in der Oberen Stadt halt, wo es Gelegenheit
gab, die Fahrzeuge zu fotografieren und mit den Bauern ins Gespräch
zu kommen. Hauptorganisatoren waren Kathrin Erhardt aus Motschenbach
und Stefan Seidel aus Wacholder. Während der Fahrt machten die
Schlepper einen Stopp am Kinderhaus „Sternstunden“ der
Geschwister-Gummi-Stiftung, wo Schokonikoläuse, Süßigkeiten und
weitere Spenden überreicht wurden..jpg) Auch
in Bamberg haben sich gut 50 festlich geschmückte 50 Schlepper auf
eine Fahrt quer durch die Domstadt gemacht, obgleich die Strecke im
Vorfeld mehrfach geändert werden musste. Startpunkt war dabei die
Gärtnerei Hans-Jürgen Eichfelder im Norden, Endpunkt die „Brose
Arena“ im Süden. Dazwischen ging es unter anderem am Bahnhof vorbei,
über die Luitpoldstraße zum Rhein-Man-Donau-Damm und dann über den
Münchner Ring zur Brose-Arena. Laut Hauptorganisatoren Marco Übel
sollten die Bulldogs ursprünglich durch die belebte „Lange Straße“
fahren, was dann aus Sicherheitsgründen doch nicht zustande kam. Der
Großteil der Bauern kam aus dem Bamberger Landkreis, einige waren
auch aus Coburg und den angrenzenden Haßbergen angereist. Einige
Traktoren machten sich danach noch auf den Weg zur Kinderstation des
Bamberger Klinikums, um kleine Geschenke zu übergeben.
Auch
in Bamberg haben sich gut 50 festlich geschmückte 50 Schlepper auf
eine Fahrt quer durch die Domstadt gemacht, obgleich die Strecke im
Vorfeld mehrfach geändert werden musste. Startpunkt war dabei die
Gärtnerei Hans-Jürgen Eichfelder im Norden, Endpunkt die „Brose
Arena“ im Süden. Dazwischen ging es unter anderem am Bahnhof vorbei,
über die Luitpoldstraße zum Rhein-Man-Donau-Damm und dann über den
Münchner Ring zur Brose-Arena. Laut Hauptorganisatoren Marco Übel
sollten die Bulldogs ursprünglich durch die belebte „Lange Straße“
fahren, was dann aus Sicherheitsgründen doch nicht zustande kam. Der
Großteil der Bauern kam aus dem Bamberger Landkreis, einige waren
auch aus Coburg und den angrenzenden Haßbergen angereist. Einige
Traktoren machten sich danach noch auf den Weg zur Kinderstation des
Bamberger Klinikums, um kleine Geschenke zu übergeben..jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 Kulmbach.
„Bei den Bauern herrscht nur noch großer Frust.“ So hat
BBV-Kreisobmann Wilfried Löwinger bei der Kulmbacher
Gebietsversammlung die aktuelle Stimmungslage in der Landwirtschaft
beschrieben. Schuld daran seien immer mehr Bürokratie, Angriffe aus
der Gesellschaft sowie praxisfremde Richtlinien und Gesetze aus der
Politik. „Betriebe hören derzeit reihenweise auf“, sagte Löwinger.
Im Moment sei ein Strukturwandel festzustellen, wie es ihn noch nie
vorher gegeben habe.
Kulmbach.
„Bei den Bauern herrscht nur noch großer Frust.“ So hat
BBV-Kreisobmann Wilfried Löwinger bei der Kulmbacher
Gebietsversammlung die aktuelle Stimmungslage in der Landwirtschaft
beschrieben. Schuld daran seien immer mehr Bürokratie, Angriffe aus
der Gesellschaft sowie praxisfremde Richtlinien und Gesetze aus der
Politik. „Betriebe hören derzeit reihenweise auf“, sagte Löwinger.
Im Moment sei ein Strukturwandel festzustellen, wie es ihn noch nie
vorher gegeben habe.  Neuenmarkt.
Umweltfreundlicher geht es nicht, auch wenn es manche nicht glauben
wollen: Unkraut lässt sich am besten mit Heißwasser bekämpfen. Wie
das geht, hat die Maschinenring Oberfranken Mitte GmbH in diesen
Tagen auf dem Neuenmarkter Friedhof gezeigt. Dort war Florian Maser
mit dem nagelneuen Trägerfahrzeug mit Heißwassertechnik unterwegs,
um Löwenzahn und Co von den Gehwegen zu verbannen.
Neuenmarkt.
Umweltfreundlicher geht es nicht, auch wenn es manche nicht glauben
wollen: Unkraut lässt sich am besten mit Heißwasser bekämpfen. Wie
das geht, hat die Maschinenring Oberfranken Mitte GmbH in diesen
Tagen auf dem Neuenmarkter Friedhof gezeigt. Dort war Florian Maser
mit dem nagelneuen Trägerfahrzeug mit Heißwassertechnik unterwegs,
um Löwenzahn und Co von den Gehwegen zu verbannen..jpg) Hof.
Mehr Wertschätzung für den bäuerlichen Berufsstand hat Kreisobmann
Hermann Klug beim Erntedankfest in Hof gefordert. „Unsere
Hauptaufgabe ist es, die Ernährung zu sichern, wir werden aber auch
unseren Beitrag zur Bewältigung des Klimawandel leisten“, sagte der
BBV-Kreisobmann bei einem Gottesdienst in der Michaeliskirche, der
größten evangelischen Kirche in Oberfranken.
Hof.
Mehr Wertschätzung für den bäuerlichen Berufsstand hat Kreisobmann
Hermann Klug beim Erntedankfest in Hof gefordert. „Unsere
Hauptaufgabe ist es, die Ernährung zu sichern, wir werden aber auch
unseren Beitrag zur Bewältigung des Klimawandel leisten“, sagte der
BBV-Kreisobmann bei einem Gottesdienst in der Michaeliskirche, der
größten evangelischen Kirche in Oberfranken. .jpg) Landwirtschaft
werde nicht ohne Grund als der primäre Sektor bezeichnet, sagte
Landrat Oliver Bär. De Herausforderungen würden wohl auch in Zukunft
nicht weniger und die finanziellen Schwankungen für die Bauern nicht
geringer, doch die Aufgabe bleibe die größte, nämlich die Menschen
zu ernähren. Der Erntekronenwettbewerb zeige, dass die Landjugend
nicht nur ein bloßer Verein ist. „Die Landjugend lebt die Identität
unserer Heimat“, sagte Bär. Lange und intensiv habe er zusammen mit
Dekan Saalfrank, Heimatpfleger Adrian Roßner und Bernd Schnabel vom
Vorstand der VR-Bank Bayreuth/Hof die Bewertung vorgenommen und sei
sich dabei sehrt wohl bewusst gewesen, welche Arbeit hinter dieser
Art von gelebten Brauchtum steckt.
Landwirtschaft
werde nicht ohne Grund als der primäre Sektor bezeichnet, sagte
Landrat Oliver Bär. De Herausforderungen würden wohl auch in Zukunft
nicht weniger und die finanziellen Schwankungen für die Bauern nicht
geringer, doch die Aufgabe bleibe die größte, nämlich die Menschen
zu ernähren. Der Erntekronenwettbewerb zeige, dass die Landjugend
nicht nur ein bloßer Verein ist. „Die Landjugend lebt die Identität
unserer Heimat“, sagte Bär. Lange und intensiv habe er zusammen mit
Dekan Saalfrank, Heimatpfleger Adrian Roßner und Bernd Schnabel vom
Vorstand der VR-Bank Bayreuth/Hof die Bewertung vorgenommen und sei
sich dabei sehrt wohl bewusst gewesen, welche Arbeit hinter dieser
Art von gelebten Brauchtum steckt. Bergnersreuth.
Corona-bedingt hat es im Landkreis Wunsiedel heuer kein
Erntedankfest gegeben. „Wir wollten traditionell wieder im
Volkskundlichen Gerätemuseum in Bergnersreuth feiern, doch der
Aufwand hätte in keinem Verhältnis zum Ergebnis gestanden“, bedauert
Kreisobmann Harald Fischer. Die Akteure der Bauernverbandes, der
Kirche und der Politik versammelten sich trotzdem zu einem Termin
mit Pressevertretern auf der Museumswiese, um in kurzen Statements
an die Bedeutung des Erntedank zu erinnern, aber auch, um die eine
oder andere Neuigkeit zu verkünden.
Bergnersreuth.
Corona-bedingt hat es im Landkreis Wunsiedel heuer kein
Erntedankfest gegeben. „Wir wollten traditionell wieder im
Volkskundlichen Gerätemuseum in Bergnersreuth feiern, doch der
Aufwand hätte in keinem Verhältnis zum Ergebnis gestanden“, bedauert
Kreisobmann Harald Fischer. Die Akteure der Bauernverbandes, der
Kirche und der Politik versammelten sich trotzdem zu einem Termin
mit Pressevertretern auf der Museumswiese, um in kurzen Statements
an die Bedeutung des Erntedank zu erinnern, aber auch, um die eine
oder andere Neuigkeit zu verkünden.
 Aufseß/Windischgaillenreuth.
Mit der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von bisher 50 auf künftig 65
Euro im Jahr will der Maschinen- und Betriebshilfsring Fränkische
Schweiz den wachsenden Bedürfnissen der Selbsthilfeorganisation und
ihrer Mitglieder Stand halten. Ein entsprechender Beschluss wurde
auf der Jahreshauptversammlung am Freitag in Windischgaillenreuth
gegen drei Stimmen gefasst. Unverändert bleibt der Hektarsatz von
1,30 Euro pro Hektar, der auf 150 Hektar gedeckelt ist und der von
den Mitgliedern zusätzlich zum Grundbetrag aufgewandt werden muss.
Aufseß/Windischgaillenreuth.
Mit der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages von bisher 50 auf künftig 65
Euro im Jahr will der Maschinen- und Betriebshilfsring Fränkische
Schweiz den wachsenden Bedürfnissen der Selbsthilfeorganisation und
ihrer Mitglieder Stand halten. Ein entsprechender Beschluss wurde
auf der Jahreshauptversammlung am Freitag in Windischgaillenreuth
gegen drei Stimmen gefasst. Unverändert bleibt der Hektarsatz von
1,30 Euro pro Hektar, der auf 150 Hektar gedeckelt ist und der von
den Mitgliedern zusätzlich zum Grundbetrag aufgewandt werden muss.
.jpg) Kulmbach.
Mit dem Ausscheiden von Geschäftsführer Werner Friedlein geht nicht
nur für den Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach eine Ära zu
Ende. Friedlein war weit über Kulmbach hinaus hoch geschätzt und
geachtet. Nach fast 40 Jahren Tätigkeit wurde der Mann, dessen
Markenzeichen ein Cowboyhut ist, jetzt bei der
Jahreshauptversammlung in den Ruhestand verabschiedet.
Kulmbach.
Mit dem Ausscheiden von Geschäftsführer Werner Friedlein geht nicht
nur für den Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach eine Ära zu
Ende. Friedlein war weit über Kulmbach hinaus hoch geschätzt und
geachtet. Nach fast 40 Jahren Tätigkeit wurde der Mann, dessen
Markenzeichen ein Cowboyhut ist, jetzt bei der
Jahreshauptversammlung in den Ruhestand verabschiedet..jpg) Auch
wenn die Stunden in der klassischen sozialen als auch in der
wirtschaftlichen Betriebshilfe dem Trend entsprechend 2020
rückgängig waren, konnte Friedlein in seinem letzten
Geschäftsbericht eine positive Bilanz ziehen. Bei der sozialen
Betriebshilfe musste der Maschinenring einen Rückgang im
Verrechnungswert von knapp 189000 Euro im Jahr 2019 auf gut 143000
Euro im zurückliegenden Jahr hinnehmen. Auch die wirtschaftliche
Betriebshilfe war rückläufig, und zwar von über 200000 Euro in 2019
auf 176000 Euro in 2020.
Auch
wenn die Stunden in der klassischen sozialen als auch in der
wirtschaftlichen Betriebshilfe dem Trend entsprechend 2020
rückgängig waren, konnte Friedlein in seinem letzten
Geschäftsbericht eine positive Bilanz ziehen. Bei der sozialen
Betriebshilfe musste der Maschinenring einen Rückgang im
Verrechnungswert von knapp 189000 Euro im Jahr 2019 auf gut 143000
Euro im zurückliegenden Jahr hinnehmen. Auch die wirtschaftliche
Betriebshilfe war rückläufig, und zwar von über 200000 Euro in 2019
auf 176000 Euro in 2020.  Bernstein.
Corona und dem wechselhaften Wetter zum Trotz: Mehrere hundert
Besucher waren nach Bernstein, einem Ortsteil von Wunsiedel,
gekommen, um das 800-jährige Bestehen des kleinen Dorfes mit seinen
rund 240 Einwohnern zu feiern. Dazu gehörte auch der „BioGenussmarkt“
der Ökomodellregion Siebenstern, den die Veranstalter mitten auf
einer Wiese am Ortsrand aufgebaut hatten.
Bernstein.
Corona und dem wechselhaften Wetter zum Trotz: Mehrere hundert
Besucher waren nach Bernstein, einem Ortsteil von Wunsiedel,
gekommen, um das 800-jährige Bestehen des kleinen Dorfes mit seinen
rund 240 Einwohnern zu feiern. Dazu gehörte auch der „BioGenussmarkt“
der Ökomodellregion Siebenstern, den die Veranstalter mitten auf
einer Wiese am Ortsrand aufgebaut hatten.  Tiefendorf. Koriander, Malven, Fenchel und viele andere Arten blühen
auf den Feldrändern in Tiefendorf nahe Töpen im Landkreis Hof. Wie
so viele andere Bauern im Landkreis hat auch Landwirt Matthias
Kießling eine Blühfläche angelegt, um Lebensraum für Bienen,
Insekten und andere Wildtiere zu schaffen. Bei einem Pressetermin
stellte der BBV Hof die Initiative der Öffentlichkeit vor und warb
gleichzeitig für die Blühpatenschaften, die Matthias Kießling
anbietet.
Tiefendorf. Koriander, Malven, Fenchel und viele andere Arten blühen
auf den Feldrändern in Tiefendorf nahe Töpen im Landkreis Hof. Wie
so viele andere Bauern im Landkreis hat auch Landwirt Matthias
Kießling eine Blühfläche angelegt, um Lebensraum für Bienen,
Insekten und andere Wildtiere zu schaffen. Bei einem Pressetermin
stellte der BBV Hof die Initiative der Öffentlichkeit vor und warb
gleichzeitig für die Blühpatenschaften, die Matthias Kießling
anbietet. Mistelgau.
Planungssicherheit: das ist das Wort, das beim Politikergespräch des
BBV Bayreuth zur Bundestagswahl am häufigsten genannt wurde. „Wir
haben den Eindruck, dass die Landwirtschaft in Deutschland gar nicht
mehr gewünscht ist“, sagte der stellvertretende Kreisobmann Harald
Galster vor dem Hintergrund ständig neuer Verordnungen, mit denen
die Bauern zurechtkommen müssen.
Mistelgau.
Planungssicherheit: das ist das Wort, das beim Politikergespräch des
BBV Bayreuth zur Bundestagswahl am häufigsten genannt wurde. „Wir
haben den Eindruck, dass die Landwirtschaft in Deutschland gar nicht
mehr gewünscht ist“, sagte der stellvertretende Kreisobmann Harald
Galster vor dem Hintergrund ständig neuer Verordnungen, mit denen
die Bauern zurechtkommen müssen.  Langenstadt. Die Käferproblematik hat es deutlich gemacht: „Wir
haben große Aufgaben vor uns“, so Carmen Hombach, Vorsitzende der
Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach. Sie meint damit in
erster Linie den Wegebau, um das Holz aus dem Wald zu schaffen.
„Eine vernünftige Erschließung ist das A und O.“ Ihre Forderung
lautet deshalb, neue Stellen an den Ämtern zu schaffen, die sich
ausschließlich um die Erschließung des Privatwaldes kümmern.
Langenstadt. Die Käferproblematik hat es deutlich gemacht: „Wir
haben große Aufgaben vor uns“, so Carmen Hombach, Vorsitzende der
Waldbesitzervereinigung Kulmbach/Stadtsteinach. Sie meint damit in
erster Linie den Wegebau, um das Holz aus dem Wald zu schaffen.
„Eine vernünftige Erschließung ist das A und O.“ Ihre Forderung
lautet deshalb, neue Stellen an den Ämtern zu schaffen, die sich
ausschließlich um die Erschließung des Privatwaldes kümmern..jpg) Neudorf,
Lks. Bamberg. In Oberfranken gehen die Landwirte heuer von einer
„vernünftigen Erntesituation“ aus. „Die Ernteaussichten sind
tendenziell noch gut“, sagte BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif aus
Forchheim bei einem Pressetermin zum Start der Ernte auf dem Betrieb
von Dagmar und Jörg Deinlein in Neudorf bei Scheßlitz.
Neudorf,
Lks. Bamberg. In Oberfranken gehen die Landwirte heuer von einer
„vernünftigen Erntesituation“ aus. „Die Ernteaussichten sind
tendenziell noch gut“, sagte BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif aus
Forchheim bei einem Pressetermin zum Start der Ernte auf dem Betrieb
von Dagmar und Jörg Deinlein in Neudorf bei Scheßlitz..jpg) Eine
der wichtigsten Feldfrüchte ist und bleibt in Oberfranken die
Braugerste. „In keiner anderen Region wird so viel Braugerste
angebaut, wie bei uns“, sagte Greif. Rund ein Drittel der
bayerischen Erntemenge komme aus dem Regierungsbezirk. Dennoch sei
die Anbaufläche in den vergangenen fünf Jahren um etwa 7000 Hektar
zurückgegangen. Als Gründe dafür nannte der BBV-Präsident vor allem
die eher schlechteren Preise und die durch die Trockenheit der
letzten Jahre eher unterdurchschnittlichen Erträge. Aktuell sei der
Braugerstenpreis allerdings auf einem eher niedrigeren Niveau. Grund
dafür sei die Corona-Pandemie, die gerade die Brauereien, deren
Hauptgeschäft bei den Gaststätten liegt, stark belastet hat.
Eine
der wichtigsten Feldfrüchte ist und bleibt in Oberfranken die
Braugerste. „In keiner anderen Region wird so viel Braugerste
angebaut, wie bei uns“, sagte Greif. Rund ein Drittel der
bayerischen Erntemenge komme aus dem Regierungsbezirk. Dennoch sei
die Anbaufläche in den vergangenen fünf Jahren um etwa 7000 Hektar
zurückgegangen. Als Gründe dafür nannte der BBV-Präsident vor allem
die eher schlechteren Preise und die durch die Trockenheit der
letzten Jahre eher unterdurchschnittlichen Erträge. Aktuell sei der
Braugerstenpreis allerdings auf einem eher niedrigeren Niveau. Grund
dafür sei die Corona-Pandemie, die gerade die Brauereien, deren
Hauptgeschäft bei den Gaststätten liegt, stark belastet hat..jpg) Ganz
wichtig in Oberfranken ist auch das Grünland, das in den ersten
beiden Schnitten aufgrund der Niederschläge bisher gute Mengen und
gute Qualitäten hervorgebracht hatte. Besonders nach der
trockenheitsbedingt oft angespannten Futtersituation in den
zurückliegenden Jahren sei dies von großer Bedeutung für viele
Betriebe.
Ganz
wichtig in Oberfranken ist auch das Grünland, das in den ersten
beiden Schnitten aufgrund der Niederschläge bisher gute Mengen und
gute Qualitäten hervorgebracht hatte. Besonders nach der
trockenheitsbedingt oft angespannten Futtersituation in den
zurückliegenden Jahren sei dies von großer Bedeutung für viele
Betriebe. Bayreuth
Einen besseren Platz hätte die Jungbauernschaft kaum finden können:
Mitten auf dem Bayreuther Marktplatz und damit im Herzen der Stadt
hat die BBV-Traktortour 2021 zur besten Einkaufszeit am
Samstagvormittag Station gemacht. „Wir wollen dem Verbraucher den
Wert der Direktvermarktung nahebringen und auf die große Bedeutung
regionaler Lebensmittel hinweisen“, erklärte Maximilian Raimund,
Bezirksvorsitzender der oberfränkischen Landjugend.
Bayreuth
Einen besseren Platz hätte die Jungbauernschaft kaum finden können:
Mitten auf dem Bayreuther Marktplatz und damit im Herzen der Stadt
hat die BBV-Traktortour 2021 zur besten Einkaufszeit am
Samstagvormittag Station gemacht. „Wir wollen dem Verbraucher den
Wert der Direktvermarktung nahebringen und auf die große Bedeutung
regionaler Lebensmittel hinweisen“, erklärte Maximilian Raimund,
Bezirksvorsitzender der oberfränkischen Landjugend..jpg) Großlosnitz.
Beispiele mustergültiger Erzeugung und Produktion mit dem
Schwerpunkt Regionalität möchte der Bauernverband mit seiner
Traktortour 2021 aufzeigen. Im „Milchlandkreis“ Hof konnte das
natürlich nur ein Milchviehbetrieb sein, und zwar der von Tobias
Puchta in Großlosnitz, das zur Gemeinde Zell im Fichtelgebirge
gehört.
Großlosnitz.
Beispiele mustergültiger Erzeugung und Produktion mit dem
Schwerpunkt Regionalität möchte der Bauernverband mit seiner
Traktortour 2021 aufzeigen. Im „Milchlandkreis“ Hof konnte das
natürlich nur ein Milchviehbetrieb sein, und zwar der von Tobias
Puchta in Großlosnitz, das zur Gemeinde Zell im Fichtelgebirge
gehört. .jpg) „Der
Stallbau war schon ein großer Schritt“, sagt Seniorchefin Sandra
Puchta. Schließlich sei es nicht so einfach, wenn man bedenkt, womit
die Bauern derzeit so alles zu kämpfen hätten. Doch irgendwann sei
man vor der Frage gestanden, die Sandra Puchta mit dem alten Spruch
beschreibt: „Wachsen oder weichen“.
„Der
Stallbau war schon ein großer Schritt“, sagt Seniorchefin Sandra
Puchta. Schließlich sei es nicht so einfach, wenn man bedenkt, womit
die Bauern derzeit so alles zu kämpfen hätten. Doch irgendwann sei
man vor der Frage gestanden, die Sandra Puchta mit dem alten Spruch
beschreibt: „Wachsen oder weichen“. Kornbach.
So funktioniert Regionalität: Johannes Herold erzeugt auf seinem
Betrieb in Kornbach bei Gefrees hochwertiges Weidefleisch von
Galloways-Rindern, gleich nebenan im Gasthof Kornbachtal von
Sebastian Loos kommt das Fleisch auf den Teller, und zwar in vielen
verschieden Variationen, etwa als Burger, Rouladen, Braten oder
Steaks.
Kornbach.
So funktioniert Regionalität: Johannes Herold erzeugt auf seinem
Betrieb in Kornbach bei Gefrees hochwertiges Weidefleisch von
Galloways-Rindern, gleich nebenan im Gasthof Kornbachtal von
Sebastian Loos kommt das Fleisch auf den Teller, und zwar in vielen
verschieden Variationen, etwa als Burger, Rouladen, Braten oder
Steaks. Wunsiedel.
Im Landkreis haben die Verantwortlichen die BBV-Traktortour dafür
genutzt, um für die Hauptfrucht des gesamten Fichtelgebirges, die
Braugerste, die Trommel zu rühren. Auf knapp 4000 Hektar und damit
auf über einem Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche wird
die Sommergerste im Landkreis angebaut. Also machte der „Essen-aus-Bayern-Traktor“
zunächst auf einem Acker von Landwirt Werner Schricker im Ortsteil
Holenbrunn Station, dann ging es weiter zur Traditionsbrauerei Lang
im nahen Schönbrunn.
Wunsiedel.
Im Landkreis haben die Verantwortlichen die BBV-Traktortour dafür
genutzt, um für die Hauptfrucht des gesamten Fichtelgebirges, die
Braugerste, die Trommel zu rühren. Auf knapp 4000 Hektar und damit
auf über einem Drittel der landwirtschaftlich genutzten Fläche wird
die Sommergerste im Landkreis angebaut. Also machte der „Essen-aus-Bayern-Traktor“
zunächst auf einem Acker von Landwirt Werner Schricker im Ortsteil
Holenbrunn Station, dann ging es weiter zur Traditionsbrauerei Lang
im nahen Schönbrunn. Drosendorf.
Ihren neuen Rückewagen hat die Waldbesitzervereinigung Hollfeld in
diesen Tagen in Betrieb genommen. Es ist bereits der vierte
Rückewagen der über 1600 Mitglieder starken WBV.
Drosendorf.
Ihren neuen Rückewagen hat die Waldbesitzervereinigung Hollfeld in
diesen Tagen in Betrieb genommen. Es ist bereits der vierte
Rückewagen der über 1600 Mitglieder starken WBV. .jpg) Bayreuth.
Man mag es kaum für möglich halten, doch einer der größten
Gemüseanbaubetriebe der Region liegt tatsächlich hinter dicken
Gefängnismauern. „Wir produzieren rund 40 bis 45 Tonnen eigenes
Gemüse im Jahr“, sagt der leitende Gärtnereimeister der
Justizvollzugsanstalt Bayreuth–St. Georgen Jörg Eckel. Knapp die
Hälfte davon bleibt zur Eigenversorgung in der JVA, der Rest geht in
den freien Verkauf an jedermann.
Bayreuth.
Man mag es kaum für möglich halten, doch einer der größten
Gemüseanbaubetriebe der Region liegt tatsächlich hinter dicken
Gefängnismauern. „Wir produzieren rund 40 bis 45 Tonnen eigenes
Gemüse im Jahr“, sagt der leitende Gärtnereimeister der
Justizvollzugsanstalt Bayreuth–St. Georgen Jörg Eckel. Knapp die
Hälfte davon bleibt zur Eigenversorgung in der JVA, der Rest geht in
den freien Verkauf an jedermann..jpg) Schnell
sei allerdings klar geworden, dass die Nachfrage der Kunden nach
biologisch produzierter Ware immer größer wurde. So habe man zum
Beispiel nach und nach von konservativen Düngemitteln auf
biologischen Pflanzenschutz und Naturdünger umgestellt. Auch das
Saatgut wird in der Regel selbst produziert. Zu Gute kam der
Gefängnisgärtnerei bei der Umstellung auf eine biologische
Wirtschaftsweise unter anderem aufgrund der kurzen Wege die
innerstädtische Lage der Anbaufläche. „Ansonsten muss man aber schon
wesentlich flexibler sein, als beim konservativen Anbau“, sagt
Eckel. Man benötige auch Sorten, die genügsamer sind.
Schnell
sei allerdings klar geworden, dass die Nachfrage der Kunden nach
biologisch produzierter Ware immer größer wurde. So habe man zum
Beispiel nach und nach von konservativen Düngemitteln auf
biologischen Pflanzenschutz und Naturdünger umgestellt. Auch das
Saatgut wird in der Regel selbst produziert. Zu Gute kam der
Gefängnisgärtnerei bei der Umstellung auf eine biologische
Wirtschaftsweise unter anderem aufgrund der kurzen Wege die
innerstädtische Lage der Anbaufläche. „Ansonsten muss man aber schon
wesentlich flexibler sein, als beim konservativen Anbau“, sagt
Eckel. Man benötige auch Sorten, die genügsamer sind..jpg) Die
JVA Bayreuth – St. Georgen ist eine der ältesten und gleichzeitig
eine der größten Haftanstalten Bayerns. Sie wurde nach den Worten
von Anstaltsleiter Matthias Konopka 1724 von Markgraf Friedrich als
Zucht- und Arbeitshaus errichtet. Hinter Mauern und Stacheldraht
verbüßen derzeit rund 800 Häftlinge Freiheitsstrafen von wenigen
Wochen Dauer bis zu lebenslang, darunter auch gut 100
Untersuchungshäftlinge, die noch auf ihren Prozess warten.
Die
JVA Bayreuth – St. Georgen ist eine der ältesten und gleichzeitig
eine der größten Haftanstalten Bayerns. Sie wurde nach den Worten
von Anstaltsleiter Matthias Konopka 1724 von Markgraf Friedrich als
Zucht- und Arbeitshaus errichtet. Hinter Mauern und Stacheldraht
verbüßen derzeit rund 800 Häftlinge Freiheitsstrafen von wenigen
Wochen Dauer bis zu lebenslang, darunter auch gut 100
Untersuchungshäftlinge, die noch auf ihren Prozess warten. Bayreuth.
Landwirte und Tierschützer Hand in Hand. Das ist durchaus möglich.
Ein Musterbeispiel für die Zusammenarbeit ist die Kitzrettung
Oberfranken. „Wir konnten heuer beim ersten Schnitt schon über 400
Rehkitze vor dem sicheren Mähtod bewahren“, sagt Britta Engelhardt
von der Kitzrettung. Angst, dass man sich militante Tierschützer auf
seine Wiese holt, haben die Bauern in der Region nicht mehr. „Wir
sehen die Arbeit der Kitzrettung als Praktiker sehr positiv“, sagt
Reinhard Sendelbeck, Vorsitzender des Maschinenrings
Bayreuth-Pegnitz. Harald Köppel, Geschäftsführer des BBV in Bayreuth
ergänzt: „Wir sind zusammen mit der Kitzrettung auf einem guten
Weg“. Anerkennung kommt schließlich auch aus der Jägerschaft. „Wir
zollen den ehrenamtlichen Mitstreitern Respekt“, sagt
Kreisjagdberater Georg Bayer.
Bayreuth.
Landwirte und Tierschützer Hand in Hand. Das ist durchaus möglich.
Ein Musterbeispiel für die Zusammenarbeit ist die Kitzrettung
Oberfranken. „Wir konnten heuer beim ersten Schnitt schon über 400
Rehkitze vor dem sicheren Mähtod bewahren“, sagt Britta Engelhardt
von der Kitzrettung. Angst, dass man sich militante Tierschützer auf
seine Wiese holt, haben die Bauern in der Region nicht mehr. „Wir
sehen die Arbeit der Kitzrettung als Praktiker sehr positiv“, sagt
Reinhard Sendelbeck, Vorsitzender des Maschinenrings
Bayreuth-Pegnitz. Harald Köppel, Geschäftsführer des BBV in Bayreuth
ergänzt: „Wir sind zusammen mit der Kitzrettung auf einem guten
Weg“. Anerkennung kommt schließlich auch aus der Jägerschaft. „Wir
zollen den ehrenamtlichen Mitstreitern Respekt“, sagt
Kreisjagdberater Georg Bayer..jpg) Wilhelmsthal.
Das Bioenergiedorf Effelter und die Borkenkäferschäden bei
Eichenbühl waren zwei Stationen der Landwirtschaftsfahrt von
Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, die heuer in den Landkreis
Kronach geführt hat. „Es wird viel zu wenig darüber diskutiert, was
die Bauern hier alles leisten“, zog Piwernetz eine positive Bilanz.
Jeder siebte Arbeitsplatz hänge im Landkreis von der Landwirtschaft
ab. Die Regierungspräsidentin rief Landwirte und Verbraucher dazu
auf, im Dialog zu bleiben. Trotz der vielen kritischen Stimmen in
der Öffentlichkeit sei man aber insgesamt auf einem guten Weg.
Wilhelmsthal.
Das Bioenergiedorf Effelter und die Borkenkäferschäden bei
Eichenbühl waren zwei Stationen der Landwirtschaftsfahrt von
Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, die heuer in den Landkreis
Kronach geführt hat. „Es wird viel zu wenig darüber diskutiert, was
die Bauern hier alles leisten“, zog Piwernetz eine positive Bilanz.
Jeder siebte Arbeitsplatz hänge im Landkreis von der Landwirtschaft
ab. Die Regierungspräsidentin rief Landwirte und Verbraucher dazu
auf, im Dialog zu bleiben. Trotz der vielen kritischen Stimmen in
der Öffentlichkeit sei man aber insgesamt auf einem guten Weg..jpg) Vor
Ort waren auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler der 11.
Jahrgangsstufe des Frankenwaldgymnasiums Kronach, die sich im Rahmen
zweier Seminarreihen mit dem Thema beschäftigen. Sie planen die
Wiederaufforstung der Kahlfläche. Gemeinsam mit dem Waldbesitzer
wollen die Schüler noch im Herbst 2021 selbst mit Hand anlegen und
klimatolerante Bäume pflanzen. Als mögliche Baumarten schlugen die
Elftklässer unter anderem die Stieleiche, die Roteiche, die
Libanon-Zeder, die korsische Schwarzkiefer vor. Das W-Seminar
(früher Facharbeit) der Schüler trägt bezeichnenderweise den Namen:
„SOS – Frankenwald in Not“.
Vor
Ort waren auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler der 11.
Jahrgangsstufe des Frankenwaldgymnasiums Kronach, die sich im Rahmen
zweier Seminarreihen mit dem Thema beschäftigen. Sie planen die
Wiederaufforstung der Kahlfläche. Gemeinsam mit dem Waldbesitzer
wollen die Schüler noch im Herbst 2021 selbst mit Hand anlegen und
klimatolerante Bäume pflanzen. Als mögliche Baumarten schlugen die
Elftklässer unter anderem die Stieleiche, die Roteiche, die
Libanon-Zeder, die korsische Schwarzkiefer vor. Das W-Seminar
(früher Facharbeit) der Schüler trägt bezeichnenderweise den Namen:
„SOS – Frankenwald in Not“..jpg) Zweites
Standbein des Betriebes ist die Erzeugung von Strom und Wärme. Neben
einer großen Photovoltaikanlage betreibt die Familie eine
Biogasanlage, die über 40 Einheiten in Effelter mit Wärme versorgt.
Die Anlage wurde 2002 als erste im Landkreis gebaut und 2014
erweitert. „Diese nachhaltige, klimaneutrale und kleinteilige
Energieerzeugung ist wichtig. Zudem wird der Aufwuchs extensiv
bewirtschafteter Wiesen genutzt. Das kommt auch der Natur zugute“,
betont Behördenleiter Schmidt.
Zweites
Standbein des Betriebes ist die Erzeugung von Strom und Wärme. Neben
einer großen Photovoltaikanlage betreibt die Familie eine
Biogasanlage, die über 40 Einheiten in Effelter mit Wärme versorgt.
Die Anlage wurde 2002 als erste im Landkreis gebaut und 2014
erweitert. „Diese nachhaltige, klimaneutrale und kleinteilige
Energieerzeugung ist wichtig. Zudem wird der Aufwuchs extensiv
bewirtschafteter Wiesen genutzt. Das kommt auch der Natur zugute“,
betont Behördenleiter Schmidt. .jpg) Der
Landkreis Kronach umfasst eine Gesamtfläche von über 65000 Hektar.
Davon sind rund 18000 Hektar landwirtschaftliche genutzte Fläche,
die Waldfläche beträgt zirka 38500 Hektar. Damit ist der Landkreis
Kronach mit fast 60 Prozent Waldanteil eine der waldreichsten
Landschaften in Bayern. Von den rund 700 landwirtschaftlichen
Betrieben haben nur gut 100 mehr als 50 Hektar Fläche. Punkten kann
der Landkreis mit dem oberfrankenweit höchsten Ökoflächenanteil von
etwa 23 Prozent.
Der
Landkreis Kronach umfasst eine Gesamtfläche von über 65000 Hektar.
Davon sind rund 18000 Hektar landwirtschaftliche genutzte Fläche,
die Waldfläche beträgt zirka 38500 Hektar. Damit ist der Landkreis
Kronach mit fast 60 Prozent Waldanteil eine der waldreichsten
Landschaften in Bayern. Von den rund 700 landwirtschaftlichen
Betrieben haben nur gut 100 mehr als 50 Hektar Fläche. Punkten kann
der Landkreis mit dem oberfrankenweit höchsten Ökoflächenanteil von
etwa 23 Prozent. Medlitz.
Draußen auf den Feldern steht ein Super-Raps und die Preise dafür
sind auf einem historischen Hoch: „Rapsanbau macht wieder Spaß“. Das
hat Klaus Siegelin, alter und neuer Vorsitzender der
Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps in Oberfranken bei der
Mitgliederversammlung in Medlitz bei Rattelsdorf festgestellt.
Medlitz.
Draußen auf den Feldern steht ein Super-Raps und die Preise dafür
sind auf einem historischen Hoch: „Rapsanbau macht wieder Spaß“. Das
hat Klaus Siegelin, alter und neuer Vorsitzender der
Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps in Oberfranken bei der
Mitgliederversammlung in Medlitz bei Rattelsdorf festgestellt.
 Bayreuth.
Glaube und Humor, das muss kein Widerspruch sein. Im Gegenteil:
Glaube und Humor geben sich die Hand. Das hat Pfarrer Hannes Schott
in seinem Referat beim ersten Online-Landfrauentag für Bayreuth und
Pegnitz festgestellt. Ähnlich ist es mit dem Thema der
Landfrauenarbeit in diesem Jahr. „Richtig gut leben“ lautet das
Generalthema. Doch wie soll das gehen, in Zeiten einer Vielzahl von
Vorwürfen gegen die Landwirtschaft.
Bayreuth.
Glaube und Humor, das muss kein Widerspruch sein. Im Gegenteil:
Glaube und Humor geben sich die Hand. Das hat Pfarrer Hannes Schott
in seinem Referat beim ersten Online-Landfrauentag für Bayreuth und
Pegnitz festgestellt. Ähnlich ist es mit dem Thema der
Landfrauenarbeit in diesem Jahr. „Richtig gut leben“ lautet das
Generalthema. Doch wie soll das gehen, in Zeiten einer Vielzahl von
Vorwürfen gegen die Landwirtschaft. Ebensfeld.
Der erste Eindruck täuscht: Auch wenn so viele Felder leuchtend gelb
blühen, Raps ist auf dem absteigenden Ast. Wurde vor zehn Jahren in
Oberfranken noch auf rund 21000 Hektar Raps angebaut, waren es vor
zwei Jahren nur noch 9800 Hektar. Auch wenn es derzeit wieder
bergauf zu gehen scheint und bezirksweit immerhin bereits wieder auf
fast 14000 Raps zu finden ist, suchen viele Bauern verstärkt nach
Alternativen. Das hat Klaus Siegelin, Vorsitzender der
Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps in Oberfranken und
stellvertretender BBV-Kreisobmann von Kronach, bei einem
Pressetermin auf Gut Ummersberg bei Ebensfeld im Landkreis
Loichtenfels festgestellt.
Ebensfeld.
Der erste Eindruck täuscht: Auch wenn so viele Felder leuchtend gelb
blühen, Raps ist auf dem absteigenden Ast. Wurde vor zehn Jahren in
Oberfranken noch auf rund 21000 Hektar Raps angebaut, waren es vor
zwei Jahren nur noch 9800 Hektar. Auch wenn es derzeit wieder
bergauf zu gehen scheint und bezirksweit immerhin bereits wieder auf
fast 14000 Raps zu finden ist, suchen viele Bauern verstärkt nach
Alternativen. Das hat Klaus Siegelin, Vorsitzender der
Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps in Oberfranken und
stellvertretender BBV-Kreisobmann von Kronach, bei einem
Pressetermin auf Gut Ummersberg bei Ebensfeld im Landkreis
Loichtenfels festgestellt. Bayreuth.
Einen Paradigmenwechsel im Gewässermanagement haben mehrere
Teilnehmer einer Podiumsdiskussion zum Thema „Zu wenig, zu warm:
Niedrigwasser in Bächen und Flüssen“ gefordert. Die Ämter für
Wasserwirtschaft und die Ämter für Landwirtschaft sollten dabei
künftig verstärkt zusammen und nicht gegeneinander arbeiten, so
lautete eine der Forderungen. „Wir müssen sämtliche Akteure
zusammenbringen, um Lösungen zu fordern“, sagte der Hydrogeologe
Jürgen Geist vom Wissenschaftszentrum Weihenstephan.
Bayreuth.
Einen Paradigmenwechsel im Gewässermanagement haben mehrere
Teilnehmer einer Podiumsdiskussion zum Thema „Zu wenig, zu warm:
Niedrigwasser in Bächen und Flüssen“ gefordert. Die Ämter für
Wasserwirtschaft und die Ämter für Landwirtschaft sollten dabei
künftig verstärkt zusammen und nicht gegeneinander arbeiten, so
lautete eine der Forderungen. „Wir müssen sämtliche Akteure
zusammenbringen, um Lösungen zu fordern“, sagte der Hydrogeologe
Jürgen Geist vom Wissenschaftszentrum Weihenstephan. Melkendorf.
Wer kennt sie nicht, die Tretminen auf den Gehwegen. Ein ganz
besonderes Problem haben Landwirte mit den Hinterlassenschaften von
Vierbeinern. Mit einer pfiffigen Idee macht derzeit der
Bauernverband in Melkendorf bei Kulmbach alle Hundebesitzer darauf
aufmerksam, dass Hundekot im Grünland schnell zu eine großen Problem
werden kann.
Melkendorf.
Wer kennt sie nicht, die Tretminen auf den Gehwegen. Ein ganz
besonderes Problem haben Landwirte mit den Hinterlassenschaften von
Vierbeinern. Mit einer pfiffigen Idee macht derzeit der
Bauernverband in Melkendorf bei Kulmbach alle Hundebesitzer darauf
aufmerksam, dass Hundekot im Grünland schnell zu eine großen Problem
werden kann. 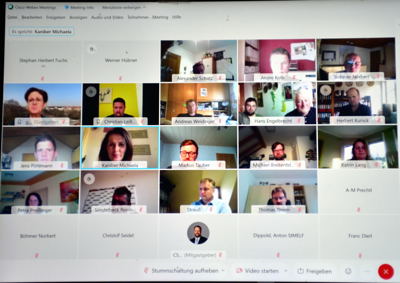 Bayreuth.
Die Wolfsrisse bei Betzenstein beschäftigen die Landwirte in
Oberfranken derzeit wie kein anderes Thema. Kaum ein Redner, der
sich bei einer von der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer
initiierten Online-Konferenz mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber nicht zum Wolf äußerte.
Bayreuth.
Die Wolfsrisse bei Betzenstein beschäftigen die Landwirte in
Oberfranken derzeit wie kein anderes Thema. Kaum ein Redner, der
sich bei einer von der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer
initiierten Online-Konferenz mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber nicht zum Wolf äußerte.  Thurnau.
Die Wiederentdeckung der schwarzen Wundererde „Terra Preta“ hat
ihren Anfang in Oberfranken genommen. Hier waren Vater Uwe und Sohn
Aaron Saßmannshausen zusammen mit dem aus dem Fichtelgebirge
stammenden Bodenbiogeochemiker Bruno Glaser zum ersten Mal auf das
Thema gekommen. Heute wird die nach dem Vorbild der
Amazonas-Ureinwohner gefertigte Erde industriell in Thurnau
hergestellt. Gebrauchsfertig bekommt man sie in (fast) jedem Bau-
und Gartenmarkt. Damit werden Ökonomie und Ökologie sinnvoll
verbunden, sagte die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer bei
einem Besuch auf dem Firmengelände im Industriegebiet von Thurnau.
Thurnau.
Die Wiederentdeckung der schwarzen Wundererde „Terra Preta“ hat
ihren Anfang in Oberfranken genommen. Hier waren Vater Uwe und Sohn
Aaron Saßmannshausen zusammen mit dem aus dem Fichtelgebirge
stammenden Bodenbiogeochemiker Bruno Glaser zum ersten Mal auf das
Thema gekommen. Heute wird die nach dem Vorbild der
Amazonas-Ureinwohner gefertigte Erde industriell in Thurnau
hergestellt. Gebrauchsfertig bekommt man sie in (fast) jedem Bau-
und Gartenmarkt. Damit werden Ökonomie und Ökologie sinnvoll
verbunden, sagte die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer bei
einem Besuch auf dem Firmengelände im Industriegebiet von Thurnau.
.jpg) Bayreuth.
Ihr Name klingt so, als hätte sie Wilhelm Busch für eine seiner
Bildergeschichten erfunden. Doch die seltene Dicke Trespe (Bromus
grossus) heißt wirklich so. Im Gegensatz zu anderen Trespenarten ist
sie bei weitem kein Unkraut, sondern eine uralte, schon in der
Steinzeit kultivierte und noch im Mittelalter genutzte Grasart, die
im 20. Jahrhundert nahezu völlig verschwunden war. Pedro Gerstberger,
bislang am Lehrstuhl für Pflanzenökologie an der Universität
Bayreuth tätig, führt derzeit mit den Landwirtschaftlichen
Lehranstalten des Bezirks Oberfranken, dem Kulmbacher
Lebensmittelhersteller IREKS und dem Uni-Lehrstuhl für
Bioprozesstechnik ein Forschungsprojekt durch , in dem die Dicke
Trespe erstmals auf Back- und Bierbraueigenschaften untersucht wird.
Gefördert wird das Projekt von der Oberfrankenstiftung.
Bayreuth.
Ihr Name klingt so, als hätte sie Wilhelm Busch für eine seiner
Bildergeschichten erfunden. Doch die seltene Dicke Trespe (Bromus
grossus) heißt wirklich so. Im Gegensatz zu anderen Trespenarten ist
sie bei weitem kein Unkraut, sondern eine uralte, schon in der
Steinzeit kultivierte und noch im Mittelalter genutzte Grasart, die
im 20. Jahrhundert nahezu völlig verschwunden war. Pedro Gerstberger,
bislang am Lehrstuhl für Pflanzenökologie an der Universität
Bayreuth tätig, führt derzeit mit den Landwirtschaftlichen
Lehranstalten des Bezirks Oberfranken, dem Kulmbacher
Lebensmittelhersteller IREKS und dem Uni-Lehrstuhl für
Bioprozesstechnik ein Forschungsprojekt durch , in dem die Dicke
Trespe erstmals auf Back- und Bierbraueigenschaften untersucht wird.
Gefördert wird das Projekt von der Oberfrankenstiftung..jpg) Ähnlich
wie beim Roggen entwickelte sich die Trespe aus einer Wildart durch
die Jahrtausende lange Inkulturnahme und unbewusste Auslese durch
den Menschen. „Die Dicke Trespe hat es fast zu einem Getreide
geschafft´, indem sie sich an die besonderen Bedingungen des
Ackerbaus und der nachfolgenden Ernte angepasst hat“, erläutert
Gerstberger. Am besten sei die Trespe noch mit Hafer vergleichbar.
Der Wissenschaftler rechnet mit einem Ertrag von gut 40
Doppelzentner pro Hektar. Doch bis es soweit ist, müsse man erst
einmal herausfinden, was man mit der Trespe eigentlich alles
anstellen kann.
Ähnlich
wie beim Roggen entwickelte sich die Trespe aus einer Wildart durch
die Jahrtausende lange Inkulturnahme und unbewusste Auslese durch
den Menschen. „Die Dicke Trespe hat es fast zu einem Getreide
geschafft´, indem sie sich an die besonderen Bedingungen des
Ackerbaus und der nachfolgenden Ernte angepasst hat“, erläutert
Gerstberger. Am besten sei die Trespe noch mit Hafer vergleichbar.
Der Wissenschaftler rechnet mit einem Ertrag von gut 40
Doppelzentner pro Hektar. Doch bis es soweit ist, müsse man erst
einmal herausfinden, was man mit der Trespe eigentlich alles
anstellen kann. Kulmbach.
Eine überwiegend positive Bilanz ziehen die Verantwortlichen beim
Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach über das zurückliegende
Jahr. Zwar seien die geleisteten Stunden sowohl bei der klassischen
sozialen Betriebshilfe als auch bei der wirtschaftlichen
Betriebshilfe zurückgegangen, jedoch habe man den Verrechnungswert
bei der Maschinenvermittlung steigern können, so Geschäftsführer
Werner Friedlein.
Kulmbach.
Eine überwiegend positive Bilanz ziehen die Verantwortlichen beim
Maschinen- und Betriebshilfsring Kulmbach über das zurückliegende
Jahr. Zwar seien die geleisteten Stunden sowohl bei der klassischen
sozialen Betriebshilfe als auch bei der wirtschaftlichen
Betriebshilfe zurückgegangen, jedoch habe man den Verrechnungswert
bei der Maschinenvermittlung steigern können, so Geschäftsführer
Werner Friedlein.  Hollfeld.
Die Situation ist bei allen Waldbesitzervereinigungen die gleiche:
die Menge des vermarkteten Holzes ist gewaltig angestiegen,
gleichzeitig sind die Erlöse immens eingebrochen. Schuld daran sind
Corona und der Borkenkäfer. Ganz besonders hat es die WBV Hollfeld
mit ihren knapp 1600 Mitgliedern aus den Landkreisen Bamberg,
Bayreuth und Kulmbach erwischt. „Der Umsatz hat rapide abgenommen
und ist um etwa ein Drittel eingebrochen“, sagt der Vorsitzende
Christian Dormann. Gleichzeitig sei die Menge des für die Mitglieder
vermarkteten Holzes von rund 25000 auf etwa 30000 Festmeter
angestiegen.
Hollfeld.
Die Situation ist bei allen Waldbesitzervereinigungen die gleiche:
die Menge des vermarkteten Holzes ist gewaltig angestiegen,
gleichzeitig sind die Erlöse immens eingebrochen. Schuld daran sind
Corona und der Borkenkäfer. Ganz besonders hat es die WBV Hollfeld
mit ihren knapp 1600 Mitgliedern aus den Landkreisen Bamberg,
Bayreuth und Kulmbach erwischt. „Der Umsatz hat rapide abgenommen
und ist um etwa ein Drittel eingebrochen“, sagt der Vorsitzende
Christian Dormann. Gleichzeitig sei die Menge des für die Mitglieder
vermarkteten Holzes von rund 25000 auf etwa 30000 Festmeter
angestiegen. Scheßlitz.
Für die Waldbesitzer im Landkreis Bamberg ist es im zurückliegenden
Jahr knüppeldick gekommen. Von der Gesamtmenge von rund 42000
vermarkteten Festmetern Holz seien 39500 Festmeter Fichtenholz
gewesen, „und zwar zu 100 Prozent Schadholz“, sagt Geschäftsführer
Patrick Hammerschmidt.
Scheßlitz.
Für die Waldbesitzer im Landkreis Bamberg ist es im zurückliegenden
Jahr knüppeldick gekommen. Von der Gesamtmenge von rund 42000
vermarkteten Festmetern Holz seien 39500 Festmeter Fichtenholz
gewesen, „und zwar zu 100 Prozent Schadholz“, sagt Geschäftsführer
Patrick Hammerschmidt.  Küps. Die Corona-Pandemie und die Afrikanische Schweinepest
haben in den zurückliegenden Monaten dazu geführt, dass
Ferkelerzeuger in große Bedrängnis geraten sind. „Die Preise sind
ins Bodenlose gefallen“, sagt Reiner Herr vom „Schafhof“ bei Küps.
Bei einem virtuellen Stallgespräch für die örtliche Presse ließ er
zusammen mit seiner Frau Marina nicht nur einen offenen und
ehrlichen Einblick in seine Stallungen zu, sondern nahm auch
Stellung zur derzeitigen Situation. Marina Herr ist stellvertretende
Kreisbäuerin und Ernährungsfachfrau des BBV, Reiner Herr ist
Ortsobmann.
Küps. Die Corona-Pandemie und die Afrikanische Schweinepest
haben in den zurückliegenden Monaten dazu geführt, dass
Ferkelerzeuger in große Bedrängnis geraten sind. „Die Preise sind
ins Bodenlose gefallen“, sagt Reiner Herr vom „Schafhof“ bei Küps.
Bei einem virtuellen Stallgespräch für die örtliche Presse ließ er
zusammen mit seiner Frau Marina nicht nur einen offenen und
ehrlichen Einblick in seine Stallungen zu, sondern nahm auch
Stellung zur derzeitigen Situation. Marina Herr ist stellvertretende
Kreisbäuerin und Ernährungsfachfrau des BBV, Reiner Herr ist
Ortsobmann.  Bayreuth.
Auf den ersten Blick klingt die Bilanz gut: Rund 28300 Festmeter
Holz hat die Waldbauernvereinigung Bayreuth im zurückliegenden Jahr
im Auftrag ihrer Mitglieder vermarktet, das ist deutlich mehr, als
noch im Jahr zuvor (rund 22800 Festmeter). Das allerdings ist nur
die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit kommt die Zahl einem Einbruch
gleich. Schuld daran ist der Borkenkäfer, der 2020 wie lange nicht
mehr sein Unwesen getrieben hat. Der Preis pro Festmeter Käferholz
fiel auf etwa 25 Euro, der eine oder andere Waldbesitzer hat
aufgrund schlechterer Qualitäten im Schnitt nur mehr 18 Euro
bekommen, was einem historisch niedrigem Niveau gleichkommt, so dass
viele Waldbesitzer letztlich draufzahlen mussten.
Bayreuth.
Auf den ersten Blick klingt die Bilanz gut: Rund 28300 Festmeter
Holz hat die Waldbauernvereinigung Bayreuth im zurückliegenden Jahr
im Auftrag ihrer Mitglieder vermarktet, das ist deutlich mehr, als
noch im Jahr zuvor (rund 22800 Festmeter). Das allerdings ist nur
die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit kommt die Zahl einem Einbruch
gleich. Schuld daran ist der Borkenkäfer, der 2020 wie lange nicht
mehr sein Unwesen getrieben hat. Der Preis pro Festmeter Käferholz
fiel auf etwa 25 Euro, der eine oder andere Waldbesitzer hat
aufgrund schlechterer Qualitäten im Schnitt nur mehr 18 Euro
bekommen, was einem historisch niedrigem Niveau gleichkommt, so dass
viele Waldbesitzer letztlich draufzahlen mussten. Betzenstein.
„Es hätte schlimmer kommen können“, sagt Werner Lautner, erster
Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Pegnitz. Trotz Corona und
trotz Käfer stehe die FBG gar nicht so schlecht da. Trotzdem mache
der Lockdown den Waldbauern gewaltig zu schaffen.
Betzenstein.
„Es hätte schlimmer kommen können“, sagt Werner Lautner, erster
Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Pegnitz. Trotz Corona und
trotz Käfer stehe die FBG gar nicht so schlecht da. Trotzdem mache
der Lockdown den Waldbauern gewaltig zu schaffen.  Kulmbach.
Von einem echten Sorgenjahr für die Landwirtschaft hat
BBV-Kreisobmann Wilfried Löwinger bei der ersten digitalen
Kreisversammlung gesprochen. Dabei war und ist es nicht nur die
Corona-Pandemie, die den Bauern zu schaffen macht, sondern auch
viele andere Dinge machen ihnen das Leben schwer. Als Beispiele
nannte der Kreisobmann die Verschärfung von Dünge- und
Nutztierhalteverordnung, die Afrikanische Schweinepest, die
Diskussionen um die Neuausrichtung der gemeinsamen europäischen
Agrarpolitik, die Beratungen um die Insektenschutzverordnung, der
Preisverfall auf dem Schweinemarkt oder die Diskussion um erste
große Wolfsrisse in Oberfranken.
Kulmbach.
Von einem echten Sorgenjahr für die Landwirtschaft hat
BBV-Kreisobmann Wilfried Löwinger bei der ersten digitalen
Kreisversammlung gesprochen. Dabei war und ist es nicht nur die
Corona-Pandemie, die den Bauern zu schaffen macht, sondern auch
viele andere Dinge machen ihnen das Leben schwer. Als Beispiele
nannte der Kreisobmann die Verschärfung von Dünge- und
Nutztierhalteverordnung, die Afrikanische Schweinepest, die
Diskussionen um die Neuausrichtung der gemeinsamen europäischen
Agrarpolitik, die Beratungen um die Insektenschutzverordnung, der
Preisverfall auf dem Schweinemarkt oder die Diskussion um erste
große Wolfsrisse in Oberfranken. Betzenstein.
In einem Wildgehege in Illafeld bei Betzenstein waren 18 gerissene
Tiere gefunden worden, in einem Gehege im nur zwei Kilometer
entfernten Riegelstein sieben tote Tiere. Experten sind sich sicher,
dass das Damwild einem oder mehreren Wölfen zum Opfer gefallen ist.
Bei dem Vorfall waren allen Tieren die Kehlen durchgebissen worden.
Einer der Kadaver in Illafeld zeige zudem ein für Wölfe typisches
Fraßbild. Wie viele Wölfe in das Wildgehege eingedrungen waren,
könne derzeit noch nicht gesagt werden, heißt es. Zwar sei der Zaun
an einer Stelle untergraben worden, über die Anzahl der
eingedrungenen Tiere lasse das aber keine Rückschlüsse zu.
Betzenstein.
In einem Wildgehege in Illafeld bei Betzenstein waren 18 gerissene
Tiere gefunden worden, in einem Gehege im nur zwei Kilometer
entfernten Riegelstein sieben tote Tiere. Experten sind sich sicher,
dass das Damwild einem oder mehreren Wölfen zum Opfer gefallen ist.
Bei dem Vorfall waren allen Tieren die Kehlen durchgebissen worden.
Einer der Kadaver in Illafeld zeige zudem ein für Wölfe typisches
Fraßbild. Wie viele Wölfe in das Wildgehege eingedrungen waren,
könne derzeit noch nicht gesagt werden, heißt es. Zwar sei der Zaun
an einer Stelle untergraben worden, über die Anzahl der
eingedrungenen Tiere lasse das aber keine Rückschlüsse zu. Aufseß.
Die Stimmung bei den Landwirten ist schlecht. „Viele Bauern sind
frustriert und verunsichert und wissen nicht, wie es weitergehen
soll“, sagt Manuel Appel, Geschäftsführer des Maschinenrings
Fränkische Schweiz mit Sitz in Aufseß. Dabei stehe nicht nur die
Düngeverordnung im Zentrum der Kritik, sondern vor allem die
ausufernde Bürokratie durch immer neue Dokumentationspflichten. Beim
Maschinenring bekommen Appel und seine Mitstreiter den Ärger der
Bauern derzeit immer wieder zu spüren.
Aufseß.
Die Stimmung bei den Landwirten ist schlecht. „Viele Bauern sind
frustriert und verunsichert und wissen nicht, wie es weitergehen
soll“, sagt Manuel Appel, Geschäftsführer des Maschinenrings
Fränkische Schweiz mit Sitz in Aufseß. Dabei stehe nicht nur die
Düngeverordnung im Zentrum der Kritik, sondern vor allem die
ausufernde Bürokratie durch immer neue Dokumentationspflichten. Beim
Maschinenring bekommen Appel und seine Mitstreiter den Ärger der
Bauern derzeit immer wieder zu spüren. Ahornberg.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg und Umgebung hat sich
im Corona-Jahr 2020 erfolgreich gegen den Trend gestemmt. „Der
Verrechnungswert des Vorjahres wurde um rund elf Prozent übertroffen
und stieg von knapp 3,9 auf über 4,3 Millionen Euro an“, sagt
Geschäftsführer Patrick Heerdegen, der von einem „wirklich tollen
Ergebnis“ spricht. Man könne sich über die wirtschaftliche Lage
nicht beklagen, „bei uns läuft es richtig gut“.
Ahornberg.
Der Maschinen- und Betriebshilfsring Münchberg und Umgebung hat sich
im Corona-Jahr 2020 erfolgreich gegen den Trend gestemmt. „Der
Verrechnungswert des Vorjahres wurde um rund elf Prozent übertroffen
und stieg von knapp 3,9 auf über 4,3 Millionen Euro an“, sagt
Geschäftsführer Patrick Heerdegen, der von einem „wirklich tollen
Ergebnis“ spricht. Man könne sich über die wirtschaftliche Lage
nicht beklagen, „bei uns läuft es richtig gut“. Wunsiedel.
Im Fichtelgebirge geht die Arbeit des Maschinen- und
Betriebshilfsrings trotz der Corona-Pandemie unverändert weiter. Der
Gesamtverrechnungswert des Rings in Wunsiedel konnte im
zurückliegenden Jahr sogar leicht gesteigert werden, was sich im
Wesentlichen auf einen Anstieg bei der Maschinenvermittlung
zurückführen lässt. In der Betriebshilfe ging der Wert nur minimal
zurück. Abgesagt werden mussten allerdings zahlreiche
Präsenzveranstaltungen wie der Praxistag mit den Jungzüchtern, die
Betriebshelferfortbildungen oder das traditionelle Sommerfest mit
dem die Arbeit aller Beteiligten gewürdigt werden sollte, die
turnusgemäßen Neuwahlen stehen dagegen erst im kommenden Jahr an.
Wunsiedel.
Im Fichtelgebirge geht die Arbeit des Maschinen- und
Betriebshilfsrings trotz der Corona-Pandemie unverändert weiter. Der
Gesamtverrechnungswert des Rings in Wunsiedel konnte im
zurückliegenden Jahr sogar leicht gesteigert werden, was sich im
Wesentlichen auf einen Anstieg bei der Maschinenvermittlung
zurückführen lässt. In der Betriebshilfe ging der Wert nur minimal
zurück. Abgesagt werden mussten allerdings zahlreiche
Präsenzveranstaltungen wie der Praxistag mit den Jungzüchtern, die
Betriebshelferfortbildungen oder das traditionelle Sommerfest mit
dem die Arbeit aller Beteiligten gewürdigt werden sollte, die
turnusgemäßen Neuwahlen stehen dagegen erst im kommenden Jahr an. Bayreuth.
Natürlich hat die Corona-Pandemie die Arbeit der Maschinenringe im
zurückliegenden Jahr stark beeinflusst. „Trotzdem,
Abrechnungsservice, Futtervermittlung, Maschinenvermittlung und
Maschinenverleih laufen unverändert weiter“, so Geschäftsführer
Johannes Scherm vom Maschinenring Bayreuth-Pegnitz. Auch die
Geschäftsstelle in Bayreuth sei durchgehend besetzt gewesen und habe
nicht geschlossen werden müssen. Der Besucherverkehr sei freilich
auf ein Mindestmaß reduziert worden.
Bayreuth.
Natürlich hat die Corona-Pandemie die Arbeit der Maschinenringe im
zurückliegenden Jahr stark beeinflusst. „Trotzdem,
Abrechnungsservice, Futtervermittlung, Maschinenvermittlung und
Maschinenverleih laufen unverändert weiter“, so Geschäftsführer
Johannes Scherm vom Maschinenring Bayreuth-Pegnitz. Auch die
Geschäftsstelle in Bayreuth sei durchgehend besetzt gewesen und habe
nicht geschlossen werden müssen. Der Besucherverkehr sei freilich
auf ein Mindestmaß reduziert worden. Bayreuth.
Für das zurückliegende Zuchtjahr muss der Rinderzuchtverband
Oberfranken erneut ein rückläufiges Ergebnis vermelden. Wie aus dem
jetzt vorgelegten Jahresbericht hervorgeht, sind die
Vermarktungszahlen um gut 1600 auf 30400 Tiere zurückgegangen, der
Umsatz verringerte sich um etwa eine Million Euro auf rund 14,9
Millionen Euro. Als wesentliche Ursachen dafür nennen der
Vorsitzende Georg Hollfelder aus Litzendorf im Landkreis Bamberg und
Zuchtleiter Markus Schricker die verminderten Kuhzahlen, niedrigere
Preise, das Wetter und die Corona-Krise. Das Geschäftsjahr des
Rinderzuchtverbandes ist nicht identisch mit dem Kalenderjahr. Es
beginnt immer am 1. Oktober und endet am 30. September.
Bayreuth.
Für das zurückliegende Zuchtjahr muss der Rinderzuchtverband
Oberfranken erneut ein rückläufiges Ergebnis vermelden. Wie aus dem
jetzt vorgelegten Jahresbericht hervorgeht, sind die
Vermarktungszahlen um gut 1600 auf 30400 Tiere zurückgegangen, der
Umsatz verringerte sich um etwa eine Million Euro auf rund 14,9
Millionen Euro. Als wesentliche Ursachen dafür nennen der
Vorsitzende Georg Hollfelder aus Litzendorf im Landkreis Bamberg und
Zuchtleiter Markus Schricker die verminderten Kuhzahlen, niedrigere
Preise, das Wetter und die Corona-Krise. Das Geschäftsjahr des
Rinderzuchtverbandes ist nicht identisch mit dem Kalenderjahr. Es
beginnt immer am 1. Oktober und endet am 30. September. Bayreuth.
Der Ausstieg aus der Milchviehhaltung geht weiter. Das geht aus dem
aktuellen Jahresbericht des Milcherzeugerrings Oberfranken hervor.
Demnach zeichnet sich auch in Zukunft ein relativ konstanter
Ausstieg ab.
Bayreuth.
Der Ausstieg aus der Milchviehhaltung geht weiter. Das geht aus dem
aktuellen Jahresbericht des Milcherzeugerrings Oberfranken hervor.
Demnach zeichnet sich auch in Zukunft ein relativ konstanter
Ausstieg ab. .jpg) Mitwitz.
Der Biber macht den oberfränkischen Teichwirten derzeit wieder
immens zu schaffen. „Alle Beteiligten müssen sich Gedanken machen,
wie wir mit dieser Problematik umgehen, wenn wir eine naturnahe
Teichwirtschaft auch in Zukunft aufrechterhalten wollen“, sagt
Christian Holoch, Betriebsleiter der forstlichen Güterverwaltung in
Mitwitz. (Landkreis Kronach) Holoch ist auch Beirat der
Teichgenossenschaft Oberfranken, er bewirtschaftet rund 30 Hektar
Gewässer rund um Mitwitz.
Mitwitz.
Der Biber macht den oberfränkischen Teichwirten derzeit wieder
immens zu schaffen. „Alle Beteiligten müssen sich Gedanken machen,
wie wir mit dieser Problematik umgehen, wenn wir eine naturnahe
Teichwirtschaft auch in Zukunft aufrechterhalten wollen“, sagt
Christian Holoch, Betriebsleiter der forstlichen Güterverwaltung in
Mitwitz. (Landkreis Kronach) Holoch ist auch Beirat der
Teichgenossenschaft Oberfranken, er bewirtschaftet rund 30 Hektar
Gewässer rund um Mitwitz..jpg) Sauer
stößt es den betroffenen Teichwirten auf, wenn die Situation von
Seite des Naturschutzes verharmlost wird. In den Naturschutzbehörden
sei vielerorts bereits ein Problembewusstsein entstanden, ganz im
Gegensatz zu den Naturschutzverbänden. Dort sei es oft noch nicht
klar, dass die seit Jahrhunderten gewachsene Teichwirtschaft ein
ebenso schützenswertes Gut sei.
Sauer
stößt es den betroffenen Teichwirten auf, wenn die Situation von
Seite des Naturschutzes verharmlost wird. In den Naturschutzbehörden
sei vielerorts bereits ein Problembewusstsein entstanden, ganz im
Gegensatz zu den Naturschutzverbänden. Dort sei es oft noch nicht
klar, dass die seit Jahrhunderten gewachsene Teichwirtschaft ein
ebenso schützenswertes Gut sei.  Döhlau.
Einst markierte sie den Beginn der Elektrifizierung, jetzt soll sie
vielerorts platt gemacht werden: die Kleine Wasserkraft. „Die
Betreiber werden mit Auflagen so sehr gegängelt, dass sie den
Forderungen nicht mehr nachkommen können und aufgeben müssen“, sagt
Reinhard Moosdorf aus Tüchersfeld von der Interessengemeinschaft
„Strom aus Wasserkraft“. Die Mitglieder sprechen einhellig von einer
„Zerstörung von Existenzen“ und vom „Kahlschlag in der
Gewässerökologie“. Dabei gibt es die Anlagen schon seit
Jahrhunderten und jetzt sollen sie plötzlich bedenklich für den
Fischbestand sein.
Döhlau.
Einst markierte sie den Beginn der Elektrifizierung, jetzt soll sie
vielerorts platt gemacht werden: die Kleine Wasserkraft. „Die
Betreiber werden mit Auflagen so sehr gegängelt, dass sie den
Forderungen nicht mehr nachkommen können und aufgeben müssen“, sagt
Reinhard Moosdorf aus Tüchersfeld von der Interessengemeinschaft
„Strom aus Wasserkraft“. Die Mitglieder sprechen einhellig von einer
„Zerstörung von Existenzen“ und vom „Kahlschlag in der
Gewässerökologie“. Dabei gibt es die Anlagen schon seit
Jahrhunderten und jetzt sollen sie plötzlich bedenklich für den
Fischbestand sein.  Itzgrund.
Gegen den Erzeugerzusammenschluss Ökofranken werden von Mitgliedern
schwere Vorwürfe erhoben. Nachdem der Vermarktungspool seit dem Jahr
2017 nicht mehr aufgelöst worden sei, sollen weit über 100 Bauern
jeweils hohe fünfstellige Beträge zurückzahlen. Grund dafür sei die
schlechte Marktlage. Ökofranken eG. Ist ein Zusammenschluss mit rund
300 Mitgliedern für ökologisch erzeugte landwirtschaftliche Produkte
in Oberfranken und angrenzenden Gebieten mit Sitz in Itzgrund
(Landkreis Coburg). Die Bauern müssen dabei keinem Anbauverband
angehören, sie können auch die nach niedrigeren Standards erzeigte
EU-Ökoware liefern.
Itzgrund.
Gegen den Erzeugerzusammenschluss Ökofranken werden von Mitgliedern
schwere Vorwürfe erhoben. Nachdem der Vermarktungspool seit dem Jahr
2017 nicht mehr aufgelöst worden sei, sollen weit über 100 Bauern
jeweils hohe fünfstellige Beträge zurückzahlen. Grund dafür sei die
schlechte Marktlage. Ökofranken eG. Ist ein Zusammenschluss mit rund
300 Mitgliedern für ökologisch erzeugte landwirtschaftliche Produkte
in Oberfranken und angrenzenden Gebieten mit Sitz in Itzgrund
(Landkreis Coburg). Die Bauern müssen dabei keinem Anbauverband
angehören, sie können auch die nach niedrigeren Standards erzeigte
EU-Ökoware liefern.  Scheßlitz.
Unter dem Motto „Schluss mit lustig – uns geht die Luft aus“ haben
Mitglieder der Bewegung „Land schafft Verbindung“ (LSV) und des
Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) ein Forderungspapier
an die Verantwortlichen von Molkereien und Schlachtbetriebe
überreicht. Darin verlangen sie deutlich höhere Erlöse für Milch,
Rinder, Schweine und Geflügel. In Scheßlitz (Landkreis Bamberg)
überreichten Marianne Schuster aus Pödeldorf für den BDM und Michael
Gabler aus Straßgiech (LSV) ein entsprechendes Papier an
Geschäftsleiter Wolfgang Dötzer und an zuständigen Betreuer der
Landwirte Johannes Mahr von dem zur Frischli-Gruppe gehörenden
Milchhof Albert.
Scheßlitz.
Unter dem Motto „Schluss mit lustig – uns geht die Luft aus“ haben
Mitglieder der Bewegung „Land schafft Verbindung“ (LSV) und des
Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM) ein Forderungspapier
an die Verantwortlichen von Molkereien und Schlachtbetriebe
überreicht. Darin verlangen sie deutlich höhere Erlöse für Milch,
Rinder, Schweine und Geflügel. In Scheßlitz (Landkreis Bamberg)
überreichten Marianne Schuster aus Pödeldorf für den BDM und Michael
Gabler aus Straßgiech (LSV) ein entsprechendes Papier an
Geschäftsleiter Wolfgang Dötzer und an zuständigen Betreuer der
Landwirte Johannes Mahr von dem zur Frischli-Gruppe gehörenden
Milchhof Albert..jpg) Großheirath.
„Nicht nur am Amazonas brennen die Wälder, auch Frankens Wälder
brennen, jedoch ohne Rauch. Die Folgen aber sind die Gleichen.“ Mit
diesen dramatischen Worten hat der Vorsitzende der
Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberfranken Wolfgang Schultheiß
beschrieben, was die oberfränkischen Waldbauern derzeit umtreibt.
Bei einem Besuch von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner
in Großheirath machte Schultheiß klar, dass ein Nachwachsen des
Rohstoffes Holz künftig so nicht mehr stattfinden wird. Nicht nur
die Erholungsfunktion der Wälder gehe dabei verloren, auch ein Stück
Heimat bleibe auf der Strecke.
Großheirath.
„Nicht nur am Amazonas brennen die Wälder, auch Frankens Wälder
brennen, jedoch ohne Rauch. Die Folgen aber sind die Gleichen.“ Mit
diesen dramatischen Worten hat der Vorsitzende der
Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberfranken Wolfgang Schultheiß
beschrieben, was die oberfränkischen Waldbauern derzeit umtreibt.
Bei einem Besuch von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner
in Großheirath machte Schultheiß klar, dass ein Nachwachsen des
Rohstoffes Holz künftig so nicht mehr stattfinden wird. Nicht nur
die Erholungsfunktion der Wälder gehe dabei verloren, auch ein Stück
Heimat bleibe auf der Strecke..jpg) Als
absolut falsch bezeichnete Klöckner die Forderung aus dem
Bundesumweltministerium, Wald stillzulegen. Waldstilllegungsprämien
stellten ein großes Problem dar, sagte sie. Stattdessen sollte ein
Mix zur Naturverjüngung standortangepasster Wälder geschaffen
werden. Auch die Ausgewogenheit von Wald und Wild lag der Ministerin
am Herzen. „Es dürfe weder Wald vor Wild, noch Wild vor Wald
heißen“, so Klöckner. Derartige Schlagworte würden nicht
weiterhelfen. Vielmehr seien die Waldbauern aufgefordert, durch
entsprechende Maßnahmen einen Verbissschutz zu schaffen.
Als
absolut falsch bezeichnete Klöckner die Forderung aus dem
Bundesumweltministerium, Wald stillzulegen. Waldstilllegungsprämien
stellten ein großes Problem dar, sagte sie. Stattdessen sollte ein
Mix zur Naturverjüngung standortangepasster Wälder geschaffen
werden. Auch die Ausgewogenheit von Wald und Wild lag der Ministerin
am Herzen. „Es dürfe weder Wald vor Wild, noch Wild vor Wald
heißen“, so Klöckner. Derartige Schlagworte würden nicht
weiterhelfen. Vielmehr seien die Waldbauern aufgefordert, durch
entsprechende Maßnahmen einen Verbissschutz zu schaffen..jpg) Zuvor
hatte der Abgeordnete Michelbach die über 18000 Hektar Wald in
seinem Landkreis nicht nur als wichtiges Erholungsgebiet und
bedeutenden Lebensraum für Tiere und Pflanzen bezeichnet. Der Wald
sei vor allem auch wichtiger Wirtschaftsfaktor. Geld für den Wald
sei deshalb auch immer gut angelegtes Geld.
Zuvor
hatte der Abgeordnete Michelbach die über 18000 Hektar Wald in
seinem Landkreis nicht nur als wichtiges Erholungsgebiet und
bedeutenden Lebensraum für Tiere und Pflanzen bezeichnet. Der Wald
sei vor allem auch wichtiger Wirtschaftsfaktor. Geld für den Wald
sei deshalb auch immer gut angelegtes Geld.  Bayreuth.
Bodenvergifter, Giftspritzer, Tierquäler: Das Image der
Landwirtschaft in weiten Teilen der Bevölkerung ist nicht gerade das
Beste. Andreas Wolfrum aus Döberlitz im Landkreis Hof hat bereits
2017 eine umfassende Social-Media-Kampagne gestartet, um das zu
ändern. Beim Infotreff Milch des Verbandes der Bayerischen
Milcherzeuger (VMB) in Bayreuth stellte der 29-.jährige Landwirt
seine Aktivitäten vor und ermunterte die Berufskollegen, aktiv zu
werden: „Wir müssen selbst agieren und nicht immer nur reagieren“.
Bayreuth.
Bodenvergifter, Giftspritzer, Tierquäler: Das Image der
Landwirtschaft in weiten Teilen der Bevölkerung ist nicht gerade das
Beste. Andreas Wolfrum aus Döberlitz im Landkreis Hof hat bereits
2017 eine umfassende Social-Media-Kampagne gestartet, um das zu
ändern. Beim Infotreff Milch des Verbandes der Bayerischen
Milcherzeuger (VMB) in Bayreuth stellte der 29-.jährige Landwirt
seine Aktivitäten vor und ermunterte die Berufskollegen, aktiv zu
werden: „Wir müssen selbst agieren und nicht immer nur reagieren“. Kulmbach.
Auf eine knapp unterdurchschnittliche Ernte können die Landwirte im
Landkreis Kulmbach zurückblicken. „Die Bestände sind nicht
überragend, aber trotz aller Wetterkapriolen können wir mit dem
zurückliegenden Erntejahr zufrieden sein“, sagte BBV-Kreisobmann
Wilfried Löwinger im Vorfeld des Erntedankfestes, das heuer
Corona-bedingt nicht, wie ursprünglich geplant, in großem Rahmen
gefeiert werden kann.
Kulmbach.
Auf eine knapp unterdurchschnittliche Ernte können die Landwirte im
Landkreis Kulmbach zurückblicken. „Die Bestände sind nicht
überragend, aber trotz aller Wetterkapriolen können wir mit dem
zurückliegenden Erntejahr zufrieden sein“, sagte BBV-Kreisobmann
Wilfried Löwinger im Vorfeld des Erntedankfestes, das heuer
Corona-bedingt nicht, wie ursprünglich geplant, in großem Rahmen
gefeiert werden kann. .jpg) Bayreuth.
Die Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftlich genutzten
Flächen ist nach der Novellierung der Düngemittelverordnung
eigentlich nicht mehr möglich. Also muss man sich auf der Suche nach
neuen Lösungen machen. Eine besonders innovative Lösung gibt es
schon seit 2016 im Bayreuther Klärwerk. Hier entstand eine solare
Trocknungsanlage, mit deren Hilfe die Menge des mechanisch
entwässerten Schlamms aus den Faultürmen von rund 11000 Tonnen pro
Jahr auf etwa 3700 Tonnen pro Jahr verringert wird. Wie das
funktioniert, das konnten zahlreiche Bürgermeister aus dem Landkreis
bei einer von der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel Fischer
organisierten Führung durch das Klärwerk erleben.
Bayreuth.
Die Ausbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftlich genutzten
Flächen ist nach der Novellierung der Düngemittelverordnung
eigentlich nicht mehr möglich. Also muss man sich auf der Suche nach
neuen Lösungen machen. Eine besonders innovative Lösung gibt es
schon seit 2016 im Bayreuther Klärwerk. Hier entstand eine solare
Trocknungsanlage, mit deren Hilfe die Menge des mechanisch
entwässerten Schlamms aus den Faultürmen von rund 11000 Tonnen pro
Jahr auf etwa 3700 Tonnen pro Jahr verringert wird. Wie das
funktioniert, das konnten zahlreiche Bürgermeister aus dem Landkreis
bei einer von der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel Fischer
organisierten Führung durch das Klärwerk erleben..jpg) Vertragspartner
für die Klärschlammentsorgung ist das Unternehmen Südwasser. Das
Tochterunternehmen der Bayernwerk AG verwertet den Klärschlamm
thermisch über Zementwerke, Kohlekraftwerke und
Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen. Konkret hat die solare
Trocknungsanlage eine Größe von 120 mal 60 Metern, sie ist damit so
groß wie ein Fußballfeld. Sie sieht aus, wie ein herkömmliches
Gewächshaus, in dem sich der Schlamm zur Trocknung auf fünf Straßen
verteilt. Die Wärme kommt von der Sonne und von der benachbarten
Biogasanlage. Wie beim einem Heuwender wird der trockene Schlamm
ständig nach unten und der feuchte nach oben transportiert. Die
feuchte Luft wird über Abluftwäscher nach außen transportiert. Nach
einem Monat bleiben 90 Prozent Trockenmasse und zehn Prozent Wasser
übrig. Die Trockenmasse wird wöchentlich von drei Lkw abgeholt.
Vertragspartner
für die Klärschlammentsorgung ist das Unternehmen Südwasser. Das
Tochterunternehmen der Bayernwerk AG verwertet den Klärschlamm
thermisch über Zementwerke, Kohlekraftwerke und
Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen. Konkret hat die solare
Trocknungsanlage eine Größe von 120 mal 60 Metern, sie ist damit so
groß wie ein Fußballfeld. Sie sieht aus, wie ein herkömmliches
Gewächshaus, in dem sich der Schlamm zur Trocknung auf fünf Straßen
verteilt. Die Wärme kommt von der Sonne und von der benachbarten
Biogasanlage. Wie beim einem Heuwender wird der trockene Schlamm
ständig nach unten und der feuchte nach oben transportiert. Die
feuchte Luft wird über Abluftwäscher nach außen transportiert. Nach
einem Monat bleiben 90 Prozent Trockenmasse und zehn Prozent Wasser
übrig. Die Trockenmasse wird wöchentlich von drei Lkw abgeholt..jpg) Nachdem
die Ausbringung von Klärschlamm in der Landwirtschaft kritisch
geworden ist, seien innovative Lösungen wie in Bayreuth von großer
Bedeutung, sagte die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer. Der
stellvertretende Landrat Klaus Bauer bezeichnete die Abwärmenutzung
durch die benachbarte Biogasanlage als echten Glücksfall für beide
Partner. Die Reduzierung von Klärschlamm sei genauso wie beim Müll
extrem wichtig geworden, so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger.
Die Müllverbrennungsanlage Schwandorf habe keinerlei
Erweiterungskapazitäten mehr und nehme spätestens in zwei Jahren
keinen Gewerbemüll mehr an.
Nachdem
die Ausbringung von Klärschlamm in der Landwirtschaft kritisch
geworden ist, seien innovative Lösungen wie in Bayreuth von großer
Bedeutung, sagte die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer. Der
stellvertretende Landrat Klaus Bauer bezeichnete die Abwärmenutzung
durch die benachbarte Biogasanlage als echten Glücksfall für beide
Partner. Die Reduzierung von Klärschlamm sei genauso wie beim Müll
extrem wichtig geworden, so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger.
Die Müllverbrennungsanlage Schwandorf habe keinerlei
Erweiterungskapazitäten mehr und nehme spätestens in zwei Jahren
keinen Gewerbemüll mehr an. Himmekron,
Lks. Kulmbach. Die oberfränkische Europa-Abgeordnete Monika
Hohlmeier (CSU) will sich für eine gerechtere Verteilung von
Flächenprämien stark machen. „Die EU-Zahlungen an Landwirte sollen
ein Einkommensausgleich sein und kein attraktives Investment“, sagte
sie bei der BBV-Bezirksversammlung vor den oberfränkischen
Kreisbäuerinnen und Kreisobmännern in Himmelkron.
Himmekron,
Lks. Kulmbach. Die oberfränkische Europa-Abgeordnete Monika
Hohlmeier (CSU) will sich für eine gerechtere Verteilung von
Flächenprämien stark machen. „Die EU-Zahlungen an Landwirte sollen
ein Einkommensausgleich sein und kein attraktives Investment“, sagte
sie bei der BBV-Bezirksversammlung vor den oberfränkischen
Kreisbäuerinnen und Kreisobmännern in Himmelkron. .jpg) Lahm.
Aus Solidarität mit den Berufskollegen bei der
EU-Agrarministerkonferenz in Koblenz hat der Zusammenschluss „Land
schafft Verbindung - Landwirtschaft verbindet Bayern“ eine
Sternrundfahrt über Lichtenfels, Bad Staffelstein und Ebensfeld nach
Lahm im Itzgrund veranstaltet. Dort tauschten sich die Aktivisten am
Abend bei einem Mahnfeuer unter dem Motto „Wegen uns muss der
Regenwald nicht brennen“ aus, nachdem Lothar Teuchgräber,
stellvertretender Lichtenfelser BBV-Kreisobmann aus Bad
Staffelstein, noch einmal die wichtigsten Forderungen des
Bauernprotestes verkündet hatte. Eine Änderung der Umwelt- und
Tierwohlstandards dürfe nicht zu Lasten der Sozialstandards und der
Einkommen der Bauern gehen, lautete eine der zentralen Botschaften.
Eine Verlagerung der Produktion ins Ausland verlagere die Probleme
nur. Je mehr Agrarprodukte importiert werden, desto mehr Regenwald
wird gerodet“, so Teuchgräber. An der Sternfahrt hatten sich an die
50 Schlepper, teilweise mit Transparenten, beteiligt.
Lahm.
Aus Solidarität mit den Berufskollegen bei der
EU-Agrarministerkonferenz in Koblenz hat der Zusammenschluss „Land
schafft Verbindung - Landwirtschaft verbindet Bayern“ eine
Sternrundfahrt über Lichtenfels, Bad Staffelstein und Ebensfeld nach
Lahm im Itzgrund veranstaltet. Dort tauschten sich die Aktivisten am
Abend bei einem Mahnfeuer unter dem Motto „Wegen uns muss der
Regenwald nicht brennen“ aus, nachdem Lothar Teuchgräber,
stellvertretender Lichtenfelser BBV-Kreisobmann aus Bad
Staffelstein, noch einmal die wichtigsten Forderungen des
Bauernprotestes verkündet hatte. Eine Änderung der Umwelt- und
Tierwohlstandards dürfe nicht zu Lasten der Sozialstandards und der
Einkommen der Bauern gehen, lautete eine der zentralen Botschaften.
Eine Verlagerung der Produktion ins Ausland verlagere die Probleme
nur. Je mehr Agrarprodukte importiert werden, desto mehr Regenwald
wird gerodet“, so Teuchgräber. An der Sternfahrt hatten sich an die
50 Schlepper, teilweise mit Transparenten, beteiligt..jpg)
.jpg)
 Watzendorf.
Soll man die Fichte aufgeben oder nicht, darüber streiten sich
selbst Fachleute. Ralf Keller, stellvertretender Geschäftsführer der
Waldbauernvereinigung Coburger Land, meint, man sollte die
restlichen Fichten, die es noch gibt, schützen. Etwa durch
Waldhygiene. Dort, wo die Fichte noch steht, müsse man den Wald vom
Borkenkäfer frei räumen. Andernfalls würde das benötigte Fichtenholz
aus dem Ausland, etwa aus Sibirien, importiert.
Watzendorf.
Soll man die Fichte aufgeben oder nicht, darüber streiten sich
selbst Fachleute. Ralf Keller, stellvertretender Geschäftsführer der
Waldbauernvereinigung Coburger Land, meint, man sollte die
restlichen Fichten, die es noch gibt, schützen. Etwa durch
Waldhygiene. Dort, wo die Fichte noch steht, müsse man den Wald vom
Borkenkäfer frei räumen. Andernfalls würde das benötigte Fichtenholz
aus dem Ausland, etwa aus Sibirien, importiert. .jpg) Kulmbach.
Die Region Kulmbach steht für Ernährung, für gute fachliche Praxis
sowie für Einklang von Natur und Produktion. Dieses Fazit zog
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bei ihrem Besuch in
der Region. Klöckner besichtigte unter anderem das Unternehmen Raps
und das Max-Rubner-Institut und sprach mit Vertretern des Uni Campus
Kulmbach. Während der Unternehmensbesuch und die Stippvisite im
Max-Rubner-Institut weitgehend nichtöffentlich stattfanden, gab es
zuvor eine Diskussion mit Junglandwirten auf einem Feld zwischen
Appenberg und Gundersreuth bei Mainleus. Gleich zu Beginn ihres
Besuches hatte sie die Aufgabe, die Bauern mit einer negativen
Meldung zu konfrontieren: Die für Januar 2021 geplante weltweite
Leitmesse der Agrarbranche, die Grüne Woche in Berlin, werde
Corona-bedingt ausfallen.
Kulmbach.
Die Region Kulmbach steht für Ernährung, für gute fachliche Praxis
sowie für Einklang von Natur und Produktion. Dieses Fazit zog
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bei ihrem Besuch in
der Region. Klöckner besichtigte unter anderem das Unternehmen Raps
und das Max-Rubner-Institut und sprach mit Vertretern des Uni Campus
Kulmbach. Während der Unternehmensbesuch und die Stippvisite im
Max-Rubner-Institut weitgehend nichtöffentlich stattfanden, gab es
zuvor eine Diskussion mit Junglandwirten auf einem Feld zwischen
Appenberg und Gundersreuth bei Mainleus. Gleich zu Beginn ihres
Besuches hatte sie die Aufgabe, die Bauern mit einer negativen
Meldung zu konfrontieren: Die für Januar 2021 geplante weltweite
Leitmesse der Agrarbranche, die Grüne Woche in Berlin, werde
Corona-bedingt ausfallen..jpg) Es
gehe ihr bei dem Besuch in Kulmbach darum, zu erfahren, was junge
Landwirte an Hilfestellungen brauchen, um das leisten zu können, was
die Gesellschaft von ihnen verlange, sagte Klöckner. Da gehe es um
mehr Umweltschutz und um mehr Klimaschutz, aber auch um die
Sicherung unserer Ernährung. Landwirtschaft sei schon immer dem
Wandel unterworfen gewesen. Genauso habe die Gesellschaft auch schon
immer wechselnde Anforderungen an die Nahrungsmittelproduktion.
Während es vor 40, 50 Jahren darum gegangen sei, Ernten zu sichern,
stünden heute die Produktionsbedingungen im Vordergrund, so die
Ministerin.
Es
gehe ihr bei dem Besuch in Kulmbach darum, zu erfahren, was junge
Landwirte an Hilfestellungen brauchen, um das leisten zu können, was
die Gesellschaft von ihnen verlange, sagte Klöckner. Da gehe es um
mehr Umweltschutz und um mehr Klimaschutz, aber auch um die
Sicherung unserer Ernährung. Landwirtschaft sei schon immer dem
Wandel unterworfen gewesen. Genauso habe die Gesellschaft auch schon
immer wechselnde Anforderungen an die Nahrungsmittelproduktion.
Während es vor 40, 50 Jahren darum gegangen sei, Ernten zu sichern,
stünden heute die Produktionsbedingungen im Vordergrund, so die
Ministerin. .jpg) Großes
Lob zollte die Ministerin der jungen Generation an Landwirten. Die
jungen Leute würden sich nicht beklagen, sondern wollen
Landwirtschaft betreiben, seien offen für neue Züchtungen und für
die Digitalisierung. Dafür fordere sie völlig zurecht auch
Planungssicherheit ein. Das soll jetzt auch bei der nächsten
EU-Agrarministerkonferenz, die in Deutschland stattfindet,
eingebracht werden. Dabei machte die Ministerin aber auch keinen
Hehl daraus, dass die künftige gemeinsame europäische Agrarpolitik
„grüner und nachhaltiger“ werde und dass es in Sachen Tierwohl kein
Zurück mehr geben werde. Eine betäubungslose Ferkelkastration werde
es beispielsweise nicht mehr geben. „Tierwohl geht vor, wenn sie von
der Gesellschaft akzeptiert sein wollen.“
Großes
Lob zollte die Ministerin der jungen Generation an Landwirten. Die
jungen Leute würden sich nicht beklagen, sondern wollen
Landwirtschaft betreiben, seien offen für neue Züchtungen und für
die Digitalisierung. Dafür fordere sie völlig zurecht auch
Planungssicherheit ein. Das soll jetzt auch bei der nächsten
EU-Agrarministerkonferenz, die in Deutschland stattfindet,
eingebracht werden. Dabei machte die Ministerin aber auch keinen
Hehl daraus, dass die künftige gemeinsame europäische Agrarpolitik
„grüner und nachhaltiger“ werde und dass es in Sachen Tierwohl kein
Zurück mehr geben werde. Eine betäubungslose Ferkelkastration werde
es beispielsweise nicht mehr geben. „Tierwohl geht vor, wenn sie von
der Gesellschaft akzeptiert sein wollen.“.jpg) Die
jungen Landwirte gaben der Ministerin allerdings auch zahlreiche
Forderungen mit auf den Weg. Der Anbau von Zwischenfrüchten zur
Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit müssten halt auch honoriert werden,
sagte Tobias Weggel. Bestandsschutz für Ferkelerzeuger forderte
Heiko Kaiser. Wenn aufgrund der Tierwohldiskussionen Ausbauten in
den Ställen notwendig werden, bedeute das für viele Landwirte, dass
sie die erforderlichen Investitionen nicht mehr stemmen können und
stattdessen aufgeben. Zu viel Bürokratie beim Bau von Güllegruben
kritisierte Milchviehhalter Manuel Faßold aus dem Landkreis
Lichtenfels. Aufgrund der vielen Sonderauflagen für jedes einzelne
Bauteil habe niemand mehr Lust, eine Güllegrube zu bauen. Dabei
seien sie so dringend notwendig, sagte Berufskollege Andreas Popp.
Auf der einen Seite soll im Herbst keine Gülle mehr ausgebracht
werden, auf der anderen Seite werde der Bau von Güllegruben
erschwert.
Die
jungen Landwirte gaben der Ministerin allerdings auch zahlreiche
Forderungen mit auf den Weg. Der Anbau von Zwischenfrüchten zur
Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit müssten halt auch honoriert werden,
sagte Tobias Weggel. Bestandsschutz für Ferkelerzeuger forderte
Heiko Kaiser. Wenn aufgrund der Tierwohldiskussionen Ausbauten in
den Ställen notwendig werden, bedeute das für viele Landwirte, dass
sie die erforderlichen Investitionen nicht mehr stemmen können und
stattdessen aufgeben. Zu viel Bürokratie beim Bau von Güllegruben
kritisierte Milchviehhalter Manuel Faßold aus dem Landkreis
Lichtenfels. Aufgrund der vielen Sonderauflagen für jedes einzelne
Bauteil habe niemand mehr Lust, eine Güllegrube zu bauen. Dabei
seien sie so dringend notwendig, sagte Berufskollege Andreas Popp.
Auf der einen Seite soll im Herbst keine Gülle mehr ausgebracht
werden, auf der anderen Seite werde der Bau von Güllegruben
erschwert. .jpg) Ein
weiteres Thema war auch der katastrophale Zustand des Waldes
aufgrund der Trockenheit. „Wir müssen hektarweise Wald wegschlagen“,
so Johannes Hick aus Königsfeld. Mittlerweile sei bereits die dritte
Borkenkäfergeneration dieses Jahres zugange. Die Waldbesitzer seien
ganz einfach überfordert, sagte Susanne Löblein, ebenfalls aus dem
Landkreis Bamberg. Bei der Holzvermarktung lege man im Moment drauf.
Den „extremen Druck“ seitens des Lebensmitteleinzelhandels prangerte
schließlich Stefan Scherzer vom gleichnamigen Gemüsebaubetrieb an.
Während sein Betrieb mit hohen Investitionen aufgrund immer weiter
steigender Anforderung zurechtkommen müsse, zähle für den
Lebensmitteleinzelhandel am Ende jeder Cent, alles andere, auch die
regionale Erzeugung sei nachrangig.
Ein
weiteres Thema war auch der katastrophale Zustand des Waldes
aufgrund der Trockenheit. „Wir müssen hektarweise Wald wegschlagen“,
so Johannes Hick aus Königsfeld. Mittlerweile sei bereits die dritte
Borkenkäfergeneration dieses Jahres zugange. Die Waldbesitzer seien
ganz einfach überfordert, sagte Susanne Löblein, ebenfalls aus dem
Landkreis Bamberg. Bei der Holzvermarktung lege man im Moment drauf.
Den „extremen Druck“ seitens des Lebensmitteleinzelhandels prangerte
schließlich Stefan Scherzer vom gleichnamigen Gemüsebaubetrieb an.
Während sein Betrieb mit hohen Investitionen aufgrund immer weiter
steigender Anforderung zurechtkommen müsse, zähle für den
Lebensmitteleinzelhandel am Ende jeder Cent, alles andere, auch die
regionale Erzeugung sei nachrangig. Aufseß.
Mit der Enthüllung einer Karpfenskulptur hat der Bezirk Oberfranken
das 40-jährige Bestehen der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß
gefeiert. Der „Phantastische Karpfen“, der künftig vor dem
Verwaltungsgebäude alle Besucher begrüßen wird, wurde von der
Künstlergruppe des Vereins „Rote Katze“ aus Bayreuth gestaltet. Der
Verein unterstützt Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bei
der Entdeckung und Entwicklung ihrer kreativen Begabungen.
Aufseß.
Mit der Enthüllung einer Karpfenskulptur hat der Bezirk Oberfranken
das 40-jährige Bestehen der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß
gefeiert. Der „Phantastische Karpfen“, der künftig vor dem
Verwaltungsgebäude alle Besucher begrüßen wird, wurde von der
Künstlergruppe des Vereins „Rote Katze“ aus Bayreuth gestaltet. Der
Verein unterstützt Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bei
der Entdeckung und Entwicklung ihrer kreativen Begabungen..jpg) Hirschaid.
Die Durchwachsene Silphie („silphium perfoliatum“) kennt man als
Energiepflanze zur Verarbeitung in der Biogasanlage. Doch was ist,
wenn das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausläuft? Auf seiner Tour
durch ganz Deutschland stellte das Saatgutunternehmen Metzler &
Brodmann Saaten, das vom „Hahnennest“ im baden-württembergischen
Ostrach aus die „Donau-Silphie“ vertreibt eine neue Form der
Verwertung vor. „Wir möchten die Fasern der Silphie zur
Papierherstellung, vornehmlich zur Herstellung von
Verpackungsmaterial nutzen“, sagte Produktmanagerin Alexandra Kipp
bei der 13. von 20 Stationen im oberfränkischen Hirschaid bei
Bamberg.
Hirschaid.
Die Durchwachsene Silphie („silphium perfoliatum“) kennt man als
Energiepflanze zur Verarbeitung in der Biogasanlage. Doch was ist,
wenn das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausläuft? Auf seiner Tour
durch ganz Deutschland stellte das Saatgutunternehmen Metzler &
Brodmann Saaten, das vom „Hahnennest“ im baden-württembergischen
Ostrach aus die „Donau-Silphie“ vertreibt eine neue Form der
Verwertung vor. „Wir möchten die Fasern der Silphie zur
Papierherstellung, vornehmlich zur Herstellung von
Verpackungsmaterial nutzen“, sagte Produktmanagerin Alexandra Kipp
bei der 13. von 20 Stationen im oberfränkischen Hirschaid bei
Bamberg..jpg) Alexandra
Kipp schwärmt von der Silphie als die ideale „Botschafterin für die
Landwirtschaft“. Die Pflanze habe viele Vorteile, sie bringe
Insektenschutz, Klimaschutz und Wasserschutz unter einem Hut. Ihr
Unternehmen arbeite derzeit intensiv an zukunftsfähigen Lösungen für
die Zeit nach dem EEG und habe vor wenigen Monaten eine neu gebaute
Fasergewinnungsanlage in Betrieb nehmen können. „Wir wollen
Silphienfasern für die Papierherstellung gewinnen und soweit
aufbereiten, dass sie in einer Papierfabrik direkt weiterverarbeitet
werden können“, so die Produktmanagerin. Die Testphase laufe bereits
auf Hochtouren, erste Ergebnisse konnte sie bei dem Feldtermin in
Hirschaid bereits den Landwirten vorstellen. Rund 100 Bauern aus
allen Teilen Oberfrankens waren gekommen, was zeigt, dass das
Interesse groß ist. Die Energiepflanze könnte damit auch für
diejenigen Landwirte interessant sind, die keine Biogasablage
betreiben.
Alexandra
Kipp schwärmt von der Silphie als die ideale „Botschafterin für die
Landwirtschaft“. Die Pflanze habe viele Vorteile, sie bringe
Insektenschutz, Klimaschutz und Wasserschutz unter einem Hut. Ihr
Unternehmen arbeite derzeit intensiv an zukunftsfähigen Lösungen für
die Zeit nach dem EEG und habe vor wenigen Monaten eine neu gebaute
Fasergewinnungsanlage in Betrieb nehmen können. „Wir wollen
Silphienfasern für die Papierherstellung gewinnen und soweit
aufbereiten, dass sie in einer Papierfabrik direkt weiterverarbeitet
werden können“, so die Produktmanagerin. Die Testphase laufe bereits
auf Hochtouren, erste Ergebnisse konnte sie bei dem Feldtermin in
Hirschaid bereits den Landwirten vorstellen. Rund 100 Bauern aus
allen Teilen Oberfrankens waren gekommen, was zeigt, dass das
Interesse groß ist. Die Energiepflanze könnte damit auch für
diejenigen Landwirte interessant sind, die keine Biogasablage
betreiben..jpg) Während
die Energiepflanze bislang auf Flächen angebaut worden sei, die
nicht so hundertprozentig in die landwirtschaftliche Produktion
gepasst haben, sei dann auch der Anbau der Silphie auf besseren
Flächen denkbar. Geerntet werden könne ganz normal mit dem
Maishäcksler. Produktmanagerin Alexandra Wild verriet am Rande der
Veranstaltung auch den Saatgutpreis fü die „Donau-Silphie“. Er liegt
bei 1950 Euro pro Hektar.
Während
die Energiepflanze bislang auf Flächen angebaut worden sei, die
nicht so hundertprozentig in die landwirtschaftliche Produktion
gepasst haben, sei dann auch der Anbau der Silphie auf besseren
Flächen denkbar. Geerntet werden könne ganz normal mit dem
Maishäcksler. Produktmanagerin Alexandra Wild verriet am Rande der
Veranstaltung auch den Saatgutpreis fü die „Donau-Silphie“. Er liegt
bei 1950 Euro pro Hektar. Isaar.
Von einer leicht unterdurchschnittlichen Ernte geht der
Bauernverband für Oberfranken aus. Die Landwirte im Regierungsbezirk
sind aber trotz aller regionalen Unterschiede guter Dinge: „Noch so
ein Trockenjahr wie 2018 und 2019 hätte das endgültige Aus für viele
Betriebe bedeutet“, so BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif bei der
oberfränkischen Erntepressekonferenz auf dem Hof von Kreisobmann
Hermann Klug in Isaar bei Töpen.
Isaar.
Von einer leicht unterdurchschnittlichen Ernte geht der
Bauernverband für Oberfranken aus. Die Landwirte im Regierungsbezirk
sind aber trotz aller regionalen Unterschiede guter Dinge: „Noch so
ein Trockenjahr wie 2018 und 2019 hätte das endgültige Aus für viele
Betriebe bedeutet“, so BBV-Bezirkspräsident Hermann Greif bei der
oberfränkischen Erntepressekonferenz auf dem Hof von Kreisobmann
Hermann Klug in Isaar bei Töpen. Windischletten.
Mit einem dramatischen Appell wenden sich die Verantwortlichen der
Waldbesitzervereinigung Bamberg derzeit an Politik und
Öffentlichkeit. Ohne finanzielle und ideelle Unterstützung werde der
Wald in Oberfranken großflächig absterben, so befürchten es die
Fachleute. Erste Anzeichen dafür seien bereits nicht mehr zu
übersehen.
Windischletten.
Mit einem dramatischen Appell wenden sich die Verantwortlichen der
Waldbesitzervereinigung Bamberg derzeit an Politik und
Öffentlichkeit. Ohne finanzielle und ideelle Unterstützung werde der
Wald in Oberfranken großflächig absterben, so befürchten es die
Fachleute. Erste Anzeichen dafür seien bereits nicht mehr zu
übersehen. .jpg) Münchberg.
Mit einem Kostenvolumen von rund elf Millionen Euro entsteht derzeit
in Münchberg ein Grünes Zentrum. Der stattliche Neubau nahe der
Autobahnanschlussstelle Münchberg-Nord soll ab Ende des Jahres
gleich mehrere landwirtschaftliche Institutionen unter einem Dach
vereinen: das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, den
Bauernverband, den Maschinenring, die Landwirtschaftsschule und die
zentrale Vergabestelle der staatlichen landwirtschaftlichen
Führungsakademie.
Münchberg.
Mit einem Kostenvolumen von rund elf Millionen Euro entsteht derzeit
in Münchberg ein Grünes Zentrum. Der stattliche Neubau nahe der
Autobahnanschlussstelle Münchberg-Nord soll ab Ende des Jahres
gleich mehrere landwirtschaftliche Institutionen unter einem Dach
vereinen: das Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten, den
Bauernverband, den Maschinenring, die Landwirtschaftsschule und die
zentrale Vergabestelle der staatlichen landwirtschaftlichen
Führungsakademie. .jpg) Eine
Besonderheit des Baus ist nach den Worten von Karsten Hilbert und
Ulrich Wendland vom Architekturbüro ghsw-Architekten in Hof die
Verwendung von Holz von der Fassade bis zu den Echtholztüren im
Innern. „Hier wird ausschließlich mit hochwertigen, naturnahem
Materialien gearbeitet“, so die Architekten. Für die Wärme soll eine
Pellets-Heizung, für die Kälte ein Geothermie-System sorgen.
Außerdem werde auf den Dächern eine Photovoltaikanlage installiert.
Eine
Besonderheit des Baus ist nach den Worten von Karsten Hilbert und
Ulrich Wendland vom Architekturbüro ghsw-Architekten in Hof die
Verwendung von Holz von der Fassade bis zu den Echtholztüren im
Innern. „Hier wird ausschließlich mit hochwertigen, naturnahem
Materialien gearbeitet“, so die Architekten. Für die Wärme soll eine
Pellets-Heizung, für die Kälte ein Geothermie-System sorgen.
Außerdem werde auf den Dächern eine Photovoltaikanlage installiert..jpg) Neuenmarkt/Himmelkron.
Hundert Prozent Wasser, null Prozent Chemie: das ist die
Erfolgsformel gegen Unkraut und Schädlinge. Im Kulmbacher Land ist
der Maschinenring in diesen Tagen wieder unterwegs, um die Wege des
Friedhofs in Neuenmarkt von Unkraut und die Eichen entlang der
Bundesstraße B303 bei Himmelkron vom Eichenprozessionsspinner zu
befreien.
Neuenmarkt/Himmelkron.
Hundert Prozent Wasser, null Prozent Chemie: das ist die
Erfolgsformel gegen Unkraut und Schädlinge. Im Kulmbacher Land ist
der Maschinenring in diesen Tagen wieder unterwegs, um die Wege des
Friedhofs in Neuenmarkt von Unkraut und die Eichen entlang der
Bundesstraße B303 bei Himmelkron vom Eichenprozessionsspinner zu
befreien. .jpg) An
manchen der über 30 befallenen Eichen seien die Auswirkungen des
Schädlings schon deutlich zu sehen, so Harald Huber vom
Maschinenring. Er spricht von rund 40 Nestern an manchen Bäumen, an
besonders stark befallene Bäume habe er auch schon 80 Nester
gezählt. Das gefährliche an dem Schädling, der bei weitem nicht nur
Eichen befällt, sind die Brennhaare, die im Extremfall
lebensbedrohliche allergische Reaktionen bei manchen Menschen
auslösen können. „Die Haare der Raupen führen zu Allergien, Asthma
und mitunter zu einem allergischen Schock“, so Müller. Zu den
häufigsten Symptomen gehörten lokale Hautausschläge, begleitend dazu
könnten Allgemeinsymptome wie Schwindel, Fieber, Müdigkeit und
Bindehautentzündungen auftreten.
An
manchen der über 30 befallenen Eichen seien die Auswirkungen des
Schädlings schon deutlich zu sehen, so Harald Huber vom
Maschinenring. Er spricht von rund 40 Nestern an manchen Bäumen, an
besonders stark befallene Bäume habe er auch schon 80 Nester
gezählt. Das gefährliche an dem Schädling, der bei weitem nicht nur
Eichen befällt, sind die Brennhaare, die im Extremfall
lebensbedrohliche allergische Reaktionen bei manchen Menschen
auslösen können. „Die Haare der Raupen führen zu Allergien, Asthma
und mitunter zu einem allergischen Schock“, so Müller. Zu den
häufigsten Symptomen gehörten lokale Hautausschläge, begleitend dazu
könnten Allgemeinsymptome wie Schwindel, Fieber, Müdigkeit und
Bindehautentzündungen auftreten..jpg) Neusath-Perschen.
Früher müssen die Menschen alle kleiner gewesen sein. In sämtlichen
Räumen sind die Zimmerdecken bedrohlich nah. Unbeschadet hinein
kommt man meist nur dann, wenn man im Türstock den Kopf einzieht.
Das ist nicht die einige Überraschung in den rund 50 historischen
Gebäuden aus den zurückliegenden 300 Jahren, die im Oberpfälzischen
Freilandmuseum in Neusath-Perschen, einem Ortsteil von Nabburg im
Landkreis Schwandorf, wiederaufgebaut wurden.
Neusath-Perschen.
Früher müssen die Menschen alle kleiner gewesen sein. In sämtlichen
Räumen sind die Zimmerdecken bedrohlich nah. Unbeschadet hinein
kommt man meist nur dann, wenn man im Türstock den Kopf einzieht.
Das ist nicht die einige Überraschung in den rund 50 historischen
Gebäuden aus den zurückliegenden 300 Jahren, die im Oberpfälzischen
Freilandmuseum in Neusath-Perschen, einem Ortsteil von Nabburg im
Landkreis Schwandorf, wiederaufgebaut wurden..jpg) Dazu
verbindet der Rundweg gleich fünf kleine „Dörfer“, besser Weiler,
die den historischen Regionen der Oberpfalz entsprechen sollen: da
gibt es ein Stiftlanddorf, weiter geht es ins Waldlerdorf, ins
Naabtaldorf und in das Juradorf, sowie in das Mühlental. Die breiten
sonnigen Spazierwege sind den alten Landstraßen aus dem 19.
Jahrhundert nachempfunden, sie wechseln sich ab mit schmalen,
schattigen Waldpfaden. Sogar eine schmucke Kapelle aus dem Jahr 1870
gibt es. Sie stand einst bei Hirschau und wurde hier im
Originalzustand mit der kompletten Inneneinrichtung wiederaufgebaut.
Dazu
verbindet der Rundweg gleich fünf kleine „Dörfer“, besser Weiler,
die den historischen Regionen der Oberpfalz entsprechen sollen: da
gibt es ein Stiftlanddorf, weiter geht es ins Waldlerdorf, ins
Naabtaldorf und in das Juradorf, sowie in das Mühlental. Die breiten
sonnigen Spazierwege sind den alten Landstraßen aus dem 19.
Jahrhundert nachempfunden, sie wechseln sich ab mit schmalen,
schattigen Waldpfaden. Sogar eine schmucke Kapelle aus dem Jahr 1870
gibt es. Sie stand einst bei Hirschau und wurde hier im
Originalzustand mit der kompletten Inneneinrichtung wiederaufgebaut..jpg) Auf
dem gesamten Gelände werden auch traditionelle Pflanzen- und
Getreidesorten angebaut. Nicht nur Sommer- oder Winterweizen ist
hier zu sehen, sondern auch seltenere Saaten wie zum Beispiel Öllein,
Schwarzhafer oder Emmer. Im Hopfengarten wird die Sorte „Hersbrucker
Spät“ angebaut. Bewirtschaftet werden die Flächen von Landwirten,
die das Museum beauftragt hat. Dazu gehört auch die große
Streuobstwiese, die der örtliche Kreisverband für Gartenbau und
Landespflege zusammen mit den Oberpfälzer Kreisfachberatern angelegt
hatte. Hier ist es das erklärte Ziel, alte heimische Obstsorten zu
pflegen und zu erhalten.
Auf
dem gesamten Gelände werden auch traditionelle Pflanzen- und
Getreidesorten angebaut. Nicht nur Sommer- oder Winterweizen ist
hier zu sehen, sondern auch seltenere Saaten wie zum Beispiel Öllein,
Schwarzhafer oder Emmer. Im Hopfengarten wird die Sorte „Hersbrucker
Spät“ angebaut. Bewirtschaftet werden die Flächen von Landwirten,
die das Museum beauftragt hat. Dazu gehört auch die große
Streuobstwiese, die der örtliche Kreisverband für Gartenbau und
Landespflege zusammen mit den Oberpfälzer Kreisfachberatern angelegt
hatte. Hier ist es das erklärte Ziel, alte heimische Obstsorten zu
pflegen und zu erhalten..jpg) In
einem der ältesten Museen dieser Art in Bayern hat aber auch die
Neuzeit Einzug gehalten: Auf einem großen Holzschuppen wurde ein
Solardach installiert. Die Anlage aus dem Jahr 2002 liefert ein
Drittel der Energie für die Temperierung der benachbarten
Rauberweihermühle.
In
einem der ältesten Museen dieser Art in Bayern hat aber auch die
Neuzeit Einzug gehalten: Auf einem großen Holzschuppen wurde ein
Solardach installiert. Die Anlage aus dem Jahr 2002 liefert ein
Drittel der Energie für die Temperierung der benachbarten
Rauberweihermühle..jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 Bayreuth.
Allein schon das Wort klingt wie eine Bedrohung: Drohne. Doch diese
für viele unheimlichen Flugobjekte müssen nicht automatisch
Misstrauen wecken. Ganz im Gegenteil: in der Landwirtschaft können
sie auch ein Segen sein. Geschäftsführer Johannes Scherm,
Vorsitzender Reinhard Sendelbeck und sein Stellvertreter Matthias
Roder vom Maschinenring Bayreuth-Pegnitz zeigen auf, wofür Drohnen
alles gut sein können, und warum sie in der Landwirtschaft eine
echte Bereicherung darstellen, egal ob zur biologischen
Schädlingsbekämpfung, zur Rehkitzrettung oder zur Feststellung von
Borkenkäferbeständen. Der Maschinenring sei in der Lage, die
passenden Dienstleister für nahezu alle Einsatzmöglichkeiten von
Drohnen zu vermitteln, so Geschäftsführer Scherm.
Bayreuth.
Allein schon das Wort klingt wie eine Bedrohung: Drohne. Doch diese
für viele unheimlichen Flugobjekte müssen nicht automatisch
Misstrauen wecken. Ganz im Gegenteil: in der Landwirtschaft können
sie auch ein Segen sein. Geschäftsführer Johannes Scherm,
Vorsitzender Reinhard Sendelbeck und sein Stellvertreter Matthias
Roder vom Maschinenring Bayreuth-Pegnitz zeigen auf, wofür Drohnen
alles gut sein können, und warum sie in der Landwirtschaft eine
echte Bereicherung darstellen, egal ob zur biologischen
Schädlingsbekämpfung, zur Rehkitzrettung oder zur Feststellung von
Borkenkäferbeständen. Der Maschinenring sei in der Lage, die
passenden Dienstleister für nahezu alle Einsatzmöglichkeiten von
Drohnen zu vermitteln, so Geschäftsführer Scherm.

 Altenreuth.
Jetzt leuchten sie wieder, die gelben Felder landauf landab: Der
Raps steht in voller Blüte. Doch der Schein trügt. Die Anbaufläche
in Oberfranken ist während der zurückliegenden zehn Jahre um 50 bis
60 Prozent zurückgegangen. Allein von 2018 bis 2019 sank der
Rapsanbau im Regierungsbezirk von knapp 16300 Hektar auf unter 10000
Hektar. Um auf diesen dramatischen Rückgang aufmerksam zu machen,
hatten sich Vertreter der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps
Oberfranken auf einem Rapsfeld von Wilfried Löwinger in Altenreuth
bei Harsdorf im Landkreis Kulmbach getroffen. Löwinger ist nicht nur
BBV-Kreisobmann in Kulmbach, sondern auch stellvertretender
Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft.
Altenreuth.
Jetzt leuchten sie wieder, die gelben Felder landauf landab: Der
Raps steht in voller Blüte. Doch der Schein trügt. Die Anbaufläche
in Oberfranken ist während der zurückliegenden zehn Jahre um 50 bis
60 Prozent zurückgegangen. Allein von 2018 bis 2019 sank der
Rapsanbau im Regierungsbezirk von knapp 16300 Hektar auf unter 10000
Hektar. Um auf diesen dramatischen Rückgang aufmerksam zu machen,
hatten sich Vertreter der Erzeugergemeinschaft für Qualitätsraps
Oberfranken auf einem Rapsfeld von Wilfried Löwinger in Altenreuth
bei Harsdorf im Landkreis Kulmbach getroffen. Löwinger ist nicht nur
BBV-Kreisobmann in Kulmbach, sondern auch stellvertretender
Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft. Wattendorf.
Vier halbe Tage pro Woche verbringt Thomas Betz in seinem Büro im
Rathaus des Stadelhofener Ortsteils Steinfeld. Hier hat die
Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld, zu der seit der Gebietsreform
1978 die Gemeinden Königsfeld, Stadelhofen und Wattendorf gehören
ihren Sitz. Der 50-Jährige ist ehrenamtlicher Bürgermeister von
Wattendorf, die mit rund 650 Einwohnern kleinste Gemeinde im
Landkreis Bamberg und eine der kleinsten in ganz Oberfranken. In
seine zweiten Leben ist Thomas Betz Landwirt. Er bewirtschaftet rund
100 Hektar Ackerland.
Wattendorf.
Vier halbe Tage pro Woche verbringt Thomas Betz in seinem Büro im
Rathaus des Stadelhofener Ortsteils Steinfeld. Hier hat die
Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld, zu der seit der Gebietsreform
1978 die Gemeinden Königsfeld, Stadelhofen und Wattendorf gehören
ihren Sitz. Der 50-Jährige ist ehrenamtlicher Bürgermeister von
Wattendorf, die mit rund 650 Einwohnern kleinste Gemeinde im
Landkreis Bamberg und eine der kleinsten in ganz Oberfranken. In
seine zweiten Leben ist Thomas Betz Landwirt. Er bewirtschaftet rund
100 Hektar Ackerland. .jpg) Töpen.
Für eine „Tierwohl-Umlage“ hat sich Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner ausgesprochen. „Wir brauchen vier bis fünf Milliarden
Euro pro Jahr mehr, um die Erwartungen der Verbraucher umzusetzen“,
sagte Klöckner bei einem Gespräch mit Vertretern zahlreicher
landwirtschaftlicher Verbände in Töpen bei Hof. Die Umlage soll auf
Fleischprodukte erhoben werden und in einen Fonds fließen, aus dem
tierwohlbedingte Stallneu- und -umbauten gefördert werden. In Töpen,
am Sitz des Bio-Großhändlers Dennree, hatte die Ministerin zuvor ein
nichtöffentliches Gespräch mit der Unternehmensspitze geführt.
Töpen.
Für eine „Tierwohl-Umlage“ hat sich Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner ausgesprochen. „Wir brauchen vier bis fünf Milliarden
Euro pro Jahr mehr, um die Erwartungen der Verbraucher umzusetzen“,
sagte Klöckner bei einem Gespräch mit Vertretern zahlreicher
landwirtschaftlicher Verbände in Töpen bei Hof. Die Umlage soll auf
Fleischprodukte erhoben werden und in einen Fonds fließen, aus dem
tierwohlbedingte Stallneu- und -umbauten gefördert werden. In Töpen,
am Sitz des Bio-Großhändlers Dennree, hatte die Ministerin zuvor ein
nichtöffentliches Gespräch mit der Unternehmensspitze geführt..jpg) Im
Sitzungssaal des Rathauses sprach Julia Klöckner dagegen ausführlich
Klartext. Etwa wenn es darum ging, die sogenannte Bauernmilliarde zu
verteidigen. „Es ist nicht fair, zu sagen das brauchen wir nicht“,
so die Ministerin. Sie forderte von den Bauern offen Zustimmung
statt Ablehnung, schließlich habe sie, genauso wie der bayerische
Ministerpräsident Markus Söder, um das Geld gekämpft. „Da wären wir
doch bescheuert gewesen, das jetzt wieder abzulehnen“, sagte
Klöckner, die sich ausdrücklich gegen den Begriff der
Bauernmilliarde wehrte und stattdessen von einem
Investitionsprogramm für die Landwirtschaft sprach.
Im
Sitzungssaal des Rathauses sprach Julia Klöckner dagegen ausführlich
Klartext. Etwa wenn es darum ging, die sogenannte Bauernmilliarde zu
verteidigen. „Es ist nicht fair, zu sagen das brauchen wir nicht“,
so die Ministerin. Sie forderte von den Bauern offen Zustimmung
statt Ablehnung, schließlich habe sie, genauso wie der bayerische
Ministerpräsident Markus Söder, um das Geld gekämpft. „Da wären wir
doch bescheuert gewesen, das jetzt wieder abzulehnen“, sagte
Klöckner, die sich ausdrücklich gegen den Begriff der
Bauernmilliarde wehrte und stattdessen von einem
Investitionsprogramm für die Landwirtschaft sprach..jpg) Obwohl
die Bundesagrarministerin im Zeitdruck war, ließ sie zahlreiche
Beiträge von Vertretern der verschiedenen Organisationen zu. Die
Bauern im „Milchlandkreis Hof“, wo die Quote der
Haupterwerbsbetriebe noch bei über 50 Prozent liegt, stünden vor
riesigen Problemen, so Kreisbäuerin Karin Wolfrum. Kreisobmann
Hermann Klug machte seinem Unmut über die Düngeverordnung Luft. Die
Getreidebestände zeigten jetzt schon Nährstoffmangel, weil sie nicht
gedüngt werden. Hintergrund ist, dass es während des zurückliegenden
Winters selbst im Hofer Land keinen richtigen Frost gegeben hatte.
Obwohl
die Bundesagrarministerin im Zeitdruck war, ließ sie zahlreiche
Beiträge von Vertretern der verschiedenen Organisationen zu. Die
Bauern im „Milchlandkreis Hof“, wo die Quote der
Haupterwerbsbetriebe noch bei über 50 Prozent liegt, stünden vor
riesigen Problemen, so Kreisbäuerin Karin Wolfrum. Kreisobmann
Hermann Klug machte seinem Unmut über die Düngeverordnung Luft. Die
Getreidebestände zeigten jetzt schon Nährstoffmangel, weil sie nicht
gedüngt werden. Hintergrund ist, dass es während des zurückliegenden
Winters selbst im Hofer Land keinen richtigen Frost gegeben hatte..jpg) Zuvor
hatte Klöckner den Hauptsitz der Bio-Großhandelsunternehmensgruppe
Dennree besucht und mit der Geschäftsleitung hinter verschlossenen
Türen gesprochen. Lediglich beim Besuch einer der rieseigen Hallen
für Gemüse durften Pressevertreter dabei sein. Dennree beliefert mit
rund 5500 Mitarbeitern und einem Sortiment aus circa 13000 Artikeln
über 1400 Biomärkte und Bio-Supermärkte in Deutschland, Österreich,
Luxemburg und Südtirol/Italien. Dennree ist der umsatzstärkste
Fachgroßhändler für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik im
deutschsprachigen Raum.
Zuvor
hatte Klöckner den Hauptsitz der Bio-Großhandelsunternehmensgruppe
Dennree besucht und mit der Geschäftsleitung hinter verschlossenen
Türen gesprochen. Lediglich beim Besuch einer der rieseigen Hallen
für Gemüse durften Pressevertreter dabei sein. Dennree beliefert mit
rund 5500 Mitarbeitern und einem Sortiment aus circa 13000 Artikeln
über 1400 Biomärkte und Bio-Supermärkte in Deutschland, Österreich,
Luxemburg und Südtirol/Italien. Dennree ist der umsatzstärkste
Fachgroßhändler für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik im
deutschsprachigen Raum..jpg) Bayreuth.
Im zurückliegenden Zuchtjahr hat der Rinderzuchtverband Oberfranken
sein hohes Ergebnis aus dem Jahr zuvor nicht halten können. Laut
Jahresbericht, den der Vorsitzende Georg Hollfelder aus Litzendorf
im Landkreis Bamberg und Zuchtleiter Markus Schricker bei der
Jahresversammlung in der Tierzuchtklause in Bayreuth vorlegten,
waren es mit gut 32000 Tieren aller Kategorien über 400 weniger, der
Gesamtnettoumsatz habe sich um etwa zwei Million Euro auf rund 16
Millionen Euro verringert. „Der Rückgang ist das Ergebnis aus den
niedrigen Preisen, besonders bei Nutzkälbern“, sagte Zuchtleiter
Schricker.
Bayreuth.
Im zurückliegenden Zuchtjahr hat der Rinderzuchtverband Oberfranken
sein hohes Ergebnis aus dem Jahr zuvor nicht halten können. Laut
Jahresbericht, den der Vorsitzende Georg Hollfelder aus Litzendorf
im Landkreis Bamberg und Zuchtleiter Markus Schricker bei der
Jahresversammlung in der Tierzuchtklause in Bayreuth vorlegten,
waren es mit gut 32000 Tieren aller Kategorien über 400 weniger, der
Gesamtnettoumsatz habe sich um etwa zwei Million Euro auf rund 16
Millionen Euro verringert. „Der Rückgang ist das Ergebnis aus den
niedrigen Preisen, besonders bei Nutzkälbern“, sagte Zuchtleiter
Schricker..jpg) Von
großen Herausforderungen sprach der Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses Martin Schöffel. Was die
Bauern machen, sei von großer Sachkunde geprägt. Kritik übte
Schöffel deshalb nicht nur an großen Teilender Verbraucher und deren
Einstellung zur Nutztierhaltung, sondern auch an überzogenen
Kontrollen auf den Höfen und an Aussagen der Grünen, die nichts mit
der Realität zu tun hätten.
Von
großen Herausforderungen sprach der Landtagsabgeordnete und
Vorsitzende des Landwirtschaftsausschusses Martin Schöffel. Was die
Bauern machen, sei von großer Sachkunde geprägt. Kritik übte
Schöffel deshalb nicht nur an großen Teilender Verbraucher und deren
Einstellung zur Nutztierhaltung, sondern auch an überzogenen
Kontrollen auf den Höfen und an Aussagen der Grünen, die nichts mit
der Realität zu tun hätten. .jpg) Bayreuth.
Mit der Grundsteuerreform und ihre Auswirkungen auf die
Landwirtschaft stand beim Bayreuther Bauerntag diesmal ein
fachliches Thema im Vordergrund. Nachdem das
Bundesverfassungsgericht die aktuelle Situation im April 2018 als
verfassungswidrig erklärt hatte liegen mittlerweile ein neuer
Beschluss des Bundes und dank der Länderöffnungsklausel auch
Entwürfe der Neugestaltung für Bayern vor. „Das bayerische Modell
könnte weniger Bürokratie enthalten“, machte Martin Bauer den
Landwirten vor Ort Hoffnung. „Wir sind damit auf einem guten Weg“,
so der juristischer Referent beim BBV-Generalsekretariat in München.
Bayreuth.
Mit der Grundsteuerreform und ihre Auswirkungen auf die
Landwirtschaft stand beim Bayreuther Bauerntag diesmal ein
fachliches Thema im Vordergrund. Nachdem das
Bundesverfassungsgericht die aktuelle Situation im April 2018 als
verfassungswidrig erklärt hatte liegen mittlerweile ein neuer
Beschluss des Bundes und dank der Länderöffnungsklausel auch
Entwürfe der Neugestaltung für Bayern vor. „Das bayerische Modell
könnte weniger Bürokratie enthalten“, machte Martin Bauer den
Landwirten vor Ort Hoffnung. „Wir sind damit auf einem guten Weg“,
so der juristischer Referent beim BBV-Generalsekretariat in München..jpg) Eng
mit der Landwirtschaft verbunden sah Bayreuths 2. Bürgermeister
Thomas Ebersberger die Stadt Bayreuth. Deshalb habe sich die Stadt
auch an dem neuen Label „Bayreuther Land“ beteiligt. Oberstes Ziel
sei es dabei, den Absatz regionaler Lebensmittel zu stärken. Dies
sei auch notwendig, denn, so Ebersberger: „Die landwirtschaftlichen
Familienbetriebe sind das Herzstück und das Gesicht unseres
ländlichen Raumes, gerade in den Tourismusregionen Fränkische
Schweiz und Fichtelgebirge.“
Eng
mit der Landwirtschaft verbunden sah Bayreuths 2. Bürgermeister
Thomas Ebersberger die Stadt Bayreuth. Deshalb habe sich die Stadt
auch an dem neuen Label „Bayreuther Land“ beteiligt. Oberstes Ziel
sei es dabei, den Absatz regionaler Lebensmittel zu stärken. Dies
sei auch notwendig, denn, so Ebersberger: „Die landwirtschaftlichen
Familienbetriebe sind das Herzstück und das Gesicht unseres
ländlichen Raumes, gerade in den Tourismusregionen Fränkische
Schweiz und Fichtelgebirge.“ Bayreuth.
Über mangelnde Wertschätzung konnten sich die 19 frischgebackenen
Landwirtschaftsmeister aus Oberfranken nicht beklagen. Mit dem
Bamberger Erzbischof Ludwig Schick und der oberfränkischen
Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz waren zwei hochrangige
Vertreter aus dem Regierungsbezirk angetreten, um den Meistern, 18
junge Männer und eine Frau, zu gratulieren.
Bayreuth.
Über mangelnde Wertschätzung konnten sich die 19 frischgebackenen
Landwirtschaftsmeister aus Oberfranken nicht beklagen. Mit dem
Bamberger Erzbischof Ludwig Schick und der oberfränkischen
Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz waren zwei hochrangige
Vertreter aus dem Regierungsbezirk angetreten, um den Meistern, 18
junge Männer und eine Frau, zu gratulieren. Ebenfalls
nah an der Landwirtschaft dran ist Regierungspräsidentin Piwernetz.
So habe die Landwirtschaft seit 2018 wieder einen festen Anker an
den bayerischen Bezirksregierungen. Der wiedergeschaffene Bereich
IV. sei auch hervorragend gestartet. Seit August 2019 sind die
Bezirksregierungen auch die zuständige Stelle für die Ausbildung im
Bereich der Landwirtschaft und deshalb fand der Festakt zur
Meisterbriefübergabe nach Jahren erstmals wieder im schmucken
Landratssaal der Regierung von Oberfranken in Bayreuth statt.
Ebenfalls
nah an der Landwirtschaft dran ist Regierungspräsidentin Piwernetz.
So habe die Landwirtschaft seit 2018 wieder einen festen Anker an
den bayerischen Bezirksregierungen. Der wiedergeschaffene Bereich
IV. sei auch hervorragend gestartet. Seit August 2019 sind die
Bezirksregierungen auch die zuständige Stelle für die Ausbildung im
Bereich der Landwirtschaft und deshalb fand der Festakt zur
Meisterbriefübergabe nach Jahren erstmals wieder im schmucken
Landratssaal der Regierung von Oberfranken in Bayreuth statt..jpg) Scheßlitz,
Lks. Bamberg. Da kochten die Emotionen beim Scheßlitzer Bauerntag
diesmal richtig hoch. Nicht nur, dass „Land schafft Verbindung“ mit
über 30 Schleppern vor der TSV-Turnhalle vorgefahren war und der
Saal so voll war, dass viele Besucher sogar mit einem Stehplatz
vorlieb nehmen mussten. LSV-Sprecher Dieter Laub kritisierte mit
scharfen Worten sowohl den Bauernverband als auch die CSU.
Scheßlitz,
Lks. Bamberg. Da kochten die Emotionen beim Scheßlitzer Bauerntag
diesmal richtig hoch. Nicht nur, dass „Land schafft Verbindung“ mit
über 30 Schleppern vor der TSV-Turnhalle vorgefahren war und der
Saal so voll war, dass viele Besucher sogar mit einem Stehplatz
vorlieb nehmen mussten. LSV-Sprecher Dieter Laub kritisierte mit
scharfen Worten sowohl den Bauernverband als auch die CSU.
.jpg) Dabei
hatte Mortler zuvor in ihrer Rede noch überaus lobende Worte für die
Bewegung „Land schafft Verbindung“ gefunden. Durch die LSV-Aktionen
hätten wirklich alle erkannt, dass es den Landwirten ernst ist.
Gerade die bestens ausgebildeten jungen Bauern, die jetzt in der
Verantwortung stehen, seien es gewesen, die mit spektakulären
Aktionen für Aufsehen gesorgt hätten. „Ihr habt es geschafft, dass
das Thema Landwirtschaft ganz oben ist“, so Mortler. Das Verständnis
in der Bevölkerung nehme wieder zu, die Mehrzahl der Menschen stehe
auf der Seite der Bauern.
Dabei
hatte Mortler zuvor in ihrer Rede noch überaus lobende Worte für die
Bewegung „Land schafft Verbindung“ gefunden. Durch die LSV-Aktionen
hätten wirklich alle erkannt, dass es den Landwirten ernst ist.
Gerade die bestens ausgebildeten jungen Bauern, die jetzt in der
Verantwortung stehen, seien es gewesen, die mit spektakulären
Aktionen für Aufsehen gesorgt hätten. „Ihr habt es geschafft, dass
das Thema Landwirtschaft ganz oben ist“, so Mortler. Das Verständnis
in der Bevölkerung nehme wieder zu, die Mehrzahl der Menschen stehe
auf der Seite der Bauern..jpg) Das
ließ auch Kreisobmann Edgar Böhmer so nicht auf sich sitzen. Auch er
sei nicht immer mit allem einverstanden, aber genau deshalb
engagiere er sich ja als Kreisobmann. Er rief alle Aktivisten auf,
sich ebenfalls einzubringen, beispielsweise in den Gemeinderäten
oder Kreistagen. Dort könne man wirklich etwas bewegen.
Das
ließ auch Kreisobmann Edgar Böhmer so nicht auf sich sitzen. Auch er
sei nicht immer mit allem einverstanden, aber genau deshalb
engagiere er sich ja als Kreisobmann. Er rief alle Aktivisten auf,
sich ebenfalls einzubringen, beispielsweise in den Gemeinderäten
oder Kreistagen. Dort könne man wirklich etwas bewegen. .jpg) Bayreuth.
Ähnlich wie den Landfrauen geht es dem gesamten Bauernstand. Die
Leistungen werden als selbstverständlich empfunden. Was bei den
Landfrauen für Haus und Hof gilt, ist bei der Landwirtschaft die
gesamte Gesellschaft. „Ohne unsere Bauernhöfe gäbe es kein Leben im
ländlichen Raum“, sagte der Wunsiedler Landtagsabgeordnete Martin
Schöffel beim Bayreuther Landfrauentag.
Bayreuth.
Ähnlich wie den Landfrauen geht es dem gesamten Bauernstand. Die
Leistungen werden als selbstverständlich empfunden. Was bei den
Landfrauen für Haus und Hof gilt, ist bei der Landwirtschaft die
gesamte Gesellschaft. „Ohne unsere Bauernhöfe gäbe es kein Leben im
ländlichen Raum“, sagte der Wunsiedler Landtagsabgeordnete Martin
Schöffel beim Bayreuther Landfrauentag..jpg) Ziel
müsse es in jedem Fall sein, die Lebensmittelproduktion auch künftig
im eigenen Land zu halten. Wenn die Dinge erst einmal aus dem
Ausland kommen, dann habe niemand mehr Einfluss auf die
Produktionsbedingungen. Deshalb sollte man mit allen Mitteln
verhindern, dass man sich hierzulande aus der Produktion
zurückzieht.
Ziel
müsse es in jedem Fall sein, die Lebensmittelproduktion auch künftig
im eigenen Land zu halten. Wenn die Dinge erst einmal aus dem
Ausland kommen, dann habe niemand mehr Einfluss auf die
Produktionsbedingungen. Deshalb sollte man mit allen Mitteln
verhindern, dass man sich hierzulande aus der Produktion
zurückzieht. Himmelkron.
Gerade in Zeiten des Klimawandels kann die heimische Teichwirtschaft
ganz massiv punkten. Das haben nahezu alle Redner bei der
Jahresversammlung der Teichgenossenschaft Oberfranken in Himmelkron
hervorgehoben. Doch leider fehlt den Teichwirten oft die
entsprechende Wertschätzung, auch das wurde bei der Zusammenkunft
deutlich.
Himmelkron.
Gerade in Zeiten des Klimawandels kann die heimische Teichwirtschaft
ganz massiv punkten. Das haben nahezu alle Redner bei der
Jahresversammlung der Teichgenossenschaft Oberfranken in Himmelkron
hervorgehoben. Doch leider fehlt den Teichwirten oft die
entsprechende Wertschätzung, auch das wurde bei der Zusammenkunft
deutlich. Betzenstein.
Der Wind bläst der Landwirtschaft immer stärker ins Gesicht. Diesmal
seien es aber nicht nur die rein wirtschaftlichen Ursachen, sondern
Bürokratie, Auflagen und Vorschriften, die sich in nie gekanntem
Ausmaß über die Landwirtschaft erstrecken, so der Bayreuther
Kreisobmann Karl Lappe. Da könne nicht einmal mehr die sogenannte
Bauernmilliarde“ etwas daran ändern. Grund dafür ist: Was sich
zunächst nach sehr viel anhört, ist am Ende vielleicht gerade einmal
1000 Euro pro Betrieb und Jahr. Da bleibt nicht viel, so Lappe beim
Betzensteiner Bauerntag.
Betzenstein.
Der Wind bläst der Landwirtschaft immer stärker ins Gesicht. Diesmal
seien es aber nicht nur die rein wirtschaftlichen Ursachen, sondern
Bürokratie, Auflagen und Vorschriften, die sich in nie gekanntem
Ausmaß über die Landwirtschaft erstrecken, so der Bayreuther
Kreisobmann Karl Lappe. Da könne nicht einmal mehr die sogenannte
Bauernmilliarde“ etwas daran ändern. Grund dafür ist: Was sich
zunächst nach sehr viel anhört, ist am Ende vielleicht gerade einmal
1000 Euro pro Betrieb und Jahr. Da bleibt nicht viel, so Lappe beim
Betzensteiner Bauerntag..jpg) Pegnitz.
Die immer schwerer werdende Erzeugung von Lebensmitteln hat
Kreisbäuerin Angelika Seyferth beim Pegnitzer Landfrauentag im
ASV-Sportheim angeprangert. Es wird immer schwieriger
wirtschaftliche zu arbeiten“, sagte Seyferth. Schuld daran seien
zahlreiche Auflagen wie die Düngeverordnung, Einschränkungen bei der
Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen, das Mercosur-Abkommen und
vieles mehr. „Wir brauchen wieder Rahmenbedingungen, die auch
umsetzbar sind“, appellierte sie an die Politik. An den Verbraucher
gerichtet, forderte sie, regionale Lebensmittel zu bevorzugen. Der
Verbraucher bestimme die Nachfrage, die Discounter richteten sich
danach.
Pegnitz.
Die immer schwerer werdende Erzeugung von Lebensmitteln hat
Kreisbäuerin Angelika Seyferth beim Pegnitzer Landfrauentag im
ASV-Sportheim angeprangert. Es wird immer schwieriger
wirtschaftliche zu arbeiten“, sagte Seyferth. Schuld daran seien
zahlreiche Auflagen wie die Düngeverordnung, Einschränkungen bei der
Bewirtschaftung von Gewässerrandstreifen, das Mercosur-Abkommen und
vieles mehr. „Wir brauchen wieder Rahmenbedingungen, die auch
umsetzbar sind“, appellierte sie an die Politik. An den Verbraucher
gerichtet, forderte sie, regionale Lebensmittel zu bevorzugen. Der
Verbraucher bestimme die Nachfrage, die Discounter richteten sich
danach. .jpg) Gegen
Intoleranz und die Radikalisierung der Gesellschaft machte sich die
Bundestagsabgeordnete Silke Launert stark. So sehr sie sich zunächst
darüber gefreut habe, dass sich die Jugend engagiere, so sehr mache
es ihr nun Angst, wenn eine gewisse Radikalisierung eintritt. Das
sogenannte „Oma-Lied“ bezeichnete Launert als absolute Dreistigkeit.
Ausgerechnet die Generation werde beschimpft, die mit ganz wenig
Dingen zurechtgekommen ist. Ohnehin brauche man den Bäuerinnen
nichts von Nachhaltigkeit erzählen. Niemand anderes stehe so für
Nachhaltigkeit wie die Landfrauen, da gebe es nichts, was nicht noch
wiederverwertet werde. Launert warnte, dass die derzeit zu
beobachtende Radikalisierung nicht nur klimamotiviert, sondern gegen
das gesamte System gerichtet sei. „Nicht nur das rechte Lager, auch
das linke Lager möchte das System abschaffen“, so die Abgeordnete.
Gegen
Intoleranz und die Radikalisierung der Gesellschaft machte sich die
Bundestagsabgeordnete Silke Launert stark. So sehr sie sich zunächst
darüber gefreut habe, dass sich die Jugend engagiere, so sehr mache
es ihr nun Angst, wenn eine gewisse Radikalisierung eintritt. Das
sogenannte „Oma-Lied“ bezeichnete Launert als absolute Dreistigkeit.
Ausgerechnet die Generation werde beschimpft, die mit ganz wenig
Dingen zurechtgekommen ist. Ohnehin brauche man den Bäuerinnen
nichts von Nachhaltigkeit erzählen. Niemand anderes stehe so für
Nachhaltigkeit wie die Landfrauen, da gebe es nichts, was nicht noch
wiederverwertet werde. Launert warnte, dass die derzeit zu
beobachtende Radikalisierung nicht nur klimamotiviert, sondern gegen
das gesamte System gerichtet sei. „Nicht nur das rechte Lager, auch
das linke Lager möchte das System abschaffen“, so die Abgeordnete..jpg) Die
stellvertretende Landrätin Christa Reinert-Heinz zog für die
Dachmarke „Bayreuther Land“ ein erste positive Resümee. Seit der
Einführung Anfang Oktober habe sich die Dachmarke sehr gut
entwickelt. Ziel sei es, dass mehr Wertschöpfung bei den Landwirten
hängen bleibt. Reinert-Heinz machte sich außerdem für die
Hotelfachschule Pegnitz stark. „Lassen wir uns im Landkreis nicht
auseinander dividieren“, warnte sie. Die Schule sei gerade in Zeiten
des Fachkräftemangels für den Landkreis eminent wichtig.
Die
stellvertretende Landrätin Christa Reinert-Heinz zog für die
Dachmarke „Bayreuther Land“ ein erste positive Resümee. Seit der
Einführung Anfang Oktober habe sich die Dachmarke sehr gut
entwickelt. Ziel sei es, dass mehr Wertschöpfung bei den Landwirten
hängen bleibt. Reinert-Heinz machte sich außerdem für die
Hotelfachschule Pegnitz stark. „Lassen wir uns im Landkreis nicht
auseinander dividieren“, warnte sie. Die Schule sei gerade in Zeiten
des Fachkräftemangels für den Landkreis eminent wichtig..jpg) Kloster
Banz. Rund 250 Bauern haben mit ihren Schleppern im Umfeld der
vlf-Landesversammlung auf Kloster Banz demonstriert. Hintergrund der
spektakulären Aktion der Vereinigung „Land schafft Verbindung“: der
bayerische Umweltminister Torsten Glauber war einer der Hauptredner
beim Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf). Ihm
überreichten sie einen Forderungskatalog, der unter anderem einen
Abbau der Bürokratie, Nachbesserungen beim Agrarpaket und bei der
Düngeverordnung sowie bei der Umwidmung von landwirtschaftlichen
Nutzflächen zu Naturschutzflächen, wie Streuobstwiesen, beinhaltet.
Kloster
Banz. Rund 250 Bauern haben mit ihren Schleppern im Umfeld der
vlf-Landesversammlung auf Kloster Banz demonstriert. Hintergrund der
spektakulären Aktion der Vereinigung „Land schafft Verbindung“: der
bayerische Umweltminister Torsten Glauber war einer der Hauptredner
beim Verband für landwirtschaftliche Fachbildung (vlf). Ihm
überreichten sie einen Forderungskatalog, der unter anderem einen
Abbau der Bürokratie, Nachbesserungen beim Agrarpaket und bei der
Düngeverordnung sowie bei der Umwidmung von landwirtschaftlichen
Nutzflächen zu Naturschutzflächen, wie Streuobstwiesen, beinhaltet.
.jpg) Glauber
stellte sich in seiner Ansprache vor den bayerischen vlf-Mitgliedern
auf die Seite der Bauern. Er ermahnte die Landwirte aber auch,
künftig doch bitte wieder mit einer Stimme zu sprechen. „Die
Landwirtschaft in Bayern ist völlig heterogen und nicht mehr mit
einer Stimme unterwegs“, sagte er. Ob Bauernverband, BdM oder
Almbäuerinnen, alle legten völlig unterschiedliche Sichtweisen an
den Tag. „Sorgen Sie als Verband dafür, dass die Landwirtschaft
wieder mit einer Stimme spricht, andernfalls wird die Arbeit noch
schwieriger“, sagte Glauber zu den vlf-Mitgliedern.
Glauber
stellte sich in seiner Ansprache vor den bayerischen vlf-Mitgliedern
auf die Seite der Bauern. Er ermahnte die Landwirte aber auch,
künftig doch bitte wieder mit einer Stimme zu sprechen. „Die
Landwirtschaft in Bayern ist völlig heterogen und nicht mehr mit
einer Stimme unterwegs“, sagte er. Ob Bauernverband, BdM oder
Almbäuerinnen, alle legten völlig unterschiedliche Sichtweisen an
den Tag. „Sorgen Sie als Verband dafür, dass die Landwirtschaft
wieder mit einer Stimme spricht, andernfalls wird die Arbeit noch
schwieriger“, sagte Glauber zu den vlf-Mitgliedern..jpg) Ganz
so leicht macht es die Öffentlichkeit den Bauern derzeit allerdings
nicht. Der Berufsstand des Bauern sei in der Stadt hoch angesehen,
das was die Bauern machen allerdings nicht, berichtete Andreas
Hensel, Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung in Berlin.
Der Wissenschaftler gab den Bauern mit auf den Weg, die Kluft
zwischen Experten und Laien kleiner zu machen, um Vertrauensverluste
zu mindern, „soweit es geht“. Grundlage jeder Kommunikation müsse
die Transparenz sein, wenn Glaubwürdigkeit das Ziel ist. Im
unternehmerischen Bereich möge Transparenz eher suspekt klingen und
Besorgnisse um Betriebsgeheimnisse aufkommen lassen. Erfolgreiche
Vorbilder zeigten jedoch den Mehrwert für den einzelnen Betrieb, zum
Beispiel von Prüfzeichen, die unabhängig, neutral und eben
transparent von Verbänden oder Testzentren organisiert werden.
Ganz
so leicht macht es die Öffentlichkeit den Bauern derzeit allerdings
nicht. Der Berufsstand des Bauern sei in der Stadt hoch angesehen,
das was die Bauern machen allerdings nicht, berichtete Andreas
Hensel, Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung in Berlin.
Der Wissenschaftler gab den Bauern mit auf den Weg, die Kluft
zwischen Experten und Laien kleiner zu machen, um Vertrauensverluste
zu mindern, „soweit es geht“. Grundlage jeder Kommunikation müsse
die Transparenz sein, wenn Glaubwürdigkeit das Ziel ist. Im
unternehmerischen Bereich möge Transparenz eher suspekt klingen und
Besorgnisse um Betriebsgeheimnisse aufkommen lassen. Erfolgreiche
Vorbilder zeigten jedoch den Mehrwert für den einzelnen Betrieb, zum
Beispiel von Prüfzeichen, die unabhängig, neutral und eben
transparent von Verbänden oder Testzentren organisiert werden..jpg) Für
ihr herausragendes Engagement für den vlf wurden die folgenden
Persönlichkeiten mit dem Goldenen Verbandsabzeichen geehrt: Dagmar
Hartleb (Meeder, Lks. Coburg), Rudi Steuer (Burgkunstadt, Lks.
Lichtenfels), Konrad Rosenzweig (Wiesenthal, Lks. Forchheim),
Reinhard Kortschak (Ködnitz, Lks. Kulmbach), Georg Hollfelder
(Litzendorf, Lks. Bamberg), Werner Schwarz (Völkenreuth, Lks. Hof),
Finni Herb (Kempten), Alois Kling Pfronten, Inge Kaspar (Neukirchen,
Lks. Sulzbach-Rosenberg), Johann Ziegler (Albenried, Lks.
Schwandorf), Georg Neidlein, Wassertrüdingen, Lks. Ansbach) sowie
der langjährige Europaabgeordnete Albert Deß aus Röckersbühl, Lks.
Neumarkt) und Ministerialdirigent Wolfram Schöhl vom Bayerischen
Landwirtschaftsministerium in München.
Für
ihr herausragendes Engagement für den vlf wurden die folgenden
Persönlichkeiten mit dem Goldenen Verbandsabzeichen geehrt: Dagmar
Hartleb (Meeder, Lks. Coburg), Rudi Steuer (Burgkunstadt, Lks.
Lichtenfels), Konrad Rosenzweig (Wiesenthal, Lks. Forchheim),
Reinhard Kortschak (Ködnitz, Lks. Kulmbach), Georg Hollfelder
(Litzendorf, Lks. Bamberg), Werner Schwarz (Völkenreuth, Lks. Hof),
Finni Herb (Kempten), Alois Kling Pfronten, Inge Kaspar (Neukirchen,
Lks. Sulzbach-Rosenberg), Johann Ziegler (Albenried, Lks.
Schwandorf), Georg Neidlein, Wassertrüdingen, Lks. Ansbach) sowie
der langjährige Europaabgeordnete Albert Deß aus Röckersbühl, Lks.
Neumarkt) und Ministerialdirigent Wolfram Schöhl vom Bayerischen
Landwirtschaftsministerium in München. Kulmbach.
Artensterben und Klimawandel: viele Verbraucher geben den Bauern die
Schuld. Meistens geschieht dies aus Unwissenheit. Alle wollen
mitreden, doch die genauen Hintergründe kennen nur die Wenigsten. Um
aufzuklären, hat der Ring junger Landwirte Kulmbach zu einer
gemeinsamen Informationsveranstaltungen zusammen mit dem Verband für
landwirtschaftliche Fachbildung mit Jens Schuberth einen
Spezialisten eingeladen.
Kulmbach.
Artensterben und Klimawandel: viele Verbraucher geben den Bauern die
Schuld. Meistens geschieht dies aus Unwissenheit. Alle wollen
mitreden, doch die genauen Hintergründe kennen nur die Wenigsten. Um
aufzuklären, hat der Ring junger Landwirte Kulmbach zu einer
gemeinsamen Informationsveranstaltungen zusammen mit dem Verband für
landwirtschaftliche Fachbildung mit Jens Schuberth einen
Spezialisten eingeladen.  Kulmbach.
Die Aktion „HeimatWurzeln“ des Landjugend-Bezirksverbandes
Oberfranken ist noch nicht zu Ende. Zum 70. Geburtstag des
Grundgesetzes und zugleich zum 70. Geburtstag des Dachverbandes
„Bund der Deutschen Landjugend“ sollen in ganz Oberfranken insgesamt
70 verschiedene Bäume gepflanzt werden. Einen der letzten der 70
„Grundgesetzbäume“ haben Vertreter der Landjugend jetzt in der
Kulmbacher „Flutmulde“ entlang des Weißen Mains gepflanzt.
Kulmbach.
Die Aktion „HeimatWurzeln“ des Landjugend-Bezirksverbandes
Oberfranken ist noch nicht zu Ende. Zum 70. Geburtstag des
Grundgesetzes und zugleich zum 70. Geburtstag des Dachverbandes
„Bund der Deutschen Landjugend“ sollen in ganz Oberfranken insgesamt
70 verschiedene Bäume gepflanzt werden. Einen der letzten der 70
„Grundgesetzbäume“ haben Vertreter der Landjugend jetzt in der
Kulmbacher „Flutmulde“ entlang des Weißen Mains gepflanzt.
 Steinfeld.
Alle sind guten Willens, doch wirklich weiter hilft das keinen. Ein
wenig Resignation war schon zu spüren bei der Diskussions- und
Informationsveranstaltung mit dem Titel „Hat unser Wald noch
Zukunft“, die von der Waldbesitzervereinigung Bamberg in Steinfeld
veranstaltet wurde. Die Analyse ist einfach: die Temperaturen waren
in den beiden zurückliegenden Jahren zu hoch, die Niederschläge zu
gering. In der Folge ist es in relativ kurzer Zeit viel wärmer und
gleichzeitig viel trockener geworden. Das haut die stärkste Fichte
um, möchte man sagen, und tatsächlich wird die Situation von den
Waldbesitzern aktuell als katastrophal eingeschätzt.
Steinfeld.
Alle sind guten Willens, doch wirklich weiter hilft das keinen. Ein
wenig Resignation war schon zu spüren bei der Diskussions- und
Informationsveranstaltung mit dem Titel „Hat unser Wald noch
Zukunft“, die von der Waldbesitzervereinigung Bamberg in Steinfeld
veranstaltet wurde. Die Analyse ist einfach: die Temperaturen waren
in den beiden zurückliegenden Jahren zu hoch, die Niederschläge zu
gering. In der Folge ist es in relativ kurzer Zeit viel wärmer und
gleichzeitig viel trockener geworden. Das haut die stärkste Fichte
um, möchte man sagen, und tatsächlich wird die Situation von den
Waldbesitzern aktuell als katastrophal eingeschätzt. Schießl
(Bild links) machte eine einfache Rechnung auf: Ein
Kleinwaldbesitzer mit 3,6 Hektar Fläche, bei dem die Hälfte vom
Borkenkäfer betroffen ist, sei nun gezwungen, das Holz
aufzuarbeiten, zu verwerten und die Fläche zu räumen. Nimmt man 540
Festmeter Schadholz an, koste die Aufarbeitung rund 5400 Euro. Bei
2,50 Euro pro benötigter Pflanze komme man trotz staatlicher
Förderung von 1,10 Euro pro Pflanze auf 7560 Euro. Macht alles in
allem fast 13000 Euro an Kosten, um die Schadenssituation zu
beheben. Früher hätte der Waldbesitzer für die gleiche Holzmenge
eine stattliche fünfstellige Summe bekommen.
Schießl
(Bild links) machte eine einfache Rechnung auf: Ein
Kleinwaldbesitzer mit 3,6 Hektar Fläche, bei dem die Hälfte vom
Borkenkäfer betroffen ist, sei nun gezwungen, das Holz
aufzuarbeiten, zu verwerten und die Fläche zu räumen. Nimmt man 540
Festmeter Schadholz an, koste die Aufarbeitung rund 5400 Euro. Bei
2,50 Euro pro benötigter Pflanze komme man trotz staatlicher
Förderung von 1,10 Euro pro Pflanze auf 7560 Euro. Macht alles in
allem fast 13000 Euro an Kosten, um die Schadenssituation zu
beheben. Früher hätte der Waldbesitzer für die gleiche Holzmenge
eine stattliche fünfstellige Summe bekommen. „Wir
brauchen halt etwas Zeit, um zukunftsfähige Wälder zu schaffen“, so
Andreas Hahn (linkls) von der Landesanstalt für Wald- und
Forstwirtschaft in Weihenstephan. Der Wald werde nicht sterben, aber
er werde sich verändern, und zwar in Richtung lichte, südländische
Wälder. Eine Baumart ganz ohne Schädlinge werde es aber auch in
Zukunft nicht geben. Holz sei der Rohstoff des nächsten
Jahrtausends, machte der Steinfelder Revierleiter Michael Bug den
Waldbesitzern Hoffnung. Grund dafür ist, dass Holz der einzige
Rohstoff ist, der nachwächst.
„Wir
brauchen halt etwas Zeit, um zukunftsfähige Wälder zu schaffen“, so
Andreas Hahn (linkls) von der Landesanstalt für Wald- und
Forstwirtschaft in Weihenstephan. Der Wald werde nicht sterben, aber
er werde sich verändern, und zwar in Richtung lichte, südländische
Wälder. Eine Baumart ganz ohne Schädlinge werde es aber auch in
Zukunft nicht geben. Holz sei der Rohstoff des nächsten
Jahrtausends, machte der Steinfelder Revierleiter Michael Bug den
Waldbesitzern Hoffnung. Grund dafür ist, dass Holz der einzige
Rohstoff ist, der nachwächst..jpg) Nurn.
Was lange währt, wird endlich gut: 40 Jahre nach dem Start sind das
Dorferneuerungs- und Flurneuordnungsverfahren in Nurn, einem
Ortsteil von Steinwiesen im oberfränkischen Landkreis Kronach, jetzt
abgeschlossen worden. Bei der Segnung eines Gedenksteines am neuen
Ringweg oberhalb der Ortschaft und bei einer Feierstunde im
Mehrzweckhaus wurde deutlich, dass dieses Verfahren ungewöhnlich
viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Das Ergebnis aber hat sich
gelohnt, sowohl für die 490 Einwohner der Ortschaft, als auch für
alle beteiligten Landwirte.
Nurn.
Was lange währt, wird endlich gut: 40 Jahre nach dem Start sind das
Dorferneuerungs- und Flurneuordnungsverfahren in Nurn, einem
Ortsteil von Steinwiesen im oberfränkischen Landkreis Kronach, jetzt
abgeschlossen worden. Bei der Segnung eines Gedenksteines am neuen
Ringweg oberhalb der Ortschaft und bei einer Feierstunde im
Mehrzweckhaus wurde deutlich, dass dieses Verfahren ungewöhnlich
viele Höhen und Tiefen erlebt hat. Das Ergebnis aber hat sich
gelohnt, sowohl für die 490 Einwohner der Ortschaft, als auch für
alle beteiligten Landwirte..jpg) Nun
seien die Ziele der Dorf- und Flurneuordnung endlich in vollem
Umfang erreicht. Es habe sich gezeigt, dass eine intakte
Dorfgemeinschaft Voraussetzung dafür ist, dass Visionen und Träume
eines Tages Wirklichkeit werden, so der Bürgermeister. Alle
Maßnahmen hätten die Infrastruktur in Nurn verbessert und die
Attraktivität des ländlichen Raumes erhöht.
Nun
seien die Ziele der Dorf- und Flurneuordnung endlich in vollem
Umfang erreicht. Es habe sich gezeigt, dass eine intakte
Dorfgemeinschaft Voraussetzung dafür ist, dass Visionen und Träume
eines Tages Wirklichkeit werden, so der Bürgermeister. Alle
Maßnahmen hätten die Infrastruktur in Nurn verbessert und die
Attraktivität des ländlichen Raumes erhöht..jpg) Bayreuth.
Es war eine der größten Demonstrationen, die Bayreuth je erlebt hat.
Nach Veranstalterangaben waren es über 1000 Landwirte aus ganz
Oberfranken und den angrenzenden Regionen, die mit ihren Traktoren
in einem zwölf Kilometer langen Konvoi von der Gemeinde Bindlach
nördlich der Stadt bis zum Grünen Zentrum ganz im Süden Bayreuths
fuhren. Nicht nur der Verkehr, sondern auch Teile des öffentlichen
Lebens standen dabei über mehrere Stunden lang still. So fiel zum
Beispiel an mehreren Schulen ab dem späten Vormittag der Unterricht
aus, zahlreiche Linien des Stadtbusverkehrs stellten ihren Betrieb
ein.
Bayreuth.
Es war eine der größten Demonstrationen, die Bayreuth je erlebt hat.
Nach Veranstalterangaben waren es über 1000 Landwirte aus ganz
Oberfranken und den angrenzenden Regionen, die mit ihren Traktoren
in einem zwölf Kilometer langen Konvoi von der Gemeinde Bindlach
nördlich der Stadt bis zum Grünen Zentrum ganz im Süden Bayreuths
fuhren. Nicht nur der Verkehr, sondern auch Teile des öffentlichen
Lebens standen dabei über mehrere Stunden lang still. So fiel zum
Beispiel an mehreren Schulen ab dem späten Vormittag der Unterricht
aus, zahlreiche Linien des Stadtbusverkehrs stellten ihren Betrieb
ein..jpg) Alle
gut 40 Ampeln entlang der Route waren mit Polizisten besetzt, Sogar
ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Laut Pressesprecher Jan Koch
und dem Leiter der Verkehrsbetriebe Werner Schreiner konnten die
Stadtbusse etwa ein Drittel der rund 370 Haltestellen in Bayreuth ab
11 Uhr nicht mehr erreichen. Grundsätzlich gab es auf fast allen
Linien Verspätungen.
Alle
gut 40 Ampeln entlang der Route waren mit Polizisten besetzt, Sogar
ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Laut Pressesprecher Jan Koch
und dem Leiter der Verkehrsbetriebe Werner Schreiner konnten die
Stadtbusse etwa ein Drittel der rund 370 Haltestellen in Bayreuth ab
11 Uhr nicht mehr erreichen. Grundsätzlich gab es auf fast allen
Linien Verspätungen. .jpg) Die
Landwirte hätten in den vergangenen Monaten versucht, sich Gehör zu
verschaffen, mit der Politik ins Gespräch zu kommen. „Aber wir
werden einfach nicht gehört“, sagte Andreas Wolfrum aus dem mehr als
15-köpfigen oberfränkischen Organisationsteam bei der Kundgebung.
Viele Familienbetriebe, auch und gerade in Oberfranken, würden sich
in einer ausweglosen Situation befinden, so der junge Landwirt aus
Gattendorf bei Hof.
Die
Landwirte hätten in den vergangenen Monaten versucht, sich Gehör zu
verschaffen, mit der Politik ins Gespräch zu kommen. „Aber wir
werden einfach nicht gehört“, sagte Andreas Wolfrum aus dem mehr als
15-köpfigen oberfränkischen Organisationsteam bei der Kundgebung.
Viele Familienbetriebe, auch und gerade in Oberfranken, würden sich
in einer ausweglosen Situation befinden, so der junge Landwirt aus
Gattendorf bei Hof..jpg) Königsfeld.
Von einer regional höchst unterschiedlichen Ernte im Landkreis
Bamberg hat Kreisobmann Edgar Böhmer berichtet. Beim Jurabauerntag
zum Erntedankfest in Königsfeld sprach er von einer größtenteils
zufriedenstellenden Getreideernte, aber auch von Ertragseinbußen
beispielsweise beim Mais um rund ein Drittel. Die Futtersituation
sei etwas besser gewesen als im Trockenjahr 2018, aber längst noch
nicht so, wie sie sich die Bauern gewünscht hätten.
Königsfeld.
Von einer regional höchst unterschiedlichen Ernte im Landkreis
Bamberg hat Kreisobmann Edgar Böhmer berichtet. Beim Jurabauerntag
zum Erntedankfest in Königsfeld sprach er von einer größtenteils
zufriedenstellenden Getreideernte, aber auch von Ertragseinbußen
beispielsweise beim Mais um rund ein Drittel. Die Futtersituation
sei etwas besser gewesen als im Trockenjahr 2018, aber längst noch
nicht so, wie sie sich die Bauern gewünscht hätten. .jpg) „Im
weltweiten Vergleich sind wir auf einem absolut hohen Niveau und das
hat auch seinen Preis, pflichtete ihm Anneliese Goller, Bamberger
Kreisbäuerin, oberfränkische Bezirksbäuerin und bayerische
Landesbäuerin bei. Kurze Wege und regionale Produkte, das sei
gelebter Klimaschutz. Deshalb müsse es aufhören, dass die Bauern
permanent an den Pranger gestellt werden. Sie sollten stattdessen
wieder in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden.
„Im
weltweiten Vergleich sind wir auf einem absolut hohen Niveau und das
hat auch seinen Preis, pflichtete ihm Anneliese Goller, Bamberger
Kreisbäuerin, oberfränkische Bezirksbäuerin und bayerische
Landesbäuerin bei. Kurze Wege und regionale Produkte, das sei
gelebter Klimaschutz. Deshalb müsse es aufhören, dass die Bauern
permanent an den Pranger gestellt werden. Sie sollten stattdessen
wieder in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden. Betzenstein.
„Umwelt- und Naturschutz passieren längst, und zwar durch
Bauernhand.“ Das hat die bayerische Landwirtschaftsministerin
Michaela Kaniber bei einer Veranstaltung der Jungen Union
Bayreuth-Land in Betzenstein unmissverständlich klar gemacht. Die
Politikerin verteidigte dabei in erster Linie die Annahme des
Volksbegehrend zum Artenschutz durch die Staatsregierung.
„Andernfalls hätten wir den Gesetzesentwurf der Organisatoren eins
zu eins übernehmen müssen“, sagte sie.
Betzenstein.
„Umwelt- und Naturschutz passieren längst, und zwar durch
Bauernhand.“ Das hat die bayerische Landwirtschaftsministerin
Michaela Kaniber bei einer Veranstaltung der Jungen Union
Bayreuth-Land in Betzenstein unmissverständlich klar gemacht. Die
Politikerin verteidigte dabei in erster Linie die Annahme des
Volksbegehrend zum Artenschutz durch die Staatsregierung.
„Andernfalls hätten wir den Gesetzesentwurf der Organisatoren eins
zu eins übernehmen müssen“, sagte sie..jpg) Kulmbach.
Atlas-Zeder, Libanon-Zeder oder Esskastanie: diese Baumarten
vertragen Trockenheit, Hitze und Kälte gleichermaßen. Sie könnten
die Bäume für den Wald der Zukunft sein und langfristig Fichten und
Tannen ersetzen. Um erste Erfahrungen mit diesen Baumarten sammeln
zu können, ist im Stadtwald von Kulmbach einen Versuchspflanzgarten
für Bäume angelegt worden, ein sogenanntes „Arboretum“. Die Fläche
ist Teil der Initiative Zukunftswald Bayern. Den ersten Baum
pflanzte jetzt die Landwirtschaftsministerin Michaelas Kaniber
zusammen mit der siebenjährigen Amelie Löffler.
Kulmbach.
Atlas-Zeder, Libanon-Zeder oder Esskastanie: diese Baumarten
vertragen Trockenheit, Hitze und Kälte gleichermaßen. Sie könnten
die Bäume für den Wald der Zukunft sein und langfristig Fichten und
Tannen ersetzen. Um erste Erfahrungen mit diesen Baumarten sammeln
zu können, ist im Stadtwald von Kulmbach einen Versuchspflanzgarten
für Bäume angelegt worden, ein sogenanntes „Arboretum“. Die Fläche
ist Teil der Initiative Zukunftswald Bayern. Den ersten Baum
pflanzte jetzt die Landwirtschaftsministerin Michaelas Kaniber
zusammen mit der siebenjährigen Amelie Löffler..jpg) Dazu
kommt jetzt die Initiative Zukunftswald Bayern, zu der die
Kulmbacher Versuchsfläche gehört. Hier soll nach den Worten Kanibers
getestet werden, unter welchen Voraussetzungen welche Bäume am
besten wachsen. „So können wir unseren Waldbesitzer künftig
bestmöglich beraten, welche Auswahl an Bäumen sie für ihre Wälder
zur Verfügung haben.
Dazu
kommt jetzt die Initiative Zukunftswald Bayern, zu der die
Kulmbacher Versuchsfläche gehört. Hier soll nach den Worten Kanibers
getestet werden, unter welchen Voraussetzungen welche Bäume am
besten wachsen. „So können wir unseren Waldbesitzer künftig
bestmöglich beraten, welche Auswahl an Bäumen sie für ihre Wälder
zur Verfügung haben.  Bayreuth.
Beim derzeitigen Megathema Klimaschutz ist die Landwirtschaft nicht
das Problem, sondern die Lösung. Das hat der Agrarpolitische
Sprecher der CSU im Bundestag, Artur Auernhammer aus dem
mittelfränkischen Weißenburg, bei einem agrarpolitischen
Fachgespräch von Dr. Silke Launert und der Landtagsabgeordneten
Gudrun Brendel-Fischer festgestellt. Ob in Sachen Erneuerbare
Energien oder beim Wald und Forst, die Landwirtschaft habe großes
Potenzial, um zum Klimaschutz beizutragen.
Bayreuth.
Beim derzeitigen Megathema Klimaschutz ist die Landwirtschaft nicht
das Problem, sondern die Lösung. Das hat der Agrarpolitische
Sprecher der CSU im Bundestag, Artur Auernhammer aus dem
mittelfränkischen Weißenburg, bei einem agrarpolitischen
Fachgespräch von Dr. Silke Launert und der Landtagsabgeordneten
Gudrun Brendel-Fischer festgestellt. Ob in Sachen Erneuerbare
Energien oder beim Wald und Forst, die Landwirtschaft habe großes
Potenzial, um zum Klimaschutz beizutragen..jpg) Himmelkron.
Die schlechte Ernte im Landkreis Kulmbacher haben Vertreter der
Politik und des Bauernverbandes beim Kreiserntedank in Himmelkron
beklagt. Speziell im Kulmbacher Land seien Trockenheit und Dürre
besonders ausgeprägt gewesen, sagte Kreisobmann Wilfried Löwinger.
Bei vielen Bauernfamilien lägen die Nerven deshalb blank.
Himmelkron.
Die schlechte Ernte im Landkreis Kulmbacher haben Vertreter der
Politik und des Bauernverbandes beim Kreiserntedank in Himmelkron
beklagt. Speziell im Kulmbacher Land seien Trockenheit und Dürre
besonders ausgeprägt gewesen, sagte Kreisobmann Wilfried Löwinger.
Bei vielen Bauernfamilien lägen die Nerven deshalb blank..jpg) Für
Schöffel steht es nun an erster Stelle, die gesellschaftliche
Akzeptanz wiederherzustellen. „Da hilft es nur, aufeinander
zuzugehen“, sagte er. Aus der Verteidigung heraus könne man ein
Spiel nicht gewinnen, zog er eine Parallele zum Fußball. Der
Abgeordnete kündigte an, mehr Aufklärung über die Landwirtschaft
sowie über Ernährung und Alltagskompetenzen in die Schulen zu
bringen. In einem weiteren Vorhaben soll speziell die
Großstadtbevölkerung informiert und emotional an die Landwirtschaft
herangeführt werden.
Für
Schöffel steht es nun an erster Stelle, die gesellschaftliche
Akzeptanz wiederherzustellen. „Da hilft es nur, aufeinander
zuzugehen“, sagte er. Aus der Verteidigung heraus könne man ein
Spiel nicht gewinnen, zog er eine Parallele zum Fußball. Der
Abgeordnete kündigte an, mehr Aufklärung über die Landwirtschaft
sowie über Ernährung und Alltagskompetenzen in die Schulen zu
bringen. In einem weiteren Vorhaben soll speziell die
Großstadtbevölkerung informiert und emotional an die Landwirtschaft
herangeführt werden..jpg) Scheßlitz.
Mit diesem Ansturm hatte kaum einer gerechnet. Mehrere zehntausend
Besucher haben ersten Schätzungen zufolge den 4. Genusstag der
Region Bamberg verbunden mit dem BBV-Kreiserntedankfest besucht. An
den meisten der über 60 Stände der Anbieter regionaler Produkte
bildeten schon kurz nach dem offiziellen Auftakt lange Schlangen und
in der für den Verkehr gesperrten Hauptstraße des Jura-Städtchens
gab es schon am frühen Nachmittag kaum mehr ein Durchkommen.
Scheßlitz.
Mit diesem Ansturm hatte kaum einer gerechnet. Mehrere zehntausend
Besucher haben ersten Schätzungen zufolge den 4. Genusstag der
Region Bamberg verbunden mit dem BBV-Kreiserntedankfest besucht. An
den meisten der über 60 Stände der Anbieter regionaler Produkte
bildeten schon kurz nach dem offiziellen Auftakt lange Schlangen und
in der für den Verkehr gesperrten Hauptstraße des Jura-Städtchens
gab es schon am frühen Nachmittag kaum mehr ein Durchkommen.
.jpg) In
den Ansprachen später im Festzelt ließ kaum ein Redner das
derzeitige Topthema Klimawandel aus. Einig waren sich dabei alle:
„Die Landwirtschaft ist nicht das Problem, sondern ein Teil der
Lösung“. Schließlich seien es die Bauern, die den Klimawandel als
erste spürten, sagte Kreisobmann Edgar Böhmer.
In
den Ansprachen später im Festzelt ließ kaum ein Redner das
derzeitige Topthema Klimawandel aus. Einig waren sich dabei alle:
„Die Landwirtschaft ist nicht das Problem, sondern ein Teil der
Lösung“. Schließlich seien es die Bauern, die den Klimawandel als
erste spürten, sagte Kreisobmann Edgar Böhmer..jpg) Dank
unserer heimischen Landwirtschaft brauche man keine Angst haben,
Hunger leiden zu müssen, sagte BBV-Vizepräsident Günter Felßner.
Wenn hierzulande alle satt sein können, dann liege das an der
modernen Landwirtschaft, sie sei die Ursache für unseren hohen
Lebensstandard. Trotzdem sei diese Landwirtschaft gerade dabei sich
zu verabschieden. „Unserer deutschen Bevölkerung laufen die Bauern
davon“, fand er drastische Worte. Und erklärte die BBV-Aktion mit
den grünen Feldkreuzen, die derzeit überall aufgestellt werden. Die
Stimmung unter den Landwirten sei so schlecht wie nie zuvor, unser
aller Konsumverhalten stehe auf dem Prüfstand. „Bauern und Bürger
müssen wieder eine Einheit werden, momentan sind wir davon
allerdings meilenweit entfernt“.
Dank
unserer heimischen Landwirtschaft brauche man keine Angst haben,
Hunger leiden zu müssen, sagte BBV-Vizepräsident Günter Felßner.
Wenn hierzulande alle satt sein können, dann liege das an der
modernen Landwirtschaft, sie sei die Ursache für unseren hohen
Lebensstandard. Trotzdem sei diese Landwirtschaft gerade dabei sich
zu verabschieden. „Unserer deutschen Bevölkerung laufen die Bauern
davon“, fand er drastische Worte. Und erklärte die BBV-Aktion mit
den grünen Feldkreuzen, die derzeit überall aufgestellt werden. Die
Stimmung unter den Landwirten sei so schlecht wie nie zuvor, unser
aller Konsumverhalten stehe auf dem Prüfstand. „Bauern und Bürger
müssen wieder eine Einheit werden, momentan sind wir davon
allerdings meilenweit entfernt“..jpg) Positiv
stimmte allerdings der Zuspruch für das Genussfest. Damit feierte
die Regionalkampagne des Landkreises Bamberg gleichzeitig ihr
15-jähriges Bestehen. Aus den Anfangs 30 Gründungsmitgliedern ist
mittlerweile eine Kampagne mit 130 Betrieben und rund 300 Produkten
entstanden. Ziele sind nach den Worten von Landrat Johann Kalb die
Nachhaltigkeit, Natur- und Klimaschutz aber auch die Freude am
Genuss und die Wertschätzung regionaler Produkte.
Positiv
stimmte allerdings der Zuspruch für das Genussfest. Damit feierte
die Regionalkampagne des Landkreises Bamberg gleichzeitig ihr
15-jähriges Bestehen. Aus den Anfangs 30 Gründungsmitgliedern ist
mittlerweile eine Kampagne mit 130 Betrieben und rund 300 Produkten
entstanden. Ziele sind nach den Worten von Landrat Johann Kalb die
Nachhaltigkeit, Natur- und Klimaschutz aber auch die Freude am
Genuss und die Wertschätzung regionaler Produkte..jpg) „Fast
schon geflasht“, wie sie es ausdrückte zeigte sich wegen des großen
Zuspruchs in Scheßlitz die neue bayerische Milchkönigin Beatrice
Scheitz. Auch sie warb für die große Vielfalt regionaler Produkte
und rief dazu auf, mit jedem Schluck Milch auch einen wenig die
bayerische Heimat zu genießen.
„Fast
schon geflasht“, wie sie es ausdrückte zeigte sich wegen des großen
Zuspruchs in Scheßlitz die neue bayerische Milchkönigin Beatrice
Scheitz. Auch sie warb für die große Vielfalt regionaler Produkte
und rief dazu auf, mit jedem Schluck Milch auch einen wenig die
bayerische Heimat zu genießen. .jpg) Amberg.
Katharina Gegg aus Neuburg an der Donau und Alexandra Krumbachner aus
Traunstein sind die neuen bayerischen Honighoheiten. Die neue Honigkönigin
und die neue Honigprinzessin wurden beim Bayerischen Imkertag in Amberg von
Verbandspräsident Stefan Spiegl und von BBV-Präsident Walter Heidl
vorgestellt und gekrönt. Die beiden jungen Frauen lösen Katharina Eder aus
Vilsbiburg und Doris Grünbauer aus Weiden ab. Sie waren in den
zurückliegenden beiden Jahren als die Honigbotschafterinnen aus dem
Freistaat unterwegs.
Amberg.
Katharina Gegg aus Neuburg an der Donau und Alexandra Krumbachner aus
Traunstein sind die neuen bayerischen Honighoheiten. Die neue Honigkönigin
und die neue Honigprinzessin wurden beim Bayerischen Imkertag in Amberg von
Verbandspräsident Stefan Spiegl und von BBV-Präsident Walter Heidl
vorgestellt und gekrönt. Die beiden jungen Frauen lösen Katharina Eder aus
Vilsbiburg und Doris Grünbauer aus Weiden ab. Sie waren in den
zurückliegenden beiden Jahren als die Honigbotschafterinnen aus dem
Freistaat unterwegs. .jpg) Die
neue Honigkönigin Katharina Gegg ist 25 Jahre jung und zusammen mit fünf
Geschwistern auf dem Hof der Eltern groß geworden. „Papa hat seit seiner
Kindheit Bienen gehalten“, sagte sie. Bis vor zehn Jahren, dann sei die
Arbeitsbelastung zu groß geworden. Katharina sei es schließlich gewesen, die
sich dafür stark gemacht habe, die Honigbienen wieder zurückzuholen.
Inzwischen gebe es zwei Völker auf dem elterlichen Hof im oberbayerischen
Neuburg an der Donau. Neben ihrem Studium „Management und Technology“
absolvierte sie bereits einen Imkerkurs. „Durch das Volksbegehren ist die
Biene wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt“, sagte Katharina II.
in ihrer Antrittsrede. Nun seien alle gefordert, Flächenverbrach und
Versiegelung zu reduzieren, um eine insektenfreundliche Umgebung zu
schaffen.
Die
neue Honigkönigin Katharina Gegg ist 25 Jahre jung und zusammen mit fünf
Geschwistern auf dem Hof der Eltern groß geworden. „Papa hat seit seiner
Kindheit Bienen gehalten“, sagte sie. Bis vor zehn Jahren, dann sei die
Arbeitsbelastung zu groß geworden. Katharina sei es schließlich gewesen, die
sich dafür stark gemacht habe, die Honigbienen wieder zurückzuholen.
Inzwischen gebe es zwei Völker auf dem elterlichen Hof im oberbayerischen
Neuburg an der Donau. Neben ihrem Studium „Management und Technology“
absolvierte sie bereits einen Imkerkurs. „Durch das Volksbegehren ist die
Biene wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt“, sagte Katharina II.
in ihrer Antrittsrede. Nun seien alle gefordert, Flächenverbrach und
Versiegelung zu reduzieren, um eine insektenfreundliche Umgebung zu
schaffen..jpg) Inhaltlich
ging es beim Imkertag diesmal vor allem um das weltweite Phänomen des
Insektenrückgangs und die hohe Sensibilisierung in der Bevölkerung für das
Thema. „Die Bienen befinden sich in einer Art Zangengriff“, sagte Dr. Gernot
Spielvogel aus Memmingen. Nach den Worten des Geologen liege der Schwarze
Peter aber nicht allein bei der Landwirtschaft. Landverbrauch,
Straßenverkehr, Dieselsmog, Stickstoffemissionen: das alle seien Gründe für
den Insektenrückgang. Und eben auch der Mobilfunk, weil er nahezu
flächendeckend vorhanden und immer aktiv sei. In den elektromagnetischen
Feldern, die vom Mobilfunk, aber auch von Überlandleitungen ausgehen, seien
besonders die Bienen beeinträchtigt. Versuche hätten gezeigt, dass Bienen
unter dem Einfluss elektromagnetischer Wellen mehr und mehr aggressiv
werden, ihre Brut ausräumen und letztlich die gesamte Honigproduktion zum
Erliegen kommt.
Inhaltlich
ging es beim Imkertag diesmal vor allem um das weltweite Phänomen des
Insektenrückgangs und die hohe Sensibilisierung in der Bevölkerung für das
Thema. „Die Bienen befinden sich in einer Art Zangengriff“, sagte Dr. Gernot
Spielvogel aus Memmingen. Nach den Worten des Geologen liege der Schwarze
Peter aber nicht allein bei der Landwirtschaft. Landverbrauch,
Straßenverkehr, Dieselsmog, Stickstoffemissionen: das alle seien Gründe für
den Insektenrückgang. Und eben auch der Mobilfunk, weil er nahezu
flächendeckend vorhanden und immer aktiv sei. In den elektromagnetischen
Feldern, die vom Mobilfunk, aber auch von Überlandleitungen ausgehen, seien
besonders die Bienen beeinträchtigt. Versuche hätten gezeigt, dass Bienen
unter dem Einfluss elektromagnetischer Wellen mehr und mehr aggressiv
werden, ihre Brut ausräumen und letztlich die gesamte Honigproduktion zum
Erliegen kommt..jpg) Was
den Bienen noch zu schaffen macht, sind nach Aussage von Professor Dr. Dr.
Randolf Menzel vom Institut für Biologie der Freien Universität Berlin
Pflanzenschutzmittel. Besonders die Gruppe der Neonicotinoide seien
„Gehirndrogen für Insekten“, sagte der Neurobiologe. Auch hier seien Bienen
wieder besonders gefährdet, weil sie die Funktion des Umweltindikators
hätten. Bienen könnten kommunizieren, sie seien in der Lage, Signale
wahrzunehmen, sicher zu navigieren und ein gutes Gedächtnis auszubilden.
Obwohl das Gehirn der Biene gerade mal so groß ist wie ein Sandkorn,
befänden sich darin rund eine Million Nervenzellen.
Was
den Bienen noch zu schaffen macht, sind nach Aussage von Professor Dr. Dr.
Randolf Menzel vom Institut für Biologie der Freien Universität Berlin
Pflanzenschutzmittel. Besonders die Gruppe der Neonicotinoide seien
„Gehirndrogen für Insekten“, sagte der Neurobiologe. Auch hier seien Bienen
wieder besonders gefährdet, weil sie die Funktion des Umweltindikators
hätten. Bienen könnten kommunizieren, sie seien in der Lage, Signale
wahrzunehmen, sicher zu navigieren und ein gutes Gedächtnis auszubilden.
Obwohl das Gehirn der Biene gerade mal so groß ist wie ein Sandkorn,
befänden sich darin rund eine Million Nervenzellen. .jpg) Beim
Bayerischen Imkertag wurde Eckhard Radke aus Dietmannsried mit der
Zander-Medaille in Gold, der höchsten Auszeichnung des Landesverbandes
Bayerischer Imker, ausgezeichnet. Radke war unter anderem von 2012 bis 2018
Präsident des Verbandes. Daneben ist er bis heute Präsidiumsmitglied auf
Bundesebene. Er hatte das Patenimkermodell, das sogenannte „Dietmannsrieder
Modell“ ins Leben gerufen und sei damit weit über die bayerischen Grenzen
hinweg bekannt geworden, sagte der deutsche Imkerpräsident Peter Maske, der
die Ehrung vornahm.
Beim
Bayerischen Imkertag wurde Eckhard Radke aus Dietmannsried mit der
Zander-Medaille in Gold, der höchsten Auszeichnung des Landesverbandes
Bayerischer Imker, ausgezeichnet. Radke war unter anderem von 2012 bis 2018
Präsident des Verbandes. Daneben ist er bis heute Präsidiumsmitglied auf
Bundesebene. Er hatte das Patenimkermodell, das sogenannte „Dietmannsrieder
Modell“ ins Leben gerufen und sei damit weit über die bayerischen Grenzen
hinweg bekannt geworden, sagte der deutsche Imkerpräsident Peter Maske, der
die Ehrung vornahm..jpg) Kornbach.
In jedem Dorf gab es früher mindestens eine Viehwaage. Seit den
1980er Jahren wurden sie sukzessive abgebaut, Schlachtvieh wurde von
nun an in den Schlachthöfen gewogen. Ein Ort, in dem noch immer eine
geeichte Viehwaage existiert ist Kornbach, ein keiner Ortsteil von
Gefrees im Landkreis Bayreuth. Eigentümer der Viehwaage mitten im
Dorf ist die Stadt Gefrees. Dem Bauernverband wurde die Waage schon
1981 zusammen mit dem dazugehörigen Gebäude und der Zufahrt zur
mietfreien Nutzung überlassen. Heute kümmert sich ein eigenes Team
um den Erhalt des alten bäuerlichen Kulturgutes.
Kornbach.
In jedem Dorf gab es früher mindestens eine Viehwaage. Seit den
1980er Jahren wurden sie sukzessive abgebaut, Schlachtvieh wurde von
nun an in den Schlachthöfen gewogen. Ein Ort, in dem noch immer eine
geeichte Viehwaage existiert ist Kornbach, ein keiner Ortsteil von
Gefrees im Landkreis Bayreuth. Eigentümer der Viehwaage mitten im
Dorf ist die Stadt Gefrees. Dem Bauernverband wurde die Waage schon
1981 zusammen mit dem dazugehörigen Gebäude und der Zufahrt zur
mietfreien Nutzung überlassen. Heute kümmert sich ein eigenes Team
um den Erhalt des alten bäuerlichen Kulturgutes..jpg) Mit
Hilde der Gebühren wurde die Waage instand gehalten und geeicht, so
Karin Brey. Ihr 2009 verstorbener Schwiegervater war in Kornbach der
letzte amtlich vereidigte „Wäger“. 1955 hatte er beim Eichamt in
Münchberg seine Prüfung abgelegt. Erzählungen aus dem Dorf zufolge
hatte man ihn den Apotheker genannt, weil er sich immer sehr viel
Zeit genommen habe, das Gewicht ganz genau zu ermitteln.
Mit
Hilde der Gebühren wurde die Waage instand gehalten und geeicht, so
Karin Brey. Ihr 2009 verstorbener Schwiegervater war in Kornbach der
letzte amtlich vereidigte „Wäger“. 1955 hatte er beim Eichamt in
Münchberg seine Prüfung abgelegt. Erzählungen aus dem Dorf zufolge
hatte man ihn den Apotheker genannt, weil er sich immer sehr viel
Zeit genommen habe, das Gewicht ganz genau zu ermitteln..jpg) Kothigenbibersbach.
Der Münchteich bei Kothigenbibersbach, Gemeinde Thiersheim im Landkreis
Wunsiedel, ist ganz offiziell zu einem überregional bedeutsamen Kulturgut
erklärt worden. Der Weiher präge seit Jahrhunderte die Landschaft, werde bis
heute teichwirtschaftlich genutzt und trage maßgeblich zum Erhalt der
Artenvielfalt bei, heißt es auf der Urkunde, die der Direktor der
Bezirksverwaltung Peter Meyer und der Vorsitzende der Teichgenossenschaft
Oberfranken Dr. Peter Thoma an die Eigentümer und den Bewirtschafter
überreichten. Vergeben wird die Auszeichnung „Kulturgut Teich“ seit 1998 von
der Teichgenossenschaft. Dokumentiert wird die Auszeichnung durch eine
Informationstafel, die nahe des Münchteichs wurde.
Kothigenbibersbach.
Der Münchteich bei Kothigenbibersbach, Gemeinde Thiersheim im Landkreis
Wunsiedel, ist ganz offiziell zu einem überregional bedeutsamen Kulturgut
erklärt worden. Der Weiher präge seit Jahrhunderte die Landschaft, werde bis
heute teichwirtschaftlich genutzt und trage maßgeblich zum Erhalt der
Artenvielfalt bei, heißt es auf der Urkunde, die der Direktor der
Bezirksverwaltung Peter Meyer und der Vorsitzende der Teichgenossenschaft
Oberfranken Dr. Peter Thoma an die Eigentümer und den Bewirtschafter
überreichten. Vergeben wird die Auszeichnung „Kulturgut Teich“ seit 1998 von
der Teichgenossenschaft. Dokumentiert wird die Auszeichnung durch eine
Informationstafel, die nahe des Münchteichs wurde..jpg) Die
erste urkundliche Erwähnung des Münchteichs ist auf das Jahr 1499 datiert.
Wahrscheinlich ist der Teich aber noch viel älter. Zunächst gehörte er dem
Orden der Barfußmönche in Eger, später hatten ihn sechs Mühlen in der
Umgebung erworben und genutzt. Die Mühlen gibt es heute längst nicht mehr,
den Teich schon. Er gehört Georg Tröger und Artur Steinel und wird von dem
Teichwirt Markus Fuchs bewirtschaftet.
Die
erste urkundliche Erwähnung des Münchteichs ist auf das Jahr 1499 datiert.
Wahrscheinlich ist der Teich aber noch viel älter. Zunächst gehörte er dem
Orden der Barfußmönche in Eger, später hatten ihn sechs Mühlen in der
Umgebung erworben und genutzt. Die Mühlen gibt es heute längst nicht mehr,
den Teich schon. Er gehört Georg Tröger und Artur Steinel und wird von dem
Teichwirt Markus Fuchs bewirtschaftet..jpg) Als
örtliche Besonderheit wurde auf Initiative des Thiersheimer Heimatpflegers
Siegfried Schelter gleich neben der neuen Informationstafel ein
Flurnamenstein errichtet, der ebenfalls auf den Münchteich hinweist.
Als
örtliche Besonderheit wurde auf Initiative des Thiersheimer Heimatpflegers
Siegfried Schelter gleich neben der neuen Informationstafel ein
Flurnamenstein errichtet, der ebenfalls auf den Münchteich hinweist..jpg) Schirradorf.
In seinen Adern fließt kein Blut, in seinen Adern fließt Benzin:
Raimund Schramm (55) aus dem kleinen Örtchen Dankenfeld im
unterfränkischen Landkreis Haßberge. Zusammen mit Tochter Katharina
und Sohn Johannes hatte er am Sonntag bei der traditionellen
Oldtimerrundfahrt beim Tag der Landwirtschaft in Schirradorf
teilgenommen.
Schirradorf.
In seinen Adern fließt kein Blut, in seinen Adern fließt Benzin:
Raimund Schramm (55) aus dem kleinen Örtchen Dankenfeld im
unterfränkischen Landkreis Haßberge. Zusammen mit Tochter Katharina
und Sohn Johannes hatte er am Sonntag bei der traditionellen
Oldtimerrundfahrt beim Tag der Landwirtschaft in Schirradorf
teilgenommen. .jpg) Die
große Oldtimerrundfahrt durch Schirradorf mit dem Firmengelände des
Landtechnikunternehmens Nicklas als Start und Ziel war einmal mehr
der Höhepunkt des Familiensonntags. 30 historische Traktoren waren
diesmal dabei, starke Abordnungen schickten unter anderem die
Bulldog-Freunde Rotmaintal, die Traktorfreunde Kirchleus-Lösau und
als stärkste Gruppe die Traktorfreunde Altenplos. Zu den ältesten
Fahrzeugen gehörte dem Organisator Friedbert Weiß vom
John-Deere-Fanclub zufolge ein Güldner GUN, mit dem Dieter Thein aus
Ruppach vorgefahren war. Die längst aufgelösten Güldner Motorenwerke
Aschaffenburg hatten den Schlepper 1950 gebaut.
Die
große Oldtimerrundfahrt durch Schirradorf mit dem Firmengelände des
Landtechnikunternehmens Nicklas als Start und Ziel war einmal mehr
der Höhepunkt des Familiensonntags. 30 historische Traktoren waren
diesmal dabei, starke Abordnungen schickten unter anderem die
Bulldog-Freunde Rotmaintal, die Traktorfreunde Kirchleus-Lösau und
als stärkste Gruppe die Traktorfreunde Altenplos. Zu den ältesten
Fahrzeugen gehörte dem Organisator Friedbert Weiß vom
John-Deere-Fanclub zufolge ein Güldner GUN, mit dem Dieter Thein aus
Ruppach vorgefahren war. Die längst aufgelösten Güldner Motorenwerke
Aschaffenburg hatten den Schlepper 1950 gebaut..jpg) Einen
besonderen Blickfang hatte Andreas Dormann aus Wüstenstein bei
Wiesentthal in der Fränkischen Schweiz mit diesem Mercedes 170 DA
OTP mitgebracht. Das 40 PS starke Fahrzeug wurde 1951 als
Polizeifahrzeug beim Bundesinnenministerium in Bann zugelassen und
befindet sich noch heute im Topzustand.
Einen
besonderen Blickfang hatte Andreas Dormann aus Wüstenstein bei
Wiesentthal in der Fränkischen Schweiz mit diesem Mercedes 170 DA
OTP mitgebracht. Das 40 PS starke Fahrzeug wurde 1951 als
Polizeifahrzeug beim Bundesinnenministerium in Bann zugelassen und
befindet sich noch heute im Topzustand. .jpg) Eingebettet
war die Vorführung in ein buntes Programm, das trotz tropischer
Temperaturen viele hundert Besucher auf das Betriebsgelände der
Firma Nicklas gelockt hatte. Da gab es Roulade und Schäuferla mit
Kloß und Kraut, Backwaren und Bauernhofeis. Hoher Besuch war mit dem
bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger schon am Freitag auf
dem Firmengelände. Nun startete der Familiensonntag mit einem
Gottesdienst, den der Posaunenchor Wonsees und der Landfrauenchor
Kulmbach feierlich umrahmten und den der evangelische Pfarrer Daniel
Städler aus Wonsees zelebriert hatte.
Eingebettet
war die Vorführung in ein buntes Programm, das trotz tropischer
Temperaturen viele hundert Besucher auf das Betriebsgelände der
Firma Nicklas gelockt hatte. Da gab es Roulade und Schäuferla mit
Kloß und Kraut, Backwaren und Bauernhofeis. Hoher Besuch war mit dem
bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger schon am Freitag auf
dem Firmengelände. Nun startete der Familiensonntag mit einem
Gottesdienst, den der Posaunenchor Wonsees und der Landfrauenchor
Kulmbach feierlich umrahmten und den der evangelische Pfarrer Daniel
Städler aus Wonsees zelebriert hatte..jpg)
 Pottenstein.
Artenschutz ist in aller Munde. Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit haben
die Bayerischen Staatsforsten schon im vergangenen Jahr damit begonnen,
entsprechende Blühflächen auf ihren Flächen anzulegen. „Wir haben
viereinhalb Hektar Blühflächen in allen unseren Revieren angelegt“, sagte
Gerhard Steininger, Servicestellenleiter des Forstbetriebs Pegnitz bei einem
Ortstermin mit der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer.
Pottenstein.
Artenschutz ist in aller Munde. Kaum bemerkt von der Öffentlichkeit haben
die Bayerischen Staatsforsten schon im vergangenen Jahr damit begonnen,
entsprechende Blühflächen auf ihren Flächen anzulegen. „Wir haben
viereinhalb Hektar Blühflächen in allen unseren Revieren angelegt“, sagte
Gerhard Steininger, Servicestellenleiter des Forstbetriebs Pegnitz bei einem
Ortstermin mit der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer..jpg) Schirradorf,
Lks. Kulmbach. Ein klares Bekenntnis zur bäuerlichen Landwirtschaft haben
sämtliche Redner beim Schirradorfer Bauerntag abgelegt. Allen voran Hubert
Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender
Ministerpräsident. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken und wir brauchen uns
auch nicht belehren lassen“, sagte Aiwanger in der großen Halle des
Landtechnikunternehmens Nicklas. Die Bauern seien die Garanten dafür, dass
dieses Land ernährt wird und dass es so schön erhalten wird, wie es ist. Diese
Leistung wollten die Bauern aber auch ehrlich anerkannt wissen.
Schirradorf,
Lks. Kulmbach. Ein klares Bekenntnis zur bäuerlichen Landwirtschaft haben
sämtliche Redner beim Schirradorfer Bauerntag abgelegt. Allen voran Hubert
Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender
Ministerpräsident. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken und wir brauchen uns
auch nicht belehren lassen“, sagte Aiwanger in der großen Halle des
Landtechnikunternehmens Nicklas. Die Bauern seien die Garanten dafür, dass
dieses Land ernährt wird und dass es so schön erhalten wird, wie es ist. Diese
Leistung wollten die Bauern aber auch ehrlich anerkannt wissen. .jpg) Vor
dem Hintergrund einer „gefährlichen Entfremdung der Bevölkerung von der
Landwirtschaft“ plädierte der Minister wieder für mehr gesunden
Menschenverstand. Freilich müsse alles seine Ordnung haben, doch gewisse
Spielräume seien immer möglich. Und deswegen werde er alles daran setzen, um zu
verhindern, dass die Landwirtschaft jetzt wieder in die Bredouille gebracht
wird.
Vor
dem Hintergrund einer „gefährlichen Entfremdung der Bevölkerung von der
Landwirtschaft“ plädierte der Minister wieder für mehr gesunden
Menschenverstand. Freilich müsse alles seine Ordnung haben, doch gewisse
Spielräume seien immer möglich. Und deswegen werde er alles daran setzen, um zu
verhindern, dass die Landwirtschaft jetzt wieder in die Bredouille gebracht
wird. .jpg) Über
Personal- und Fachkräftemangel klagte Edwin Nicklas, Chef des Schirradorfer
Landtechnikunternehmens. „Ich weiß nicht, wo die künftigen Handwerker herkommen
sollen“, sagte er und kritisierte die hohen Abitur- und Studienquoten. Kritisch
stufte Nicklas auch die Europäische Datenschutzgrundverordnung ein, die in
Deutschland gleich zu 200 Prozent umgesetzt worden sei. Ihm als typischen
mittelständischen Betrieb habe dies bereits eine fünfstellige Summe und viel,
viel Zeit gekostet.
Über
Personal- und Fachkräftemangel klagte Edwin Nicklas, Chef des Schirradorfer
Landtechnikunternehmens. „Ich weiß nicht, wo die künftigen Handwerker herkommen
sollen“, sagte er und kritisierte die hohen Abitur- und Studienquoten. Kritisch
stufte Nicklas auch die Europäische Datenschutzgrundverordnung ein, die in
Deutschland gleich zu 200 Prozent umgesetzt worden sei. Ihm als typischen
mittelständischen Betrieb habe dies bereits eine fünfstellige Summe und viel,
viel Zeit gekostet.%20Bayreuth.jpg) Bischofsgrün
„Wenn mal ein falscher Ton dabei ist, dann ist es halt so“. Die
Bayreuther Kreisbäuerin Angelika Seyferth bringt es auf den Punkt,
was das Singen im Landfrauenchor ausmacht: Singen in der
Gemeinschaft, Pflege von Tradition, Geselligkeit und Miteinander.
Auch das Bezirkschöretreffen zum 40. Geburtstag des Bayreuther
Landfrauenchors im Kurhaus von Bischofsgrün war kein Wettbewerb,
sondern eine Zusammenkunft von allen, die Freude an der Musik haben.
Bischofsgrün
„Wenn mal ein falscher Ton dabei ist, dann ist es halt so“. Die
Bayreuther Kreisbäuerin Angelika Seyferth bringt es auf den Punkt,
was das Singen im Landfrauenchor ausmacht: Singen in der
Gemeinschaft, Pflege von Tradition, Geselligkeit und Miteinander.
Auch das Bezirkschöretreffen zum 40. Geburtstag des Bayreuther
Landfrauenchors im Kurhaus von Bischofsgrün war kein Wettbewerb,
sondern eine Zusammenkunft von allen, die Freude an der Musik haben..jpg) Neben
dem Bayreuther Landfrauenchor unter der Leitung der engagierten
Kirchenmusikerin Martina Schill aus Creußen traten beim
Bezirkstreffen in Bischofsgrün die Chöre aus Hof, Coburg, Bamberg
und Lichtenfels aus. Letzterer ist noch älter als der Bayreuther
Chor und hat die Feier zum 40. Geburtstag bereits hinter sich. Hier
besteht sogar die Hälfte des Chores noch aus Gründungsmitgliedern.
30 Jahre jung wurde heuer der Coburger Chor, der in einer erneuerten
Coburger Tracht auftrat. Mit 13 Jahren ist der Bamberger Chor
relativ jung, dafür zählt er von der Mitgliederzahl her zu den
stärksten. Bleibt noch der Hofer Chor, der erst zwei Tage zuvor
ebenfalls sein 30-jähriges Bestehen gefeiert hatte. Die Liedauswahl
des Bezirkschöretreffens reichte von geistlichem Liedgut über
volkstümliche Weisen bis hin zu Schlagern und Pop-Songs.
Neben
dem Bayreuther Landfrauenchor unter der Leitung der engagierten
Kirchenmusikerin Martina Schill aus Creußen traten beim
Bezirkstreffen in Bischofsgrün die Chöre aus Hof, Coburg, Bamberg
und Lichtenfels aus. Letzterer ist noch älter als der Bayreuther
Chor und hat die Feier zum 40. Geburtstag bereits hinter sich. Hier
besteht sogar die Hälfte des Chores noch aus Gründungsmitgliedern.
30 Jahre jung wurde heuer der Coburger Chor, der in einer erneuerten
Coburger Tracht auftrat. Mit 13 Jahren ist der Bamberger Chor
relativ jung, dafür zählt er von der Mitgliederzahl her zu den
stärksten. Bleibt noch der Hofer Chor, der erst zwei Tage zuvor
ebenfalls sein 30-jähriges Bestehen gefeiert hatte. Die Liedauswahl
des Bezirkschöretreffens reichte von geistlichem Liedgut über
volkstümliche Weisen bis hin zu Schlagern und Pop-Songs.%20Coburg.jpg)
Lichtenfels.jpg)
%20Bamberg.jpg)
%20HOf.jpg)
.jpg) Hof.
Zum Tag der Milch hat der Bauernverband den traditionellen Wochenmarkt am Hofer
Maxplatz diesmal durch einen eigenen Milchmarkt bereichert. Zusammen mit der
neuen bayerischen Milchprinzessin Miriam Weiß aus Kempten und Käsesommelier
Markus Raupach aus Bamberg rührte die Vorstandschaft die Werbetrommel für Milch
und Käse sowie das breite Sortiment regionaler Molkereien.
Hof.
Zum Tag der Milch hat der Bauernverband den traditionellen Wochenmarkt am Hofer
Maxplatz diesmal durch einen eigenen Milchmarkt bereichert. Zusammen mit der
neuen bayerischen Milchprinzessin Miriam Weiß aus Kempten und Käsesommelier
Markus Raupach aus Bamberg rührte die Vorstandschaft die Werbetrommel für Milch
und Käse sowie das breite Sortiment regionaler Molkereien..jpg) Das
wusste auch der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner, der die Aktion des
Bauernverbandes nachdrücklich unterstützte. Freilich freue sich der Verbraucher
zunächst einmal über günstige Lebensmittelpreise. Doch Fichtner zeigte ich auch
überzeugt davon, dass viele Menschen bei besserer Kenntnis durchaus auch bereit
wären, mehr Geld für die hohe Qualität der Lebensmittel auszugeben. Fichtner
warb zugleich auch für den Hofer Wochenmarkt: „Wer hier kauft, der kann sicher
sein, dass die Produkte aus der Region kommen und nicht kreuz und quer durch
Europa gekarrt wurden.
Das
wusste auch der Hofer Oberbürgermeister Harald Fichtner, der die Aktion des
Bauernverbandes nachdrücklich unterstützte. Freilich freue sich der Verbraucher
zunächst einmal über günstige Lebensmittelpreise. Doch Fichtner zeigte ich auch
überzeugt davon, dass viele Menschen bei besserer Kenntnis durchaus auch bereit
wären, mehr Geld für die hohe Qualität der Lebensmittel auszugeben. Fichtner
warb zugleich auch für den Hofer Wochenmarkt: „Wer hier kauft, der kann sicher
sein, dass die Produkte aus der Region kommen und nicht kreuz und quer durch
Europa gekarrt wurden..jpg) Zusammen
mit Milchprinzessin Miriam Weiß bereitete der Käsesommelier zahlreiche
Variationen und Genusskombinationen zu, die von den Besuchern des Milchmarktes
gleich vor Ort verkostet werden konnten. Bürgermeister Fichtner, der Zweite
Bürgermeister Eberhard Siller und der Landtagsabgeordnete Alexander König, die
SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Eva Döhla und Kreishandwerksmeister
Christian Herpich hatten danach die Aufgabe leckere Brotzeitvariationen mit Käse
und heimischen Kräutern zuzubereiten und damit auf die verschiedenen Produkte
hinzuweisen, die aus regionaler Milch hergestellt werden.
Zusammen
mit Milchprinzessin Miriam Weiß bereitete der Käsesommelier zahlreiche
Variationen und Genusskombinationen zu, die von den Besuchern des Milchmarktes
gleich vor Ort verkostet werden konnten. Bürgermeister Fichtner, der Zweite
Bürgermeister Eberhard Siller und der Landtagsabgeordnete Alexander König, die
SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Eva Döhla und Kreishandwerksmeister
Christian Herpich hatten danach die Aufgabe leckere Brotzeitvariationen mit Käse
und heimischen Kräutern zuzubereiten und damit auf die verschiedenen Produkte
hinzuweisen, die aus regionaler Milch hergestellt werden..jpg) Büchenbach.
Es muss nicht immer Fleisch sein. Auch Fisch aus heimischen Gewässern kann
durchaus auch auf dem Grill landen. Dafür setzt sich seit Jahren die
Teichgenossenschaft Oberfranken ein. Mit Erfolg: Längst ziehen viele
Verbraucher Bachsaiblinge und Regenbogenforellen den sonst üblichen Steaks
und Bratwürsten vor. Um die heimische Fischvielfalt noch bekannter zu
machen, eröffnet die Teichgenossenschaft alljährlich werbewirksam die
Fischgrillsaison. Diesmal auf dem Vollerwerbsbetrieb von Karl-Heinz Herzing
in Büchenbach bei Pegnitz im Landkreis Bayreuth.
Büchenbach.
Es muss nicht immer Fleisch sein. Auch Fisch aus heimischen Gewässern kann
durchaus auch auf dem Grill landen. Dafür setzt sich seit Jahren die
Teichgenossenschaft Oberfranken ein. Mit Erfolg: Längst ziehen viele
Verbraucher Bachsaiblinge und Regenbogenforellen den sonst üblichen Steaks
und Bratwürsten vor. Um die heimische Fischvielfalt noch bekannter zu
machen, eröffnet die Teichgenossenschaft alljährlich werbewirksam die
Fischgrillsaison. Diesmal auf dem Vollerwerbsbetrieb von Karl-Heinz Herzing
in Büchenbach bei Pegnitz im Landkreis Bayreuth. .jpg) Das
war auch für Tim Pargent, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Bayreuth, ein
wichtiges Argument. Es könne nicht sein, dass beispielsweise Shrimps aus
großen Aquakulturen in den Skandinavischen Ländern nach Afrika zur
Weiterverarbeitung transportiert werden, um anschließende in unseren
Supermärkten zu landen. „Dabei haben wir doch alles, was wir brauchen“, so Pargent, der ganz besonders die Arbeit der Teichwirte für die Artenvielfalt
herausstellte.
Das
war auch für Tim Pargent, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Bayreuth, ein
wichtiges Argument. Es könne nicht sein, dass beispielsweise Shrimps aus
großen Aquakulturen in den Skandinavischen Ländern nach Afrika zur
Weiterverarbeitung transportiert werden, um anschließende in unseren
Supermärkten zu landen. „Dabei haben wir doch alles, was wir brauchen“, so Pargent, der ganz besonders die Arbeit der Teichwirte für die Artenvielfalt
herausstellte..jpg) Kulmbach.
Das Maß ist längst voll, das Ende der Fahnenstange ist erreicht, die Bauern
werden enteignet: Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber musste sich zum
Auftakt der bayernweiten Regionalkonferenzen zum Volksbegehren Artenschutz
in der Kulmbacher Stadthalle harsche Kritik von Seiten der Bauern anhören.
Kulmbach.
Das Maß ist längst voll, das Ende der Fahnenstange ist erreicht, die Bauern
werden enteignet: Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber musste sich zum
Auftakt der bayernweiten Regionalkonferenzen zum Volksbegehren Artenschutz
in der Kulmbacher Stadthalle harsche Kritik von Seiten der Bauern anhören..jpg) Viele
Redner äußerten aber auch schlicht und einfach ihre tiefen Sorgen und
Zukunftsängste. „Mir wird Angst um meinen Berufsstand“, so die Coburger
Kreisbäuerin Heidi Bauersachs. Vieler sind einfach nicht mehr bereit, nach
ihrer Ausbildung in diesem Beruf zu bleiben, so Wolfgang Schultheiß aus dem
Landkreis Coburg. Von einer klaren Enteignung sprach Peter Hofmann: „Von
Landwirten erschaffene Biotope werden unter Schutz gestellt, damit sind sie
nichts mehr wert.“
Viele
Redner äußerten aber auch schlicht und einfach ihre tiefen Sorgen und
Zukunftsängste. „Mir wird Angst um meinen Berufsstand“, so die Coburger
Kreisbäuerin Heidi Bauersachs. Vieler sind einfach nicht mehr bereit, nach
ihrer Ausbildung in diesem Beruf zu bleiben, so Wolfgang Schultheiß aus dem
Landkreis Coburg. Von einer klaren Enteignung sprach Peter Hofmann: „Von
Landwirten erschaffene Biotope werden unter Schutz gestellt, damit sind sie
nichts mehr wert.“.jpg) Viele
konkrete Beispiele der beabsichtigten Ausgestaltung erläuterte Kaniber den
Bauern. Etwa, dass die jeweiligen Bezirksregierungen spezifisch über das
Walzverbot von Grünland entscheiden und somit unterschiedliche Walzzeiten
ermöglichen sollen. Als machbar bezeichnete die Ministerin eine Reduzierung
bei Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent durch moderne Präzisionstechnik.
Auch was den Ökolandbau betrifft, soll niemand zu einer Umstellung gezwungen
werden. Die Zielvorgabe von 30 Prozent bis zum Jahr 2030, soll vielmehr „am
Markt entlang“ geschehen.
Viele
konkrete Beispiele der beabsichtigten Ausgestaltung erläuterte Kaniber den
Bauern. Etwa, dass die jeweiligen Bezirksregierungen spezifisch über das
Walzverbot von Grünland entscheiden und somit unterschiedliche Walzzeiten
ermöglichen sollen. Als machbar bezeichnete die Ministerin eine Reduzierung
bei Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent durch moderne Präzisionstechnik.
Auch was den Ökolandbau betrifft, soll niemand zu einer Umstellung gezwungen
werden. Die Zielvorgabe von 30 Prozent bis zum Jahr 2030, soll vielmehr „am
Markt entlang“ geschehen..jpg) Windischenhaig.
Landfrauen stehen für Dialog und gesunde Ernährung. Im Landkreis Kulmbach hat
sich der Bauernverband deshalb entschieden, die bayernweite Aktion „Frühstück
auf dem Bauernhof“ mit dem 70. Geburtstag der Landfrauenbewegung zu verbinden
und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Berufsstand auf dem Betrieb der
Familie Kaßel in Windischenhaig einzuladen.
Windischenhaig.
Landfrauen stehen für Dialog und gesunde Ernährung. Im Landkreis Kulmbach hat
sich der Bauernverband deshalb entschieden, die bayernweite Aktion „Frühstück
auf dem Bauernhof“ mit dem 70. Geburtstag der Landfrauenbewegung zu verbinden
und Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Berufsstand auf dem Betrieb der
Familie Kaßel in Windischenhaig einzuladen..jpg) Natürlich
gab es zum Frühstück auf dem Bauernhof ausnahmslos heimische Produkte. Die Damen
aus der Kreisvorstandschaft hatten unter anderem selbstgebackene Küchla, Wurst
Käse, Obatzn, Joghurt und sogar leckere Smoothies vorbereitet. Aber auch ernste
Worte waren zu hören. „Wir haben Angst um unsere landwirtschaftlichen Betriebe,
sagte Kreisbäuerin Beate Opel vor dem Hintergrund des erfolgreichen
Volksbegehrens zum Artenschutz. Wenn die Bürokratie weiter zunimmt, könne man
die Höfe bald zusperren. An den Berufsstand appellierte sie, noch enger
zusammenzurücken. „Sonst machen die da vorne mit uns, was sie wollen“, fand die
Kreisbäuerin deutliche Worte.
Natürlich
gab es zum Frühstück auf dem Bauernhof ausnahmslos heimische Produkte. Die Damen
aus der Kreisvorstandschaft hatten unter anderem selbstgebackene Küchla, Wurst
Käse, Obatzn, Joghurt und sogar leckere Smoothies vorbereitet. Aber auch ernste
Worte waren zu hören. „Wir haben Angst um unsere landwirtschaftlichen Betriebe,
sagte Kreisbäuerin Beate Opel vor dem Hintergrund des erfolgreichen
Volksbegehrens zum Artenschutz. Wenn die Bürokratie weiter zunimmt, könne man
die Höfe bald zusperren. An den Berufsstand appellierte sie, noch enger
zusammenzurücken. „Sonst machen die da vorne mit uns, was sie wollen“, fand die
Kreisbäuerin deutliche Worte. .jpg) Bei
den Vertretern aus der Politik ernteten die Verbandsvertreter ausnahmslos
Zustimmung. Die Landwirtschaft im Landkreis Kulmbach sei vorbildlich und schon
deshalb von den Regelungen des Volksbegehrens kaum betroffen, stellte
beispielsweise der Landtagsabgeordnete Martin Schöffel fest. Einzelne
Regelungen, wie etwa das Walzverbot zum Schutz von Bodenbrütern ab 15. März,
müssten freilich noch flexibel ausgestaltet werden.
Bei
den Vertretern aus der Politik ernteten die Verbandsvertreter ausnahmslos
Zustimmung. Die Landwirtschaft im Landkreis Kulmbach sei vorbildlich und schon
deshalb von den Regelungen des Volksbegehrens kaum betroffen, stellte
beispielsweise der Landtagsabgeordnete Martin Schöffel fest. Einzelne
Regelungen, wie etwa das Walzverbot zum Schutz von Bodenbrütern ab 15. März,
müssten freilich noch flexibel ausgestaltet werden. Schollenreuth.
Anfeindungen der Gesellschaft machen den Bauern derzeit schwer zu
schaffen. „Vor allem das Volksbegehren zum Artenschutz hat viele
Berufskollegen total verunsichert“, sagte der Hofer Kreisobmann
Hermann Klug bei einem Besuch von Regionalbischöfin Dorothea Greiner
auf dem Milchviehbetrieb von Bettina und Martin Riedel in
Schollenreuth bei Feilitzsch im Landkreis Hof.
Schollenreuth.
Anfeindungen der Gesellschaft machen den Bauern derzeit schwer zu
schaffen. „Vor allem das Volksbegehren zum Artenschutz hat viele
Berufskollegen total verunsichert“, sagte der Hofer Kreisobmann
Hermann Klug bei einem Besuch von Regionalbischöfin Dorothea Greiner
auf dem Milchviehbetrieb von Bettina und Martin Riedel in
Schollenreuth bei Feilitzsch im Landkreis Hof. .jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
 Hollfeld,
Lks. Bayreuth. Für Hollfeld war es eine echte Premiere: zur offiziellen
Standorteröffnung der neuen Claas-Niederlassung gab es hier erstmals einen
Bauerntag. Als prominenten Gast konnte der BBV den bayerischen
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gewinnen. In einer launigen Rede spannte er
einen weiten Bogen über eine Vielzahl landwirtschaftlich relevanter Themen und
zeigte sich dabei als engagierter Fürsprecher der Bauern.
Hollfeld,
Lks. Bayreuth. Für Hollfeld war es eine echte Premiere: zur offiziellen
Standorteröffnung der neuen Claas-Niederlassung gab es hier erstmals einen
Bauerntag. Als prominenten Gast konnte der BBV den bayerischen
Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger gewinnen. In einer launigen Rede spannte er
einen weiten Bogen über eine Vielzahl landwirtschaftlich relevanter Themen und
zeigte sich dabei als engagierter Fürsprecher der Bauern.  Stadtsteinach.
Die Trockenheit und der Käfer haben bei der Waldbesitzervereinigung
Kulmbach/Stadtsteinach im zurückliegenden Jahr für große Probleme gesorgt. „Der
Markt ist gekennzeichnet von einem Überangebot und vollen Sägewerken“, sagte
Geschäftsführer Theo Kaiser bei der Jahresversammlung in Stadtsteinach. Trotz
aller Probleme hat die WBV im zurückliegenden Jahr 47000 Festmeter Holz
vermarktet, deutlich mehr als im Jahr zuvor (35000 Festmeter).
Stadtsteinach.
Die Trockenheit und der Käfer haben bei der Waldbesitzervereinigung
Kulmbach/Stadtsteinach im zurückliegenden Jahr für große Probleme gesorgt. „Der
Markt ist gekennzeichnet von einem Überangebot und vollen Sägewerken“, sagte
Geschäftsführer Theo Kaiser bei der Jahresversammlung in Stadtsteinach. Trotz
aller Probleme hat die WBV im zurückliegenden Jahr 47000 Festmeter Holz
vermarktet, deutlich mehr als im Jahr zuvor (35000 Festmeter). Steinfeld.
Der Umbau des Waldes hin zu stabilen Mischbeständen schreitet voran. „Wir haben
das Problem erkannt und sind bereits gut vorangekommen“, sagte Urban Treutlein
vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium bei der Jahresversammlung der
Waldbesitzervereinigung Bamberg in Steinfeld. Seinen Worten zufolge ist der
Laubwaldanteil im Freistaat während der zurückliegenden 35 Jahre von 22 auf
mittlerweile 36 Prozent stetig angestiegen.
Steinfeld.
Der Umbau des Waldes hin zu stabilen Mischbeständen schreitet voran. „Wir haben
das Problem erkannt und sind bereits gut vorangekommen“, sagte Urban Treutlein
vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium bei der Jahresversammlung der
Waldbesitzervereinigung Bamberg in Steinfeld. Seinen Worten zufolge ist der
Laubwaldanteil im Freistaat während der zurückliegenden 35 Jahre von 22 auf
mittlerweile 36 Prozent stetig angestiegen. Bayreuth.
Georg Dumpert ist der neue Leiter des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten in Bayreuth. Der 62-jährige Forstdirektor
löst damit Ernst Heidrich ab, der seit November 2009 an der
Spitze der Behörde stand. Bei einer Feierstunde in der
Tierzuchtklause in Bayreuth verabschiedete Walter Christl,
Abteilungsleiter im Bayerischen Landwirtschaftsministerium, Heidrich
in den Ruhestand und führte Dumpert in sein neues Amt ein.
Bayreuth.
Georg Dumpert ist der neue Leiter des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten in Bayreuth. Der 62-jährige Forstdirektor
löst damit Ernst Heidrich ab, der seit November 2009 an der
Spitze der Behörde stand. Bei einer Feierstunde in der
Tierzuchtklause in Bayreuth verabschiedete Walter Christl,
Abteilungsleiter im Bayerischen Landwirtschaftsministerium, Heidrich
in den Ruhestand und führte Dumpert in sein neues Amt ein. Stammbach,
Lks. Hof. Es wird ernst in Sachen Süd-Ost-Link: Nachdem bis Mitte
März die Verfahrensunterlagen für die geplante
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ-Leitung)
öffentlich ausgelegen haben, sind nun bis zum 12. April Einwendungen
gegen die Planungen im Abschnitt C, das ist der Bereich zwischen Hof
und Schwandorf, möglich. „Die Planungen für die Trasse nehmen an
Fahrt auf, sagte Jürgen Becher, Vorsitzender der Bürgerinitiative
Ölschnitztal bei einer gemeinsamen Informationsveranstaltung
zusammen mit dem Bauernverband in Stammbach.
Stammbach,
Lks. Hof. Es wird ernst in Sachen Süd-Ost-Link: Nachdem bis Mitte
März die Verfahrensunterlagen für die geplante
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ-Leitung)
öffentlich ausgelegen haben, sind nun bis zum 12. April Einwendungen
gegen die Planungen im Abschnitt C, das ist der Bereich zwischen Hof
und Schwandorf, möglich. „Die Planungen für die Trasse nehmen an
Fahrt auf, sagte Jürgen Becher, Vorsitzender der Bürgerinitiative
Ölschnitztal bei einer gemeinsamen Informationsveranstaltung
zusammen mit dem Bauernverband in Stammbach. Hollfeld.
Auf ein in jeder Hinsicht schwieriges Holzjahr musste die
Waldbesitzervereinigung Hollfeld zurückblicken. Schuld daran war der trockene
Sommer 2018, der spätestens ab Anfang August zunehmend für Käferholz sorgte. Bei
der Jahresversammlung in der Hollfelder Stadthalle wurde zugleich der 50.
Geburtstag der Selbsthilfeeinrichtung gefeiert.
Hollfeld.
Auf ein in jeder Hinsicht schwieriges Holzjahr musste die
Waldbesitzervereinigung Hollfeld zurückblicken. Schuld daran war der trockene
Sommer 2018, der spätestens ab Anfang August zunehmend für Käferholz sorgte. Bei
der Jahresversammlung in der Hollfelder Stadthalle wurde zugleich der 50.
Geburtstag der Selbsthilfeeinrichtung gefeiert..jpg) Stadtsteinach.
Jungen Landwirten Mut zu machen, eigene Ideen zu verwirklichen. Das ist das Ziel
von Anne Körkel aus Kehl in Baden-Württemberg. Die 35-Jährige ist nicht nur
Agraringenieurin und praktizierende Bäuerin, sondern auch ausgezeichnete
Unternehmerin des Jahres 2017 und „Mutbotschafterin“. Beim Kulmbacher
Landfrauentag in Stadtsteinach hat sie ihre Berufskollegen dazu aufgerufen,
mutig in die Zukunft zu blicken. „Unsere Branche braucht Mut mehr denn je, denn
sie ist eine tolle Branche“, sagte sie.
Stadtsteinach.
Jungen Landwirten Mut zu machen, eigene Ideen zu verwirklichen. Das ist das Ziel
von Anne Körkel aus Kehl in Baden-Württemberg. Die 35-Jährige ist nicht nur
Agraringenieurin und praktizierende Bäuerin, sondern auch ausgezeichnete
Unternehmerin des Jahres 2017 und „Mutbotschafterin“. Beim Kulmbacher
Landfrauentag in Stadtsteinach hat sie ihre Berufskollegen dazu aufgerufen,
mutig in die Zukunft zu blicken. „Unsere Branche braucht Mut mehr denn je, denn
sie ist eine tolle Branche“, sagte sie..jpg) Der
Konsument von heute will jemand, dem er vertrauen kann, sagte Anne Körkel. Bei
ihr kauften die Verbraucher eben auch ein Stück Heimat, deshalb habe sie nie das
Ziel schneller, höher und weiter verfolgt, sondern konsequent auf Qualität
gesetzt. Das sei für den Erfolg unabdingbar, ebenso wie Öffentlichkeitsarbeit in
eigener Sache und vor allem auch in den neue Medien, also im Internet oder auf
Facebook. Die Bäuerin wusste auch, dass es viele ihrer Berufskollegen leid sein,
zu kämpfen. Anders aber würden sie aus dem Fadenkreuz, in das die Landwirtschaft
geraten ist, nicht mehr herauskommen. Oberste Gebote seien es, authentisch und
ehrlich zu bleiben und vor allem immer wieder zu erklären.
Der
Konsument von heute will jemand, dem er vertrauen kann, sagte Anne Körkel. Bei
ihr kauften die Verbraucher eben auch ein Stück Heimat, deshalb habe sie nie das
Ziel schneller, höher und weiter verfolgt, sondern konsequent auf Qualität
gesetzt. Das sei für den Erfolg unabdingbar, ebenso wie Öffentlichkeitsarbeit in
eigener Sache und vor allem auch in den neue Medien, also im Internet oder auf
Facebook. Die Bäuerin wusste auch, dass es viele ihrer Berufskollegen leid sein,
zu kämpfen. Anders aber würden sie aus dem Fadenkreuz, in das die Landwirtschaft
geraten ist, nicht mehr herauskommen. Oberste Gebote seien es, authentisch und
ehrlich zu bleiben und vor allem immer wieder zu erklären. .jpg) Köditz,
Lks. Hof. Mit einer Mischung aus Trauer und Empörung haben einige
Sprecher beim Hofer Landfrauentag auf den Ausgang des Volksbegehrens
Artenschutz reagiert. „Das Volksbegehren hat uns völlig erschlagen“,
sagte Kreisbäuerin Karin Wolfrum und Landesbäuerin Anneliese Göller
stellte fest: „Wir haben so viel für den Artenschutz gemacht, aber
es wird einfach nicht gesehen.
Köditz,
Lks. Hof. Mit einer Mischung aus Trauer und Empörung haben einige
Sprecher beim Hofer Landfrauentag auf den Ausgang des Volksbegehrens
Artenschutz reagiert. „Das Volksbegehren hat uns völlig erschlagen“,
sagte Kreisbäuerin Karin Wolfrum und Landesbäuerin Anneliese Göller
stellte fest: „Wir haben so viel für den Artenschutz gemacht, aber
es wird einfach nicht gesehen..jpg) Zuvor
hatte Karin Wolfrum den Berufsstand als vielseitig, innovativ und
bestens ausgebildet beschrieben. „Wir begleiten die Natur,
unterstützen und pflegen sie“, sagte die Kreisbäuerin. Die Landwirte
müssten aber auch davon leben können. Immerhin würden im Landkreis
Hof 50 Prozent der Familienbetriebe noch im Haupterwerb geführt.
Hier würden Lebensmittel in bester Qualität erzeugt, leider meist
nicht zum angemessenen Preis.
Zuvor
hatte Karin Wolfrum den Berufsstand als vielseitig, innovativ und
bestens ausgebildet beschrieben. „Wir begleiten die Natur,
unterstützen und pflegen sie“, sagte die Kreisbäuerin. Die Landwirte
müssten aber auch davon leben können. Immerhin würden im Landkreis
Hof 50 Prozent der Familienbetriebe noch im Haupterwerb geführt.
Hier würden Lebensmittel in bester Qualität erzeugt, leider meist
nicht zum angemessenen Preis..jpg) Traditionell
stellten sich beim Hofer Landfrauentag in der Köditzer Göstrahalle
auch einige Persönlichkeiten den Zuhörerinnen vor. Dr. Henning Wendt
beispielsweise, der aus Niedersachsen stammende neue Geschäftsführer
und Stationstierarzt der Besamungsstation Wölsau bei Marktredwitz.
Simone Baumann, gelernte Hauswirtschafterin aus Geroldsgrün im
Landkreis Hof ist die neue Dorfhelferin des Maschinenrings
Münchberg. Susanne Taubald ist ebenfalls beim Maschinenring
Münchberg die neue Organisationskraft und der erst 25-jährige
Patrick Heerdegen aus Marktschorgast im Landkreis Kulmbach der neue
Geschäftsführer.
Traditionell
stellten sich beim Hofer Landfrauentag in der Köditzer Göstrahalle
auch einige Persönlichkeiten den Zuhörerinnen vor. Dr. Henning Wendt
beispielsweise, der aus Niedersachsen stammende neue Geschäftsführer
und Stationstierarzt der Besamungsstation Wölsau bei Marktredwitz.
Simone Baumann, gelernte Hauswirtschafterin aus Geroldsgrün im
Landkreis Hof ist die neue Dorfhelferin des Maschinenrings
Münchberg. Susanne Taubald ist ebenfalls beim Maschinenring
Münchberg die neue Organisationskraft und der erst 25-jährige
Patrick Heerdegen aus Marktschorgast im Landkreis Kulmbach der neue
Geschäftsführer. Bayreuth.
Die Sicherung von Arbeitsplätzen und eine stärkere Wertschöpfung vor Ort,
das sind zwei der wichtigsten Ziele bayerischer Landwirtschaftspolitik.
Anton Dippold, Leiter des Referats Bayerische Agrarpolitik im
Landwirtschaftsministerium, hat diese Ziele den Besuchern des Bayreuther
Bauerntags in der Tierzuchtklause vorgestellt. Bittner war dabei für den
dienstlich kurzfristig verhinderten Amtschef des Landwirtschaftsministeriums
Hubert Bittlmayer eingesprungen. Das Thema „Was kommt auf die Landwirte zu?“
ist allerdings das gleiche geblieben und es hätte nicht aktueller sein
können, so Kreisobmann Karl Lappe.
Bayreuth.
Die Sicherung von Arbeitsplätzen und eine stärkere Wertschöpfung vor Ort,
das sind zwei der wichtigsten Ziele bayerischer Landwirtschaftspolitik.
Anton Dippold, Leiter des Referats Bayerische Agrarpolitik im
Landwirtschaftsministerium, hat diese Ziele den Besuchern des Bayreuther
Bauerntags in der Tierzuchtklause vorgestellt. Bittner war dabei für den
dienstlich kurzfristig verhinderten Amtschef des Landwirtschaftsministeriums
Hubert Bittlmayer eingesprungen. Das Thema „Was kommt auf die Landwirte zu?“
ist allerdings das gleiche geblieben und es hätte nicht aktueller sein
können, so Kreisobmann Karl Lappe. .jpg) Bayreuth.
17 frischgebackene Landwirtschaftsmeister aus ganz Oberfranken haben bei einem
Festakt in Bayreuth ihren Meisterbrief bekommen. Glückwünsche gingen dabei auch
an die sieben Meisterinnen der Hauswirtschaft, die ihren Brief bereits bei
anderer Gelegenheit erhalten hatten.
Bayreuth.
17 frischgebackene Landwirtschaftsmeister aus ganz Oberfranken haben bei einem
Festakt in Bayreuth ihren Meisterbrief bekommen. Glückwünsche gingen dabei auch
an die sieben Meisterinnen der Hauswirtschaft, die ihren Brief bereits bei
anderer Gelegenheit erhalten hatten..jpg) Mit
einem Stipendium des Bayerischen Bauernverbandes wurden für ihre herausragenden
Leistungen die beiden Brüder Daniel Paschold und Christoph Paschold aus
Untersiemau ausgezeichnet. Das Stipendium überreichte Landesbäuerin Anneliese
Göller. Außerdem wurden die folgenden vier Ausbilder ausgezeichnet, die zwischen
15 und 25 Lehrlinge auf ihren Betrieben ausgebildet hatten: Horst Reichel aus
Kirchenlamitz, Edgar Böhmer aus Rattelsdorf, Hans Popp aus Weismain und Jörg
Deinlein aus Scheßlitz.
Mit
einem Stipendium des Bayerischen Bauernverbandes wurden für ihre herausragenden
Leistungen die beiden Brüder Daniel Paschold und Christoph Paschold aus
Untersiemau ausgezeichnet. Das Stipendium überreichte Landesbäuerin Anneliese
Göller. Außerdem wurden die folgenden vier Ausbilder ausgezeichnet, die zwischen
15 und 25 Lehrlinge auf ihren Betrieben ausgebildet hatten: Horst Reichel aus
Kirchenlamitz, Edgar Böhmer aus Rattelsdorf, Hans Popp aus Weismain und Jörg
Deinlein aus Scheßlitz. Kulmbach.
Die Schäden durch Schwarzwild im Landkreis Kulmbach werden einer aktuellen
Erhebung zufolge auf weit über 300000 Euro beziffert. Diese Zahl hat
Burkhard Hartmann (Lindau), Kreisvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
Jagdgenossenschaften im Bauernverband, genannt. Bei der Jahresversammlung in
Kulmbach sprach Hartmann von exakt 1753 Wildschweinen, die im Jagdjahr
2017/2018 erlegt worden seien. Das sei fast ein Drittel mehr als im
vergleichbaren Jahreszeitraum des Vorjahres.
Kulmbach.
Die Schäden durch Schwarzwild im Landkreis Kulmbach werden einer aktuellen
Erhebung zufolge auf weit über 300000 Euro beziffert. Diese Zahl hat
Burkhard Hartmann (Lindau), Kreisvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
Jagdgenossenschaften im Bauernverband, genannt. Bei der Jahresversammlung in
Kulmbach sprach Hartmann von exakt 1753 Wildschweinen, die im Jagdjahr
2017/2018 erlegt worden seien. Das sei fast ein Drittel mehr als im
vergleichbaren Jahreszeitraum des Vorjahres..jpg) Scheßlitz,
Lks. Bamberg. Dieser Gegensatz ist mit vernünftigen Argumenten nicht
zu erklären: Das Interesse an den Landwirten ist deutlich gestiegen,
sie werden als zweitwichtigste Berufsgruppe überhaupt wahrgenommen,
der Landwirt ist also positiv besetzt. Und trotzdem: Das „System
Landwirtschaft“ wird deutlich kritischer beurteilt, es wird nicht
verstanden und die meisten Menschen haben keinen Kontakt mehr dazu.
Scheßlitz,
Lks. Bamberg. Dieser Gegensatz ist mit vernünftigen Argumenten nicht
zu erklären: Das Interesse an den Landwirten ist deutlich gestiegen,
sie werden als zweitwichtigste Berufsgruppe überhaupt wahrgenommen,
der Landwirt ist also positiv besetzt. Und trotzdem: Das „System
Landwirtschaft“ wird deutlich kritischer beurteilt, es wird nicht
verstanden und die meisten Menschen haben keinen Kontakt mehr dazu. .jpg) Mit
der Ehrung von Leo Göller aus Hirschaid gab es beim Scheßlitzer
Bauerntag aber doch auch einen Lichtblick. Göller hatte beim
Wettbewerb „Bayern blüht auf“ auf Landesebene den dritten Platz
erzielt und bekam dafür aus den Händen von Landesbäuerin Anneliese
Göller und von Oberfrankens BBV-Präsident Herman Greif eine Urkunde.
„ Solche engagierte Blühbotschafter brauchen wir“, sagte die
Landebäuerin.
Mit
der Ehrung von Leo Göller aus Hirschaid gab es beim Scheßlitzer
Bauerntag aber doch auch einen Lichtblick. Göller hatte beim
Wettbewerb „Bayern blüht auf“ auf Landesebene den dritten Platz
erzielt und bekam dafür aus den Händen von Landesbäuerin Anneliese
Göller und von Oberfrankens BBV-Präsident Herman Greif eine Urkunde.
„ Solche engagierte Blühbotschafter brauchen wir“, sagte die
Landebäuerin..jpg) Bayreuth.
Nein, nicht Konrad Adenauer ist der Kanzler der Wiedervereinigung,
sondern Helmut Kohl. Die Mauer ist auch nicht 1990 gefallen, sondern
bereits 1989. „Beim Allgemeinwissen könnte man sich grundsätzlich
noch verbessern“, sagte Hauswirtschafterin Sabine Raupach von der
Berufsschule III in Bayreuth. Sie gehörte zum Prüfungsteam im Land-
und Hauswirtschaftlichen Berufswettbewerb der Landjugend, bei dem
diesmal rekordverdächtige 53 angehende Landwirte und zehn angehende
Hauswirtschafterinnen teilgenommen hatten.
Bayreuth.
Nein, nicht Konrad Adenauer ist der Kanzler der Wiedervereinigung,
sondern Helmut Kohl. Die Mauer ist auch nicht 1990 gefallen, sondern
bereits 1989. „Beim Allgemeinwissen könnte man sich grundsätzlich
noch verbessern“, sagte Hauswirtschafterin Sabine Raupach von der
Berufsschule III in Bayreuth. Sie gehörte zum Prüfungsteam im Land-
und Hauswirtschaftlichen Berufswettbewerb der Landjugend, bei dem
diesmal rekordverdächtige 53 angehende Landwirte und zehn angehende
Hauswirtschafterinnen teilgenommen hatten..jpg) Unterm
Strich habe der Leistungswettbewerb der Landjugend auf Kreisebene
aber beeindruckende Ergebnisse gebracht und den hohen
Ausbildungsstand der jungen Leute eindrucksvoll unter Beweis
gestellt, sagte BBV-Kreisobmann Karl Lappe, Die angehenden Landwirte
und Hauswirtschafterinnen rief er auf, den Berufsstand selbstbewusst
nach außen zu vertreten. Es gebe allen Grund dazu.
Unterm
Strich habe der Leistungswettbewerb der Landjugend auf Kreisebene
aber beeindruckende Ergebnisse gebracht und den hohen
Ausbildungsstand der jungen Leute eindrucksvoll unter Beweis
gestellt, sagte BBV-Kreisobmann Karl Lappe, Die angehenden Landwirte
und Hauswirtschafterinnen rief er auf, den Berufsstand selbstbewusst
nach außen zu vertreten. Es gebe allen Grund dazu._01.jpg) Bayreuth.
Zu mehr Gelassenheit hat Schwester Teresa Zukic die Bayreuther
Landfrauen aufgerufen. Bei ihrem Auftritt beim Bayreuther
Landfrauentag in der Tierzuchtklause rief die TV-bekannte
Ordensschwester von der Kleinen Kommunität der Geschwister Jesu aus
Weisendorf bei Erlangen dazu auf, mehr zu lachen, jeden Tag
bewusster zu genießen und vor allem sich selbst stets treu zu
bleiben.
Bayreuth.
Zu mehr Gelassenheit hat Schwester Teresa Zukic die Bayreuther
Landfrauen aufgerufen. Bei ihrem Auftritt beim Bayreuther
Landfrauentag in der Tierzuchtklause rief die TV-bekannte
Ordensschwester von der Kleinen Kommunität der Geschwister Jesu aus
Weisendorf bei Erlangen dazu auf, mehr zu lachen, jeden Tag
bewusster zu genießen und vor allem sich selbst stets treu zu
bleiben._01.jpg) Jeder
habe seinen Anteil am Insektensterben, so die Bundestagsabgeordnete
Dr. Silke Launert. Sie ging auch auf das Jahresthema der Landfrauen
„Im Dialog bleiben“ ein. Der Dialog sei gefragt: In der
Partnerschaft, in der Familie, zwischen den Generationen, in der
Nachbarschaft, vor Ort im Dorf genauso wie in der Gesellschaft
insgesamt. „Im Dialog zu bleiben, ist keine Einbahnstraße, sondern
bedeutet zuhören und aufeinander eingehen.
Jeder
habe seinen Anteil am Insektensterben, so die Bundestagsabgeordnete
Dr. Silke Launert. Sie ging auch auf das Jahresthema der Landfrauen
„Im Dialog bleiben“ ein. Der Dialog sei gefragt: In der
Partnerschaft, in der Familie, zwischen den Generationen, in der
Nachbarschaft, vor Ort im Dorf genauso wie in der Gesellschaft
insgesamt. „Im Dialog zu bleiben, ist keine Einbahnstraße, sondern
bedeutet zuhören und aufeinander eingehen. Himmelkron.
Während die oberfränkischen Teichwirte die Kormoran- und
Graureiher-Problematik einigermaßen im Griff haben, werden die Schäden durch
Fischotter immer schlimmer. Bei der Mitgliederversammlung der
Teichgenossenschaft Oberfranken in Himmelkron sprach der Vorsitzende Dr.
Peter Thoma aus Thiersheim von einem „Riesendrama“.
Himmelkron.
Während die oberfränkischen Teichwirte die Kormoran- und
Graureiher-Problematik einigermaßen im Griff haben, werden die Schäden durch
Fischotter immer schlimmer. Bei der Mitgliederversammlung der
Teichgenossenschaft Oberfranken in Himmelkron sprach der Vorsitzende Dr.
Peter Thoma aus Thiersheim von einem „Riesendrama“. Kleinlosnitz.
Allen derzeitigen Widrigkeiten zum Trotz: die Bedeutung und die
Verantwortung der Landwirtschaft als globaler Ernährer werden in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten noch deutlich zunehmen. Diese Auffassung
vertritt Otto Körner, Leiter der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in
Triesdorf. Beim Lichtmessempfang des BBV Hof im Oberfränkischen
Bauernhofmuseum Kleinlosnitz wagte er einen Blick weit voraus bis in das
Jahr 2050 gestützt auf Statistiken, Zahlen und Tabellen, an deren Ende eine
wichtige Erkenntnis stand: „Wir können die Ernährung 2050 nur dann
sicherstellen, wenn wir die Produktion steigern, Ackerbauflächen und
Anbauerträge verdoppeln sowie Nahrungs- und Verarbeitungsverluste
reduzieren“.
Kleinlosnitz.
Allen derzeitigen Widrigkeiten zum Trotz: die Bedeutung und die
Verantwortung der Landwirtschaft als globaler Ernährer werden in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten noch deutlich zunehmen. Diese Auffassung
vertritt Otto Körner, Leiter der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in
Triesdorf. Beim Lichtmessempfang des BBV Hof im Oberfränkischen
Bauernhofmuseum Kleinlosnitz wagte er einen Blick weit voraus bis in das
Jahr 2050 gestützt auf Statistiken, Zahlen und Tabellen, an deren Ende eine
wichtige Erkenntnis stand: „Wir können die Ernährung 2050 nur dann
sicherstellen, wenn wir die Produktion steigern, Ackerbauflächen und
Anbauerträge verdoppeln sowie Nahrungs- und Verarbeitungsverluste
reduzieren“. Bayreuth.
Die Bewerbung für eine Öko-Modellregion Fränkische Schweiz (ÖMR) ist auf den
Weg gebracht. Bei einem Treffen von Vertretern der ÖMR-Lenkungsgruppe und
der Landwirtschaft in Bayreuth haben sich alle beteiligten Akteure unter der
Federführung der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer zuversichtlich
gezeigt, dass die Region genügend Alleinstellungsmerkmale besitzt, um als
Öko-Modellregion anerkannt zu werden.
Bayreuth.
Die Bewerbung für eine Öko-Modellregion Fränkische Schweiz (ÖMR) ist auf den
Weg gebracht. Bei einem Treffen von Vertretern der ÖMR-Lenkungsgruppe und
der Landwirtschaft in Bayreuth haben sich alle beteiligten Akteure unter der
Federführung der Landtagsabgeordneten Gudrun Brendel-Fischer zuversichtlich
gezeigt, dass die Region genügend Alleinstellungsmerkmale besitzt, um als
Öko-Modellregion anerkannt zu werden.  Mannsflur.
Erst wurde gegen den Neubau eines Hühnerstalles protestiert, demonstriert und
sogar geklagt, jetzt, knapp drei Jahre später, kommen einige der früheren Gegner
und kaufen die Bio-Eier selbst. „Manche der ehemaligen Demonstranten haben sich
sogar entschuldigt“, sagt Landwirt Stephan Haas aus Mannsflur. „Solche Gesten
sind schön, das baut einen auf“, so der 43-Jährige.
Mannsflur.
Erst wurde gegen den Neubau eines Hühnerstalles protestiert, demonstriert und
sogar geklagt, jetzt, knapp drei Jahre später, kommen einige der früheren Gegner
und kaufen die Bio-Eier selbst. „Manche der ehemaligen Demonstranten haben sich
sogar entschuldigt“, sagt Landwirt Stephan Haas aus Mannsflur. „Solche Gesten
sind schön, das baut einen auf“, so der 43-Jährige. .jpg) Pegnitz.
Dialoge sind heute weitgehend ins Digitale verlagert, echte
Zwiegespräche bleiben auf der Strecke. Das hat Josef Epp,
Klinikseelsorger und Religionslehrer aus dem Allgäu beim Pegnitzer
Landfrauentag am Dienstagnachmittag im ASV-Sportheim bedauert. Er
rief dazu auf, wieder zu echter Kommunikation zurückzukehren, denn
„wir brauchen den Dialog, wenn es um unsere Zukunft geht“.
Pegnitz.
Dialoge sind heute weitgehend ins Digitale verlagert, echte
Zwiegespräche bleiben auf der Strecke. Das hat Josef Epp,
Klinikseelsorger und Religionslehrer aus dem Allgäu beim Pegnitzer
Landfrauentag am Dienstagnachmittag im ASV-Sportheim bedauert. Er
rief dazu auf, wieder zu echter Kommunikation zurückzukehren, denn
„wir brauchen den Dialog, wenn es um unsere Zukunft geht“..jpg) Doch
wer keinen Dialog mehr führt, der verweigere sich auch dem sozialen
Umfeld. Gerade auf den Dörfern mache sich dies schon bemerkbar, wenn
beispielsweise Vereine keine Vorstände mehr finden. „Jeder macht
sein Ding, das Miteinander bleibt auf der Strecke.“ Josef Epp rief
deshalb dazu auf, wieder zum Dialog zurückzukehren, eigene
Positionen zu vertreten, aber nicht ohne dem Gegenüber offen,
aufmerksam und mit entsprechender Wertschätzung zu begegnen. Dialog
benötige Zeit, Dialog benötige Humor, dann könnte nicht nur wieder
ein Miteinander der Generationen möglich sein, sondern auch ein
Konsens bei wichtigen Fragen innerhalb der Gesellschaft.
Doch
wer keinen Dialog mehr führt, der verweigere sich auch dem sozialen
Umfeld. Gerade auf den Dörfern mache sich dies schon bemerkbar, wenn
beispielsweise Vereine keine Vorstände mehr finden. „Jeder macht
sein Ding, das Miteinander bleibt auf der Strecke.“ Josef Epp rief
deshalb dazu auf, wieder zum Dialog zurückzukehren, eigene
Positionen zu vertreten, aber nicht ohne dem Gegenüber offen,
aufmerksam und mit entsprechender Wertschätzung zu begegnen. Dialog
benötige Zeit, Dialog benötige Humor, dann könnte nicht nur wieder
ein Miteinander der Generationen möglich sein, sondern auch ein
Konsens bei wichtigen Fragen innerhalb der Gesellschaft. Scheßlitz,
Lks. Bamberg. „Holz ist in, auf den Zug sollten wir aufspringen.“ Eva Kaube
von Pro-Holz-Bayern bringt es auf den Punkt, was die Waldbauern derzeit
antreibt. Sie wollen darauf aufmerksam machen, wie bedeutsam die
Waldbewirtschaftung ist. Im Scheßlitzer Stadtwald im Landkreis Bamberg
geschieht dies mit einer großformatigen Tafel entlang eines beliebten
Wanderweges. „In wenigen Worten wollen wir hier den Menschen klar machen,
dass Holznutzung eine gute Tat für den Wald ist“, so Forstdirektor Michael
Kreppel vom Amt für Landwirtschaft in Bamberg.
Scheßlitz,
Lks. Bamberg. „Holz ist in, auf den Zug sollten wir aufspringen.“ Eva Kaube
von Pro-Holz-Bayern bringt es auf den Punkt, was die Waldbauern derzeit
antreibt. Sie wollen darauf aufmerksam machen, wie bedeutsam die
Waldbewirtschaftung ist. Im Scheßlitzer Stadtwald im Landkreis Bamberg
geschieht dies mit einer großformatigen Tafel entlang eines beliebten
Wanderweges. „In wenigen Worten wollen wir hier den Menschen klar machen,
dass Holznutzung eine gute Tat für den Wald ist“, so Forstdirektor Michael
Kreppel vom Amt für Landwirtschaft in Bamberg..jpg) Kulmbach.
Bei der Braugerste war Oberfranken im zurückliegenden Jahr zweigeteilt: Während
in den Landkreisen Hof und Wunsiedel sowie im Kulmbacher Oberland eine fast
normale Ernte mit ausgezeichneter Qualität eingefahren werden konnte, haben die
Bauern im südlichen und westlichen Oberfranken massive Ernteverluste zu
beklagen. „Je nach Boden und Niederschlag liegt das Minus bei 30 bis 50
Prozent“, sagte Vorsitzender Hans Pezold (Marktleugast) vom oberfränkischen
Braugerstenverein. Bei der Braugerstenschau im Kulmbacher Mönchshof war der
trockene Sommer diesmal das alles beherrschende Thema.
Kulmbach.
Bei der Braugerste war Oberfranken im zurückliegenden Jahr zweigeteilt: Während
in den Landkreisen Hof und Wunsiedel sowie im Kulmbacher Oberland eine fast
normale Ernte mit ausgezeichneter Qualität eingefahren werden konnte, haben die
Bauern im südlichen und westlichen Oberfranken massive Ernteverluste zu
beklagen. „Je nach Boden und Niederschlag liegt das Minus bei 30 bis 50
Prozent“, sagte Vorsitzender Hans Pezold (Marktleugast) vom oberfränkischen
Braugerstenverein. Bei der Braugerstenschau im Kulmbacher Mönchshof war der
trockene Sommer diesmal das alles beherrschende Thema. .jpg) Aktuelle
Zahlen zur Trockenheit hatte Friedrich Ernst vom Fachzentrum Pflanzenbau beim
Amt für Landwirtschaft in Bayreuth im Gepäck. Insgesamt hätten zwischen Mai und
Juli mindestens 50, je nach Standorten auch über 70 Prozent Niederschlag des
langjährigen Durchschnitts gefehlt. Die Gerste habe sich deshalb in ihren
Hauptanbaugebieten, also in den Mittelgebirgslagen und im Jura, nur schwach
entwickeln können. Wenn der Ertrag deshalb auch meist knapp gewesen sei, so
konnte Friedrich Ernst dennoch von einer „oft zufriedenstellenden Qualität“
sprechen.
Aktuelle
Zahlen zur Trockenheit hatte Friedrich Ernst vom Fachzentrum Pflanzenbau beim
Amt für Landwirtschaft in Bayreuth im Gepäck. Insgesamt hätten zwischen Mai und
Juli mindestens 50, je nach Standorten auch über 70 Prozent Niederschlag des
langjährigen Durchschnitts gefehlt. Die Gerste habe sich deshalb in ihren
Hauptanbaugebieten, also in den Mittelgebirgslagen und im Jura, nur schwach
entwickeln können. Wenn der Ertrag deshalb auch meist knapp gewesen sei, so
konnte Friedrich Ernst dennoch von einer „oft zufriedenstellenden Qualität“
sprechen..jpg) Bei
den Braugerstenmustern lag die Sorte „Solist“ mit 66 Prozent mit deutlichem
Vorsprung vor „Catameran“ (13 Prozent) und „Avalon“ (11 Prozent) an der Spitze.
Am Anteil stark abgenommen habe die Sorte „RGT Planet“ (von 13 auf 6 Prozent).
Andere Sorten wie zum Beispiel „Grace“ (2,5 Prozent) oder „Laureate“ (unter 1
Prozent) hätten nur noch einen sehr geringen Anteil gehabt.
Bei
den Braugerstenmustern lag die Sorte „Solist“ mit 66 Prozent mit deutlichem
Vorsprung vor „Catameran“ (13 Prozent) und „Avalon“ (11 Prozent) an der Spitze.
Am Anteil stark abgenommen habe die Sorte „RGT Planet“ (von 13 auf 6 Prozent).
Andere Sorten wie zum Beispiel „Grace“ (2,5 Prozent) oder „Laureate“ (unter 1
Prozent) hätten nur noch einen sehr geringen Anteil gehabt..jpg) Neuenmarkt,
Lks. Kulmbach. Super Stimmung, eine perfekte Location und jede Menge
sexy Mädels: nicht nur der Jungbauernkalender ist längst Kult, auch
die dazugehörige „Kalendergirl-Party“. Diesmal fand sie im Deutschen
Dampflokomotivmuseum (DDM) im Neuenmarkt statt. Rund 1500
Landjugendliche aus ganz Bayern fanden den Weg nach Oberfranken.
Neuenmarkt,
Lks. Kulmbach. Super Stimmung, eine perfekte Location und jede Menge
sexy Mädels: nicht nur der Jungbauernkalender ist längst Kult, auch
die dazugehörige „Kalendergirl-Party“. Diesmal fand sie im Deutschen
Dampflokomotivmuseum (DDM) im Neuenmarkt statt. Rund 1500
Landjugendliche aus ganz Bayern fanden den Weg nach Oberfranken..jpg) Beim
Landjugend Bezirksverband Oberfranken freute man sich besonders,
dass es die Kalendergirlparty als erste ehrenamtliche
Großveranstaltung in dieser Dimension ins DDM geschafft hatte. „Wir
möchten nicht nur den Kalender feiern und die Models präsentieren,
sondern auch eine Lanze für die Landwirtschaft brechen“, sagte
Bezirksvorsitzender Max Raimund von der Landjugend Schreez.
Beim
Landjugend Bezirksverband Oberfranken freute man sich besonders,
dass es die Kalendergirlparty als erste ehrenamtliche
Großveranstaltung in dieser Dimension ins DDM geschafft hatte. „Wir
möchten nicht nur den Kalender feiern und die Models präsentieren,
sondern auch eine Lanze für die Landwirtschaft brechen“, sagte
Bezirksvorsitzender Max Raimund von der Landjugend Schreez. .jpg) Am
Rande stellt der Landjugend-Bezirksverband erstmals seine neue
Landjugend-App vor. Sie soll ein ganz neues Werkzeug der
Jugendarbeit sein, alle Ortsgruppen in Bayern vernetzen und noch im
Herbst allen Usern zur Verfügung gestellt werden, so Michael
Kießling vom Arbeitskreis Jugend- und Gesellschaftspolitik. Allein
in Oberfranken gibt es 35 Ortsgruppen.
Am
Rande stellt der Landjugend-Bezirksverband erstmals seine neue
Landjugend-App vor. Sie soll ein ganz neues Werkzeug der
Jugendarbeit sein, alle Ortsgruppen in Bayern vernetzen und noch im
Herbst allen Usern zur Verfügung gestellt werden, so Michael
Kießling vom Arbeitskreis Jugend- und Gesellschaftspolitik. Allein
in Oberfranken gibt es 35 Ortsgruppen. .jpg) Bilder:
Bilder:.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg) Selb.
Verantwortung, Erfahrung und eine gute Ausbildung: darauf sollten die Bäuerinnen
und Bauern setzen, um die Zukunft zu meistern. „Sie wissen seit Generationen,
wie es geht, da brauchen sie das Feld nicht selbsternannten Experten
überlassen“, sagte der Wunsiedler Landtagsabgeordnete Martin Schöffel bei der
Bezirksversammlung der beiden Verbände für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF)
sowie für landwirtschaftliche Meister und Ausbilder (VLM) in Selb zu den
Vertretern der einzelnen Kreisverbände.
Selb.
Verantwortung, Erfahrung und eine gute Ausbildung: darauf sollten die Bäuerinnen
und Bauern setzen, um die Zukunft zu meistern. „Sie wissen seit Generationen,
wie es geht, da brauchen sie das Feld nicht selbsternannten Experten
überlassen“, sagte der Wunsiedler Landtagsabgeordnete Martin Schöffel bei der
Bezirksversammlung der beiden Verbände für landwirtschaftliche Fachbildung (VLF)
sowie für landwirtschaftliche Meister und Ausbilder (VLM) in Selb zu den
Vertretern der einzelnen Kreisverbände. .jpg) Für
ihr vielfältiges Engagement und ihren großen Einsatz zu Gunsten der
landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung wurden bi der Bezirksversammlung
Christa Ziegler, Gudrun Pezold, und Harald Galster (alles aus dem Landkreis
Bayreuth) sowie Renate Mitlacher (Landkreis Coburg) mit dem Silbernen
Verbandsabzeichen geehrt.
Für
ihr vielfältiges Engagement und ihren großen Einsatz zu Gunsten der
landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung wurden bi der Bezirksversammlung
Christa Ziegler, Gudrun Pezold, und Harald Galster (alles aus dem Landkreis
Bayreuth) sowie Renate Mitlacher (Landkreis Coburg) mit dem Silbernen
Verbandsabzeichen geehrt. .jpg) Dem
pflichtete auch der stellvertretende VLF-Landesvorsitzende Harald Schäfer bei.
Aus- und Weiterbildung müsse in der Landwirtschaft höchste Priorität haben. Der
Einsatz für flächendeckende und qualitativ hohe Landwirtschaftsschulen gehöre
unabdingbar dazu. „Wir brauchen den VLF und den VLM, um mit entsprechenden
Bildungsoffensiven hinein in Politik und Gesellschaft zu wirken“, sagte der
oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif. Die stellvertretende Vorsitzende des
Meisterverbandes Dagmar Hartleb nannte VLF und VLM wichtige Interessensvertreter
im Bereich der agrarischen Bildung, die mittlerweile zu einem festen Bestandteil
der Gesellschaft geworden seien.
Dem
pflichtete auch der stellvertretende VLF-Landesvorsitzende Harald Schäfer bei.
Aus- und Weiterbildung müsse in der Landwirtschaft höchste Priorität haben. Der
Einsatz für flächendeckende und qualitativ hohe Landwirtschaftsschulen gehöre
unabdingbar dazu. „Wir brauchen den VLF und den VLM, um mit entsprechenden
Bildungsoffensiven hinein in Politik und Gesellschaft zu wirken“, sagte der
oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif. Die stellvertretende Vorsitzende des
Meisterverbandes Dagmar Hartleb nannte VLF und VLM wichtige Interessensvertreter
im Bereich der agrarischen Bildung, die mittlerweile zu einem festen Bestandteil
der Gesellschaft geworden seien. Konkrete
Ergebnisse, wie der Wald der Zukunft mit dem Klimawandel zurechtkommen
könne, stellte Christian Ammer (links), Professor für Waldbau und
Waldökologie an der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der
Georg-August-Universität Göttingen den rund 120 Vertretern der Staatlichen
Forstverwaltung, des Privatwaldes, der Jagd und des Naturschutzes vor. Je
unterschiedlich die Baumarten und ihre Ansprüche sind, umso eher sind
positive Effekte zu erwarten, das heißt, umso besser können die Bäume
trockene Phasen tolerieren. Die Begründung von Mischbeständen bezeichnete
der Waldprofessor als eine Option, um den Klimawandel zumindest etwas
abzufedern. Ammer nannte dabei die Große Küstentanne, die Schwarzkiefer, die
Douglasie und die Roteiche als zu empfehlende Arten, für die einiges
spreche.
Konkrete
Ergebnisse, wie der Wald der Zukunft mit dem Klimawandel zurechtkommen
könne, stellte Christian Ammer (links), Professor für Waldbau und
Waldökologie an der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der
Georg-August-Universität Göttingen den rund 120 Vertretern der Staatlichen
Forstverwaltung, des Privatwaldes, der Jagd und des Naturschutzes vor. Je
unterschiedlich die Baumarten und ihre Ansprüche sind, umso eher sind
positive Effekte zu erwarten, das heißt, umso besser können die Bäume
trockene Phasen tolerieren. Die Begründung von Mischbeständen bezeichnete
der Waldprofessor als eine Option, um den Klimawandel zumindest etwas
abzufedern. Ammer nannte dabei die Große Küstentanne, die Schwarzkiefer, die
Douglasie und die Roteiche als zu empfehlende Arten, für die einiges
spreche. Der
Klimawandel ist längst im Gange, das stellte einmal mehr Johannes Lüers
(links) von der Abteilung Mikrometeorologie an der Universität Bayreuth
klar. Alle Messreihen zeigten seit Mitte der 1980er Jahre einen Knick nach
oben, auch in Oberfranken. Seit Beginn der 1980er Jahre gebe es immer mehr
heißte Tage und immer weniger kalte Tage, Oberfranken werde wärmer, und zwar
zu allen Jahreszeiten. Dazu kommt es nach den Worten des Wissenschaftlers,
dass Starkregenereignisse sowohl an Häufigkeit, als auch an Intensität
zunehmen und dass es schon lange keinen einzigen Monat mehr mit Dauerfrost
gegeben hat.
Der
Klimawandel ist längst im Gange, das stellte einmal mehr Johannes Lüers
(links) von der Abteilung Mikrometeorologie an der Universität Bayreuth
klar. Alle Messreihen zeigten seit Mitte der 1980er Jahre einen Knick nach
oben, auch in Oberfranken. Seit Beginn der 1980er Jahre gebe es immer mehr
heißte Tage und immer weniger kalte Tage, Oberfranken werde wärmer, und zwar
zu allen Jahreszeiten. Dazu kommt es nach den Worten des Wissenschaftlers,
dass Starkregenereignisse sowohl an Häufigkeit, als auch an Intensität
zunehmen und dass es schon lange keinen einzigen Monat mehr mit Dauerfrost
gegeben hat. Das
wiederum führe zu neuen Schädlingen und Baumkrankheiten, so Ralf Petercord
(links) von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft.
Insekten reagierten etwa durch eine schnellere Generationenfolge, durch ein
erhöhtes Vermehrungspotenzial, durch eine Zunahme der Aggressivität und
durch die Änderung der Verbreitungsgebiete auf den Klimawandel. „Es gibt
keine Baumart ohne Risiko“, sagte Petercord. Klare Gewinner des Klimawandels
seien schon jetzt der Eichenprozessionsspinner oder etwa der Schwammspinner.
Das
wiederum führe zu neuen Schädlingen und Baumkrankheiten, so Ralf Petercord
(links) von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft.
Insekten reagierten etwa durch eine schnellere Generationenfolge, durch ein
erhöhtes Vermehrungspotenzial, durch eine Zunahme der Aggressivität und
durch die Änderung der Verbreitungsgebiete auf den Klimawandel. „Es gibt
keine Baumart ohne Risiko“, sagte Petercord. Klare Gewinner des Klimawandels
seien schon jetzt der Eichenprozessionsspinner oder etwa der Schwammspinner..jpg) Falkenberg,
Lks. Tirschenreuth. Von der Planung über die Vorbereitung bis hin zum
eigentlichen Aufenthalt: die Digitalisierung hat den Urlaub komplett erfasst.
Auch den Urlaub auf dem Bauernhof: „Der Online-Bereich wird weiter auf uns
zurollen“, sagte Susanne Wibbeke, Geschäftsführerin des Landesverbandes
Bauernhof- und Landurlaub in Bayern. Bei der Mitgliederversammlung im
oberpfälzischen Falkenberg sprach sie von einer großen Herausforderung, der
Verband sei allerdings schon heute hervorragend aufgestellt.
Falkenberg,
Lks. Tirschenreuth. Von der Planung über die Vorbereitung bis hin zum
eigentlichen Aufenthalt: die Digitalisierung hat den Urlaub komplett erfasst.
Auch den Urlaub auf dem Bauernhof: „Der Online-Bereich wird weiter auf uns
zurollen“, sagte Susanne Wibbeke, Geschäftsführerin des Landesverbandes
Bauernhof- und Landurlaub in Bayern. Bei der Mitgliederversammlung im
oberpfälzischen Falkenberg sprach sie von einer großen Herausforderung, der
Verband sei allerdings schon heute hervorragend aufgestellt..jpg) So
sehen auch die Planungen für 2019 jede Menge Online-Aktivitäten vor. So sollen
die Online-Buchungsmöglichkeiten eingeführt, Suchmaschinen optimiert, weiterer
Content erstellt und die Social-Media-Kanäle weiter ausgebaut werden.
So
sehen auch die Planungen für 2019 jede Menge Online-Aktivitäten vor. So sollen
die Online-Buchungsmöglichkeiten eingeführt, Suchmaschinen optimiert, weiterer
Content erstellt und die Social-Media-Kanäle weiter ausgebaut werden..jpg) Bildung
und Beratung sollen auch bei der künftigen Arbeit des Verbandes im Mittelpunkt
stehen, so Anja Hensel-Lieberth von Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Sie
sagte die weitere Unterstützung für die Kampagnen des Verbandes zu und mahnte
auch für die Zukunft ein einheitliches Auftreten an. „Der Landesverband wirbt
als Marketingorganisation und Interessensvertretung bayernweit für die
Anbietergemeinschaften, er ist damit das Sprachrohr für den Urlaub auf dem
Bauernhof“, so Hensel-Lieberth.
Bildung
und Beratung sollen auch bei der künftigen Arbeit des Verbandes im Mittelpunkt
stehen, so Anja Hensel-Lieberth von Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Sie
sagte die weitere Unterstützung für die Kampagnen des Verbandes zu und mahnte
auch für die Zukunft ein einheitliches Auftreten an. „Der Landesverband wirbt
als Marketingorganisation und Interessensvertretung bayernweit für die
Anbietergemeinschaften, er ist damit das Sprachrohr für den Urlaub auf dem
Bauernhof“, so Hensel-Lieberth..jpg) Falkenstein,
Lks. Tirschenreuth. „Wer sich selber klein, hässlich und niedrig macht, der wird
auch so behandelt.“ Das sagt Gerd Sonnleitner, ehemaliger Präsident des
bayerischen, des deutschen und des europäischen Bauernverbandes. Bei der
Landesverbandsversammlung Bauernhof- und Landurlaub Bayern in Falkenstein rief
der jetzige BBV-Ehrenpräsident die Mitglieder zu mehr Selbstbewusstsein auf.
„Seien sie stolz auf das, was sie tun“, sagte er.
Falkenstein,
Lks. Tirschenreuth. „Wer sich selber klein, hässlich und niedrig macht, der wird
auch so behandelt.“ Das sagt Gerd Sonnleitner, ehemaliger Präsident des
bayerischen, des deutschen und des europäischen Bauernverbandes. Bei der
Landesverbandsversammlung Bauernhof- und Landurlaub Bayern in Falkenstein rief
der jetzige BBV-Ehrenpräsident die Mitglieder zu mehr Selbstbewusstsein auf.
„Seien sie stolz auf das, was sie tun“, sagte er..jpg) Wie
wichtig das richtige Image ist, machte Sonnleitner daran fest, dass für
bayerische Produkte fast überall höhere Preise erzielt werden könnten. Der
Imageeffekt sei sehr wichtig, um zu besseren Konditionen zu kommen. Die schöne
Landschaft gehöre dazu, aber auch die emotionale Bindung, und dabei spiele der
Urlaub auf dem Bauernhof eine große Rolle.
Wie
wichtig das richtige Image ist, machte Sonnleitner daran fest, dass für
bayerische Produkte fast überall höhere Preise erzielt werden könnten. Der
Imageeffekt sei sehr wichtig, um zu besseren Konditionen zu kommen. Die schöne
Landschaft gehöre dazu, aber auch die emotionale Bindung, und dabei spiele der
Urlaub auf dem Bauernhof eine große Rolle. .jpg) Goldkronach,
Lks. Bayreuth. Mit einer Großdemonstration haben der BBV und die örtliche
Bürgerinitiative gegen die geplante
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ-Leitung) demonstriert.
Landwirte und ihre Familien aus dem Landkreis Bayreuth und den
Nachbarlandkreisen Hof und Kulmbach waren mit über 80 Traktoren gekommen, um im
Konvoi von den Ortschaften Kottersreuth und Leisau auf der Kreisstraße BT 12 an
der Stadt Goldkronach und dem Ortsteil Nemmersdorf vorbei bis zum Kreuzstein zu
fahren. Auf diesem Korridor könnte die Trasse nach den vorliegenden
Informationen verlaufen.
Goldkronach,
Lks. Bayreuth. Mit einer Großdemonstration haben der BBV und die örtliche
Bürgerinitiative gegen die geplante
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ-Leitung) demonstriert.
Landwirte und ihre Familien aus dem Landkreis Bayreuth und den
Nachbarlandkreisen Hof und Kulmbach waren mit über 80 Traktoren gekommen, um im
Konvoi von den Ortschaften Kottersreuth und Leisau auf der Kreisstraße BT 12 an
der Stadt Goldkronach und dem Ortsteil Nemmersdorf vorbei bis zum Kreuzstein zu
fahren. Auf diesem Korridor könnte die Trasse nach den vorliegenden
Informationen verlaufen..jpg) Als
Hauptleidtragende einer im Moment geplanten Erdverkabelung bezeichnete der
stellvertretende Kreisobmann die Landwirtschaft. Die rund zwei Meter tiefen und
etwa 20 Meter breiten Rinnen, die gegraben werden müssten um die Kabel zu
verlegen, würden das Bodengefüge völlig durcheinander bringen. Hinzu komme eine
Erwärmung des Bodens in der Nähe der Kabel um bis zu vier Grad Celsius. Nach den
Worten von Martin Förster von der Bürgerinitiative „Goldkronach gegen den
Südost-Link“ stelle die Leitung falsche Weichen in der Energiepolitik und
verbrauche vor allem zu viel Fläche.
Als
Hauptleidtragende einer im Moment geplanten Erdverkabelung bezeichnete der
stellvertretende Kreisobmann die Landwirtschaft. Die rund zwei Meter tiefen und
etwa 20 Meter breiten Rinnen, die gegraben werden müssten um die Kabel zu
verlegen, würden das Bodengefüge völlig durcheinander bringen. Hinzu komme eine
Erwärmung des Bodens in der Nähe der Kabel um bis zu vier Grad Celsius. Nach den
Worten von Martin Förster von der Bürgerinitiative „Goldkronach gegen den
Südost-Link“ stelle die Leitung falsche Weichen in der Energiepolitik und
verbrauche vor allem zu viel Fläche..jpg) Höchstädt
im Fichtelgebirge, Lks. Wunsiedel. Zusammen mit Landesbäuerin Anneliese
Göller hat der BBV-Kreisverband Wunsiedel in der Peter-und-Paul-Kirche von
Höchstädt im Fichtelgebirge Erntedank gefeiert. Im Mittelpunkt stand dabei
die „Frauenpower vom Land“, wie es Göller formulierte. Göller, die auch
oberfränkische Bezirksbäuerin und Bamberger Kreisbäuerin ist, sprach zum
Jubiläum 70 Jahre Landfrauen im Bauernverband, während der Posaunenchor
Höchstädt-Thierstein und der Landfrauenchor „Sechsämtermoila“ die passende
musikalische Umrahmung in der prächtig geschmückten Kirche beisteuerten.
Höchstädt
im Fichtelgebirge, Lks. Wunsiedel. Zusammen mit Landesbäuerin Anneliese
Göller hat der BBV-Kreisverband Wunsiedel in der Peter-und-Paul-Kirche von
Höchstädt im Fichtelgebirge Erntedank gefeiert. Im Mittelpunkt stand dabei
die „Frauenpower vom Land“, wie es Göller formulierte. Göller, die auch
oberfränkische Bezirksbäuerin und Bamberger Kreisbäuerin ist, sprach zum
Jubiläum 70 Jahre Landfrauen im Bauernverband, während der Posaunenchor
Höchstädt-Thierstein und der Landfrauenchor „Sechsämtermoila“ die passende
musikalische Umrahmung in der prächtig geschmückten Kirche beisteuerten..jpg) Doch
nicht nur das: 70 Jahre Wachstum und Fortentwicklung seien auch 70 Jahre
Frieden, so Kreisobmann Harald Fischer. Das sei keine
Selbstverständlichkeit, genauso wie die Versorgung mit heimischen
Lebensmitteln gerade in einem Jahr wie diesem. „Wir sind dankbar für die
Ernte, die wir trotz der Trockenheit einfahren durften“, so Fischer. Immer
wieder sollte man die Menschen daran erinnern, dass die gefüllten Regale in
den Lebensmittelmärkten das Ergebnis bäuerlichen Wirtschaftens sind.
Doch
nicht nur das: 70 Jahre Wachstum und Fortentwicklung seien auch 70 Jahre
Frieden, so Kreisobmann Harald Fischer. Das sei keine
Selbstverständlichkeit, genauso wie die Versorgung mit heimischen
Lebensmitteln gerade in einem Jahr wie diesem. „Wir sind dankbar für die
Ernte, die wir trotz der Trockenheit einfahren durften“, so Fischer. Immer
wieder sollte man die Menschen daran erinnern, dass die gefüllten Regale in
den Lebensmittelmärkten das Ergebnis bäuerlichen Wirtschaftens sind..jpg) „Engagiert,
modern, aktiv, so sind wir“, sagte die Landesbäuerin und berichtete von 70
Landfrauenchören mit rund 1500 Sängerinnen, von circa 26000 ehrenamtlichen
Kräften auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene. Jüngstes Projekt der
Landfrauenarbeit sei die vom Bundesentwicklungsministerium finanzierte
Zusammenarbeit mit den Bäuerinnen in Kenia. In Afrika gehe es darum, dortige
Milchviehhaltung durch Seminare für die Kälberaufzucht voranzubringen und
die Bäuerinnen beim Aufbau von Selbsthilfeorganisationen zu unterstützen. 75
Prozent der Arbeit auf dem Land werde dort von Frauen geleistet, doch sie
hätten bislang keine Stimme.
„Engagiert,
modern, aktiv, so sind wir“, sagte die Landesbäuerin und berichtete von 70
Landfrauenchören mit rund 1500 Sängerinnen, von circa 26000 ehrenamtlichen
Kräften auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene. Jüngstes Projekt der
Landfrauenarbeit sei die vom Bundesentwicklungsministerium finanzierte
Zusammenarbeit mit den Bäuerinnen in Kenia. In Afrika gehe es darum, dortige
Milchviehhaltung durch Seminare für die Kälberaufzucht voranzubringen und
die Bäuerinnen beim Aufbau von Selbsthilfeorganisationen zu unterstützen. 75
Prozent der Arbeit auf dem Land werde dort von Frauen geleistet, doch sie
hätten bislang keine Stimme..jpg) Königsfeld.
Konditionalität statt Cross Compliance und Greening: Einen Ausblick auf die
EU-Agrarpolitik nach 2020 hat der stellvertretende BBV-Generalsekretär
Matthias Borst beim Königsfelder Jurabauerntag gewagt. Vieles soll anders
werden, nicht unbedingt alles besser, das wurde dabei schnell deutlich.
Königsfeld.
Konditionalität statt Cross Compliance und Greening: Einen Ausblick auf die
EU-Agrarpolitik nach 2020 hat der stellvertretende BBV-Generalsekretär
Matthias Borst beim Königsfelder Jurabauerntag gewagt. Vieles soll anders
werden, nicht unbedingt alles besser, das wurde dabei schnell deutlich..jpg) Neben
der fachlichen Information stand beim Königsfelder Jurabauerntag auch die
Erntedankfeier im Mittelpunkt. Nach dem Gottesdienst, den der Ortsgeistliche
Michael Herrmann in der St.-Jakobus-Kirche zelebriert hatte, wurde die
Erntekrone an der Spitze eines Festzuges zu den Klängen der Aufseßtaler
Blaskapelle in den Schleuppner-Saal getragen.
Neben
der fachlichen Information stand beim Königsfelder Jurabauerntag auch die
Erntedankfeier im Mittelpunkt. Nach dem Gottesdienst, den der Ortsgeistliche
Michael Herrmann in der St.-Jakobus-Kirche zelebriert hatte, wurde die
Erntekrone an der Spitze eines Festzuges zu den Klängen der Aufseßtaler
Blaskapelle in den Schleuppner-Saal getragen.  Nemmersdorf.
Gegen neue Netze und für Dezentralität in der Stromversorgung hat
sich Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender des Nürnberger
Regionalversorgers N-Ergie ausgesprochen. Bei einer Veranstaltung
des BBV-Bildungswerks zur geplanten
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ-Leitung) in
Nemmersdorf bei Goldkronach stellte Hasler den Neubau des
sogenannten Süd-Ost-Links in Frage.
Nemmersdorf.
Gegen neue Netze und für Dezentralität in der Stromversorgung hat
sich Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender des Nürnberger
Regionalversorgers N-Ergie ausgesprochen. Bei einer Veranstaltung
des BBV-Bildungswerks zur geplanten
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ-Leitung) in
Nemmersdorf bei Goldkronach stellte Hasler den Neubau des
sogenannten Süd-Ost-Links in Frage..jpg) Muggendorf,
Lks. Forchheim. Das Forchheimer Kreiserntedankfest im Wiesenttaler Ortsteil
Muggendorf ist traditionell eines der größten in Oberfranken. Doch diesmal
konnte sich keiner der Beteiligten daran erinnern, dass jemals zuvor so
viele Besucher ins Herz der Fränkischen Schweiz gekommen waren. Viele
tausend Besucher säumten bei prächtigem Herbstwetter die Straßen von
Muggendorf um den Erntedankfestzug mit vielen hundert Mitwirkenden, mehreren
aufwändig geschmückten Wagen, Blaskapellen, Tanzgruppen, Landfrauen und
sogar Böllerschützen zu verfolgen. Zu den Mitwirkenden gehörten unter
anderem auch die Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert, die
Landtagsabgeordneten Michael Hofmann und Thorsten Glauber, „gekrönte
Häupter“, wie die Fränkische Kirschkönigin Sandra Grau, die Spargelkönigin
Theresa Bub, die Forchheimer Bierkönigin Miriam Leiner und mehrere
Weinprinzessinen, genauso wie Vertreter von Vereinen, Tanzgruppen, Kirchen,
Schulen und Fahnenabordnungen.
Muggendorf,
Lks. Forchheim. Das Forchheimer Kreiserntedankfest im Wiesenttaler Ortsteil
Muggendorf ist traditionell eines der größten in Oberfranken. Doch diesmal
konnte sich keiner der Beteiligten daran erinnern, dass jemals zuvor so
viele Besucher ins Herz der Fränkischen Schweiz gekommen waren. Viele
tausend Besucher säumten bei prächtigem Herbstwetter die Straßen von
Muggendorf um den Erntedankfestzug mit vielen hundert Mitwirkenden, mehreren
aufwändig geschmückten Wagen, Blaskapellen, Tanzgruppen, Landfrauen und
sogar Böllerschützen zu verfolgen. Zu den Mitwirkenden gehörten unter
anderem auch die Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert, die
Landtagsabgeordneten Michael Hofmann und Thorsten Glauber, „gekrönte
Häupter“, wie die Fränkische Kirschkönigin Sandra Grau, die Spargelkönigin
Theresa Bub, die Forchheimer Bierkönigin Miriam Leiner und mehrere
Weinprinzessinen, genauso wie Vertreter von Vereinen, Tanzgruppen, Kirchen,
Schulen und Fahnenabordnungen..jpg) Laut
Bürgermeister Helmut Taut war es das 45 Kreiserntedankfest in Zusammenarbeit
mit dem BBV, einen Festzug gibt es bereits seit 1949 und das gleichzeitig
stattfindende Kürbisfest wird schon seit gut 150 Jahren gefeiert. Auch für
den Bürgermeister hat der Festzug diesmal alles Dagewesene übertroffen. „Der
Zug war s groß, wie schon lange nicht mehr“, sagte er und bedankte sich bei
den vielen ehrenamtlichen Helfern, die ein Woche lang mit vollstem Einsatz
gearbeitet haben.
Laut
Bürgermeister Helmut Taut war es das 45 Kreiserntedankfest in Zusammenarbeit
mit dem BBV, einen Festzug gibt es bereits seit 1949 und das gleichzeitig
stattfindende Kürbisfest wird schon seit gut 150 Jahren gefeiert. Auch für
den Bürgermeister hat der Festzug diesmal alles Dagewesene übertroffen. „Der
Zug war s groß, wie schon lange nicht mehr“, sagte er und bedankte sich bei
den vielen ehrenamtlichen Helfern, die ein Woche lang mit vollstem Einsatz
gearbeitet haben..jpg) Darauf
zielte auch der unterfränkische BBV-Bezirkspräsident Stefan Köhler ab.
Leider habe Erntedank heute seine Bedeutung verloren, bedauerte er. „Die
Milch fließt endlos aus dem Tetrapack“, Gemüse, Fleisch und Eier liegen
massenweise in den Regalen und Brot und Brötchen werden aus dem Automaten
geworfen“. Allzu sicher sollte man sich trotzdem nicht sein. Deutschland
habe nur noch einen Selbstversorgungsgrad von 85 Prozent. Das bedeutet, 15
Prozent der erforderlichen Nahrungsmittel müssten bereits importiert werden.
Darauf
zielte auch der unterfränkische BBV-Bezirkspräsident Stefan Köhler ab.
Leider habe Erntedank heute seine Bedeutung verloren, bedauerte er. „Die
Milch fließt endlos aus dem Tetrapack“, Gemüse, Fleisch und Eier liegen
massenweise in den Regalen und Brot und Brötchen werden aus dem Automaten
geworfen“. Allzu sicher sollte man sich trotzdem nicht sein. Deutschland
habe nur noch einen Selbstversorgungsgrad von 85 Prozent. Das bedeutet, 15
Prozent der erforderlichen Nahrungsmittel müssten bereits importiert werden.
.jpg) In
den Dienst der guten Sache stellten sich auch heuer wieder die Landfrauen.
Sie spendeten nach den Worten von Kreisbäuerin Rosi Kraus diesmal wieder
zwischen 80 und 90 Kuchen und Torten sowie über 800 „Küchla“. Der Erlös in
Höhe von mehreren 1000 Euro kommt dem bäuerlichen Hilfsdienst und der
Lebenshilfe Forchheim zugute.
In
den Dienst der guten Sache stellten sich auch heuer wieder die Landfrauen.
Sie spendeten nach den Worten von Kreisbäuerin Rosi Kraus diesmal wieder
zwischen 80 und 90 Kuchen und Torten sowie über 800 „Küchla“. Der Erlös in
Höhe von mehreren 1000 Euro kommt dem bäuerlichen Hilfsdienst und der
Lebenshilfe Forchheim zugute..jpg) Pechgraben,
Lks. Kulmbach. Im Kulmbacher Land wurde heuer die schlechteste Ernte seit dem
Trockenjahr 1976 verzeichnet. Das hat Kreisobmann Wilfried Löwinger
festgestellt. Er sprach von Einbußen in Höhe von 30 bis 50 Prozent. Wenn
trotzdem Erntedank gefeiert wurde, dann deshalb, weil man hierzulande von
schlimmen Unwettern verschont geblieben sei und auch in diesem Jahr jedem
ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung gestanden hätten. Vor dem Hintergrund
von vielen Millionen Menschen, die auf der Welt hungern müssten, sei dies keine
Selbstverständlichkeit.
Pechgraben,
Lks. Kulmbach. Im Kulmbacher Land wurde heuer die schlechteste Ernte seit dem
Trockenjahr 1976 verzeichnet. Das hat Kreisobmann Wilfried Löwinger
festgestellt. Er sprach von Einbußen in Höhe von 30 bis 50 Prozent. Wenn
trotzdem Erntedank gefeiert wurde, dann deshalb, weil man hierzulande von
schlimmen Unwettern verschont geblieben sei und auch in diesem Jahr jedem
ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung gestanden hätten. Vor dem Hintergrund
von vielen Millionen Menschen, die auf der Welt hungern müssten, sei dies keine
Selbstverständlichkeit..jpg) „Unsere
Produkte sind lebensnotwendig und lebenswichtig, das unterscheidet uns von
anderen Branchen“, sagte Festredner Günther Felßner, stellvertretender
BBV-Präsident aus dem Nürnberger Land. Die zentrale Erntedankbitte „Unser
tägliches Brot gib uns heute“, habe deshalb nicht an Aktualität verloren.
Erntedank gerade in einem solchen schwierigen Jahr zu feiern, das bedeutet nach
den Worten Felßners auch, das Wunder des Lebens zu feiern. Ein Getreidekorn sei
so ein Wunder des Lebens. Letztlich sei alles Leben auf ein solches Samenkorn
aufgebaut und dafür gelte es zu denken.
„Unsere
Produkte sind lebensnotwendig und lebenswichtig, das unterscheidet uns von
anderen Branchen“, sagte Festredner Günther Felßner, stellvertretender
BBV-Präsident aus dem Nürnberger Land. Die zentrale Erntedankbitte „Unser
tägliches Brot gib uns heute“, habe deshalb nicht an Aktualität verloren.
Erntedank gerade in einem solchen schwierigen Jahr zu feiern, das bedeutet nach
den Worten Felßners auch, das Wunder des Lebens zu feiern. Ein Getreidekorn sei
so ein Wunder des Lebens. Letztlich sei alles Leben auf ein solches Samenkorn
aufgebaut und dafür gelte es zu denken..jpg) Bad
Alexandersbad. Wegen angeblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz hat die
Organisation Peta gegen alle aktiv Beteiligten an der Eröffnung der
bayerischen Karpfensaison Ende August in Bad Alexandersbad Anzeige
erstattet. Dazu gehören neben der bayerischen Landwirtschaftsministerin
Michaela Kaniber auch die beiden Landtagsabgeordneten Ludwig von Lerchenfeld
und Martin Schöffel, Bezirkstagspräsident Günther Denzler, Landrat Karl
Döhler, der Bürgermeister von Bad Alexandersbad, Peter Berek und der
Vorsitzende der Teichgenossenschaft Oberfranken, Dr. Peter Thoma.
Bad
Alexandersbad. Wegen angeblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz hat die
Organisation Peta gegen alle aktiv Beteiligten an der Eröffnung der
bayerischen Karpfensaison Ende August in Bad Alexandersbad Anzeige
erstattet. Dazu gehören neben der bayerischen Landwirtschaftsministerin
Michaela Kaniber auch die beiden Landtagsabgeordneten Ludwig von Lerchenfeld
und Martin Schöffel, Bezirkstagspräsident Günther Denzler, Landrat Karl
Döhler, der Bürgermeister von Bad Alexandersbad, Peter Berek und der
Vorsitzende der Teichgenossenschaft Oberfranken, Dr. Peter Thoma. Kulmbach.
„Manche schrecken davor zurück, so dramatisch ist es aber gar nicht“, sagt
Otto Kreil. Der 2. Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Kulmbach
spricht von der revierübergreifenden Drückjagd, eine der effektivsten
Möglichkeiten, der immer weiter steigenden Zahl von Wildschweinen Herr zu
werden. Was bei der Planung und Durchführung einer solchen Drückjagd alles
zu beachten ist, darüber berichtete Kreil bei einer gemeinsamen
Informationsveranstaltung zusammen mit dem Bauernverband vor Jägern,
Jagdpächtern, Jagdvorstehern und Landwirten in Kulmbach.
Kulmbach.
„Manche schrecken davor zurück, so dramatisch ist es aber gar nicht“, sagt
Otto Kreil. Der 2. Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Kulmbach
spricht von der revierübergreifenden Drückjagd, eine der effektivsten
Möglichkeiten, der immer weiter steigenden Zahl von Wildschweinen Herr zu
werden. Was bei der Planung und Durchführung einer solchen Drückjagd alles
zu beachten ist, darüber berichtete Kreil bei einer gemeinsamen
Informationsveranstaltung zusammen mit dem Bauernverband vor Jägern,
Jagdpächtern, Jagdvorstehern und Landwirten in Kulmbach..jpg) Weidensees,
Lks. Bayreuth. Fast 50 Aussteller, so viele wie nie zuvor, hatten sich
diesmal am Holztag der Forstbetriebsgemeinschaft im Betzensteiner Ortsteil
Weidensees beteiligt. Die Großveranstaltung, die seit 2006 alle zwei Jahre
auf dem Gelände des Unternehmens Holzbau Hümmer stattfindet, heißt
mittlerweile Wald-Holz-Energietag und gilt mit bis zu 3000 Besuchern als
größte Forstmesse der Fränkischen Schweiz.
Weidensees,
Lks. Bayreuth. Fast 50 Aussteller, so viele wie nie zuvor, hatten sich
diesmal am Holztag der Forstbetriebsgemeinschaft im Betzensteiner Ortsteil
Weidensees beteiligt. Die Großveranstaltung, die seit 2006 alle zwei Jahre
auf dem Gelände des Unternehmens Holzbau Hümmer stattfindet, heißt
mittlerweile Wald-Holz-Energietag und gilt mit bis zu 3000 Besuchern als
größte Forstmesse der Fränkischen Schweiz..jpg) Dazu
riet auch die bayerische Waldkönigin Johanne Gierl. Die Botschafterin der
Wälder und der Waldbesitzer aus dem Landkreis Regen sprach sich für
multifunktionale Wälder aus, um künftig auf alles vorbereitet zu sein. Dazu
benötige es auch starke Partner wie die FBG Pegnitz, damit die Forstbranche
optimal aufgestellt ist.
Dazu
riet auch die bayerische Waldkönigin Johanne Gierl. Die Botschafterin der
Wälder und der Waldbesitzer aus dem Landkreis Regen sprach sich für
multifunktionale Wälder aus, um künftig auf alles vorbereitet zu sein. Dazu
benötige es auch starke Partner wie die FBG Pegnitz, damit die Forstbranche
optimal aufgestellt ist..jpg) Auf
die große Gemeinschaft der rund 700000 Waldbesitzer in Bayern machte die
Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer aufmerksam. Viele davon seien
gleichzeitig auch Landwirte, gab sie zu bedenken. Der Wald habe deshalb
große Bedeutung in Bayern. Auch die Politik habe dies längst erkannt.
Beispielsweise seien jetzt wieder neue Försterstellen geschaffen worden. Am
Rande ihres Grußwortes sagte Brendel-Fischer auch zu, keinen dritten
Nationalparkt in Bayern zu schaffen, sondern stattdessen die Naturparke zu
stärken.
Auf
die große Gemeinschaft der rund 700000 Waldbesitzer in Bayern machte die
Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer aufmerksam. Viele davon seien
gleichzeitig auch Landwirte, gab sie zu bedenken. Der Wald habe deshalb
große Bedeutung in Bayern. Auch die Politik habe dies längst erkannt.
Beispielsweise seien jetzt wieder neue Försterstellen geschaffen worden. Am
Rande ihres Grußwortes sagte Brendel-Fischer auch zu, keinen dritten
Nationalparkt in Bayern zu schaffen, sondern stattdessen die Naturparke zu
stärken..jpg) Zum
Wald-Holz-Energietag gehörten unter anderem spektakuläre
Häckselvorführungen, Infostände von Heizungsbauern, Imkern und von der
Jägervereinigung Pegnitz. Der Maschinenring Bayreuth-Pegnitz informierte
über die Bekämpfung des Maiszünslers mit Hilfe von Drohnen und die
Bayerischen Staatsforsten zeigten auf, wie wichtig der Wegebau im Wald ist.
Zum
Wald-Holz-Energietag gehörten unter anderem spektakuläre
Häckselvorführungen, Infostände von Heizungsbauern, Imkern und von der
Jägervereinigung Pegnitz. Der Maschinenring Bayreuth-Pegnitz informierte
über die Bekämpfung des Maiszünslers mit Hilfe von Drohnen und die
Bayerischen Staatsforsten zeigten auf, wie wichtig der Wegebau im Wald ist. Bayreuth/Pegnitz.
Als äußeres Zeichen der langjährigen guten Zusammenarbeit haben die
Bayerischen Staatsforsten dem Maschinenring Bayreuth-Pegnitz eine rund 1,50
Meter große, mit der Motorsäge geschnitzte Eule überreicht. Das Kunstwerk
stammt von Alfred Popp (44), Mitarbeiter der Staatsforsten, aus Hummeltal,
der die hölzerne Eule eigens für den Maschinenring angefertigt und sogar das
entsprechende Logo eingearbeitet hatte.
Bayreuth/Pegnitz.
Als äußeres Zeichen der langjährigen guten Zusammenarbeit haben die
Bayerischen Staatsforsten dem Maschinenring Bayreuth-Pegnitz eine rund 1,50
Meter große, mit der Motorsäge geschnitzte Eule überreicht. Das Kunstwerk
stammt von Alfred Popp (44), Mitarbeiter der Staatsforsten, aus Hummeltal,
der die hölzerne Eule eigens für den Maschinenring angefertigt und sogar das
entsprechende Logo eingearbeitet hatte. .jpg) Bayreuth.
Die Dürre des zurückliegenden Sommers, der Wolf in Oberfranken und
Leerstände in den Dörfern waren unter anderem Themen eines Kontaktgesprächs
mit der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, zu der die
örtliche Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer Vertreter eingeladen
hatte. Die Ministerin appellierte dabei insbesondere an die Verbraucher,
Lebensmittel aus regionaler Erzeugung mehr wert zu schätzen. Es könne nicht
sein, dass ein Liter Mineralwasser mehr kostet als ein Liter Milch. Ebenso
wenig sei es zu akzeptieren, wenn auf der Terrasse ein sündhaft teurer Grill
steht, aber letztlich nur Billigstfleisch darauf kommt.
Bayreuth.
Die Dürre des zurückliegenden Sommers, der Wolf in Oberfranken und
Leerstände in den Dörfern waren unter anderem Themen eines Kontaktgesprächs
mit der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, zu der die
örtliche Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer Vertreter eingeladen
hatte. Die Ministerin appellierte dabei insbesondere an die Verbraucher,
Lebensmittel aus regionaler Erzeugung mehr wert zu schätzen. Es könne nicht
sein, dass ein Liter Mineralwasser mehr kostet als ein Liter Milch. Ebenso
wenig sei es zu akzeptieren, wenn auf der Terrasse ein sündhaft teurer Grill
steht, aber letztlich nur Billigstfleisch darauf kommt..jpg) Die
Dürre sei aber auch in den Wäldern dramatisch, sagte Forstbetriebsleiter
Fritz Maier von den Bayerischen Staatsforsten. Eine Folge davon sei, dass
sich der Borkenkäfer derzeit rasend schnell ausbreitet. Um den Rohstoff Holz
zu konservieren seien dringend Nasslager notwendig, die aufgrund der
notwendigen Genehmigungen allerdings schwierig auf den Weg zu bringen seien.
Bei Nasslagern handelt es sich um Aufbewahrungsorte für eingeschlagenes
Holz, bei dem die Baumstämme künstlich beregnet werden.
Die
Dürre sei aber auch in den Wäldern dramatisch, sagte Forstbetriebsleiter
Fritz Maier von den Bayerischen Staatsforsten. Eine Folge davon sei, dass
sich der Borkenkäfer derzeit rasend schnell ausbreitet. Um den Rohstoff Holz
zu konservieren seien dringend Nasslager notwendig, die aufgrund der
notwendigen Genehmigungen allerdings schwierig auf den Weg zu bringen seien.
Bei Nasslagern handelt es sich um Aufbewahrungsorte für eingeschlagenes
Holz, bei dem die Baumstämme künstlich beregnet werden..jpg) Nach
den Worten der Landwirtschaftsministerin werde der ländliche Raum der
Gewinner der Zukunft sein. Schon jetzt platzten die Städte in den
Metropolregionen aus allen Nähten. Der Druck auf das Land werde enorm sein,
wenn die Menschen Wohnraum suchen, sagte Kaniber. Das neue Förderprogramm
„Innen statt außen“ der Bayerischen Staatsregierung soll deshalb die Dörfer
fit für die Zukunft machen, indem insbesondere leerstehende Gebäude und
Brachen wieder nutzbar gemacht und dadurch Flächen gespart werden. Die
zentrale Rolle zum Leben auf dem Land werde allerdings die Landwirtschaft
einnehmen, zeigte sich die Ministerin überzeugt. Landwirtschaft stehe für
Infrastruktur, Tradition und Kultur, so Kaniber.
Nach
den Worten der Landwirtschaftsministerin werde der ländliche Raum der
Gewinner der Zukunft sein. Schon jetzt platzten die Städte in den
Metropolregionen aus allen Nähten. Der Druck auf das Land werde enorm sein,
wenn die Menschen Wohnraum suchen, sagte Kaniber. Das neue Förderprogramm
„Innen statt außen“ der Bayerischen Staatsregierung soll deshalb die Dörfer
fit für die Zukunft machen, indem insbesondere leerstehende Gebäude und
Brachen wieder nutzbar gemacht und dadurch Flächen gespart werden. Die
zentrale Rolle zum Leben auf dem Land werde allerdings die Landwirtschaft
einnehmen, zeigte sich die Ministerin überzeugt. Landwirtschaft stehe für
Infrastruktur, Tradition und Kultur, so Kaniber..jpg) Bad
Alexandersbad, Lks. Wunsiedel. Trotz Trockenheit, hoher Temperaturen und
stellenweise sogar Wasserknappheit erwarten die Teichwirte eine
hervorragende Karpfenernte. „Die Karpfen werden fleisch- und eiweißreich
sein und die Erntemenge wohl über dem guten Niveau des Vorjahres liegen“,
sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber bei der Eröffnung der
Karpfensaison am Rogler-Weiher in Bad Alexandersbad.
Bad
Alexandersbad, Lks. Wunsiedel. Trotz Trockenheit, hoher Temperaturen und
stellenweise sogar Wasserknappheit erwarten die Teichwirte eine
hervorragende Karpfenernte. „Die Karpfen werden fleisch- und eiweißreich
sein und die Erntemenge wohl über dem guten Niveau des Vorjahres liegen“,
sagte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber bei der Eröffnung der
Karpfensaison am Rogler-Weiher in Bad Alexandersbad..jpg) Wie
dramatisch die Situation wirklich ist, verdeutlichte der Wunsiedler Landrat
Karl Döhler. Im Nachbarlandkreis hätten bereits 55 Teichwirte aufgegeben und
auch im Wunsiedler Landkreis kenne er Teichwirte, die sagen: „Wir setzen
nichts mehr ein, es macht einfach keinen Sinn mehr“. Lösungen seien deshalb
dringend notwendig. Angesichts der Wasserknappheit des Sommers machte sich
Bezirkstagspräsident Günther Denzler für den Bau neuer Teiche stark. Teiche
seien hervorragende Wasserrückhaltebecken in der Fläche, sie seien wichtig
für die Grundwasserneubildung und bedeutende Rückzugsgebiete für bedrohte
Tier- und Pflanzenarten. Er könne es deshalb nicht nachvollziehen, wenn
Teichbauprojekten keine Genehmigung erteilt werde.
Wie
dramatisch die Situation wirklich ist, verdeutlichte der Wunsiedler Landrat
Karl Döhler. Im Nachbarlandkreis hätten bereits 55 Teichwirte aufgegeben und
auch im Wunsiedler Landkreis kenne er Teichwirte, die sagen: „Wir setzen
nichts mehr ein, es macht einfach keinen Sinn mehr“. Lösungen seien deshalb
dringend notwendig. Angesichts der Wasserknappheit des Sommers machte sich
Bezirkstagspräsident Günther Denzler für den Bau neuer Teiche stark. Teiche
seien hervorragende Wasserrückhaltebecken in der Fläche, sie seien wichtig
für die Grundwasserneubildung und bedeutende Rückzugsgebiete für bedrohte
Tier- und Pflanzenarten. Er könne es deshalb nicht nachvollziehen, wenn
Teichbauprojekten keine Genehmigung erteilt werde. .jpg) Fernreuth.
Die Familie Murrmann aus Fernreuth bei Hollfeld ist bekannt dafür, dass sie
innovativen Ideen aufgeschlossen gegenübersteht und deren Umsetzung auch
tatkräftig angeht. Drei Generationen leben und arbeiten auf dem
landwirtschaftlichen Betrieb. Schon 1996 hatte die Familie eine
Windkraftanlage errichtet und damit als eine der ersten in Oberfranken
dieses Potenzial erkannt. Dann setzten die Murrmanns mit einer Biogasanlage
ihr Engagement in Sachen Energiewende fort. Jetzt hatten sich Inge und
Stefan Murrmann an dem Demonstrationsprojekt Becherpflanze „Silphie“
beteiligt und auf zwei Flächen insgesamt knapp viereinhalb Hektar davon
angebaut. Zu einer Zwischenbilanz kamen vor wenigen Tagen gleich zwei
Minister auf den Betrieb: Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und
Umweltminister Marcel Huber.
Fernreuth.
Die Familie Murrmann aus Fernreuth bei Hollfeld ist bekannt dafür, dass sie
innovativen Ideen aufgeschlossen gegenübersteht und deren Umsetzung auch
tatkräftig angeht. Drei Generationen leben und arbeiten auf dem
landwirtschaftlichen Betrieb. Schon 1996 hatte die Familie eine
Windkraftanlage errichtet und damit als eine der ersten in Oberfranken
dieses Potenzial erkannt. Dann setzten die Murrmanns mit einer Biogasanlage
ihr Engagement in Sachen Energiewende fort. Jetzt hatten sich Inge und
Stefan Murrmann an dem Demonstrationsprojekt Becherpflanze „Silphie“
beteiligt und auf zwei Flächen insgesamt knapp viereinhalb Hektar davon
angebaut. Zu einer Zwischenbilanz kamen vor wenigen Tagen gleich zwei
Minister auf den Betrieb: Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und
Umweltminister Marcel Huber..jpg) Als
mehrjährige Pflanze könne die durchwachsene Silphie Nährstoffe im Ackerboden
gut zurückhalten. Zudem hielten die Wurzeln der Becherpflanze den Boden
ganzjährig fest und schützten den Boden so vor Erosion. „Damit ist die
Becherpflanze Silphie eine innovative und gleichzeitig naturverträgliche
Alternative zu herkömmlichen Energiepflanzen“, heißt es in einem
Zwischenbericht.
Als
mehrjährige Pflanze könne die durchwachsene Silphie Nährstoffe im Ackerboden
gut zurückhalten. Zudem hielten die Wurzeln der Becherpflanze den Boden
ganzjährig fest und schützten den Boden so vor Erosion. „Damit ist die
Becherpflanze Silphie eine innovative und gleichzeitig naturverträgliche
Alternative zu herkömmlichen Energiepflanzen“, heißt es in einem
Zwischenbericht..jpg) Ministerin
Michaela Kaniber sprach von einem echten Zukunftsprojekt. Noch zu Beginn der
sechziger Jahre sei der Mais aufgrund des aufwändigen Anbaus und der
bescheidenen Erntetechnik eine Nischenkultur gewesen. Erst nach
jahrzehntelanger Forschung sei dann der Durchbruch auf der Fläche gelungen.
Vielleicht wird es der Becherpflanze Silphie genauso gehen, hoffte die
Ministerin. „Umweltschutz und Landwirtschaft gehen hier Hand in Hand“, so
Kaniber, die auch von einem großen Miteinander sprach und hoffte, dass
dieses Projekt bald bayernweit umgesetzt werde. Vielleicht ist es wirklich
die Wunderpflanze, nach der wir suchen“, sagte Umweltminister Huber.
Schließlich sei die „sympathische Tiefwurzlerin aus Nordamerika“ ohne
natürliche Feinde, boden-, grundwasser- und insektenfreundlich.
Ministerin
Michaela Kaniber sprach von einem echten Zukunftsprojekt. Noch zu Beginn der
sechziger Jahre sei der Mais aufgrund des aufwändigen Anbaus und der
bescheidenen Erntetechnik eine Nischenkultur gewesen. Erst nach
jahrzehntelanger Forschung sei dann der Durchbruch auf der Fläche gelungen.
Vielleicht wird es der Becherpflanze Silphie genauso gehen, hoffte die
Ministerin. „Umweltschutz und Landwirtschaft gehen hier Hand in Hand“, so
Kaniber, die auch von einem großen Miteinander sprach und hoffte, dass
dieses Projekt bald bayernweit umgesetzt werde. Vielleicht ist es wirklich
die Wunderpflanze, nach der wir suchen“, sagte Umweltminister Huber.
Schließlich sei die „sympathische Tiefwurzlerin aus Nordamerika“ ohne
natürliche Feinde, boden-, grundwasser- und insektenfreundlich..jpg) Feulersdorf.
Nach gut einem Jahr Bauzeit haben die beiden Landwirte Fritz Boss und Stefan
Scherzer aus dem Nürnberger Knoblauchsland im oberfränkischen Feulersdorf bei
Wonsees eine der modernsten Gemüsefarmen Deutschlands eröffnet. Auf aktuell über
neun Hektar Fläche wachsen unter Glas Tomaten, Gurken und Paprika.
Feulersdorf.
Nach gut einem Jahr Bauzeit haben die beiden Landwirte Fritz Boss und Stefan
Scherzer aus dem Nürnberger Knoblauchsland im oberfränkischen Feulersdorf bei
Wonsees eine der modernsten Gemüsefarmen Deutschlands eröffnet. Auf aktuell über
neun Hektar Fläche wachsen unter Glas Tomaten, Gurken und Paprika. .jpg) Wo
früher Felder und Grünland waren, sind jetzt unweit der Bundesautobahn A70
riesige Gewächshäuser, 7,50 Meter hoch, entstanden. Insgesamt ist das Areal 25
Hektar groß, einen wesentlichen Teil davon nimmt die Technik mit drei
Blockheizkraftwerken und zwei Regenrückhaltebecken ein, dazu kommen Lager- und
Verpackungshallen sowie Wohneinheiten für rund 50 Saisonarbeitskräfte.
Wo
früher Felder und Grünland waren, sind jetzt unweit der Bundesautobahn A70
riesige Gewächshäuser, 7,50 Meter hoch, entstanden. Insgesamt ist das Areal 25
Hektar groß, einen wesentlichen Teil davon nimmt die Technik mit drei
Blockheizkraftwerken und zwei Regenrückhaltebecken ein, dazu kommen Lager- und
Verpackungshallen sowie Wohneinheiten für rund 50 Saisonarbeitskräfte..jpg) Rund
20 der 80 Beschäftigten kommen aus der Region, so wie Patrick Weggel, gelernter
Mechatroniker aus dem nahen Sanspareil. Nach den Worten von Fritz Boss sind
aktuell rund 60 Erntehelfer im Einsatz. Sie kommen meist aus Rumänien.
Rund
20 der 80 Beschäftigten kommen aus der Region, so wie Patrick Weggel, gelernter
Mechatroniker aus dem nahen Sanspareil. Nach den Worten von Fritz Boss sind
aktuell rund 60 Erntehelfer im Einsatz. Sie kommen meist aus Rumänien..jpg) Pommersfelden.
Sie gehören zu Oberfranken und liegen doch in Mittelfranken: die Limbacher
Weiher. Umgeben vom Landkreis Erlangen-Höchstadt bildet die Teichkette die
einzige oberfränkische Enklave. Die Teichgenossenschaft Oberfranken hat
jetzt das Augenmerk auf diese historische Besonderheit gerichtet. Der
Zusammenschluss von Teichwirten aus der Region zeichnete die Jahrhunderte
alten Gewässer offiziell als Kulturgut aus.
Pommersfelden.
Sie gehören zu Oberfranken und liegen doch in Mittelfranken: die Limbacher
Weiher. Umgeben vom Landkreis Erlangen-Höchstadt bildet die Teichkette die
einzige oberfränkische Enklave. Die Teichgenossenschaft Oberfranken hat
jetzt das Augenmerk auf diese historische Besonderheit gerichtet. Der
Zusammenschluss von Teichwirten aus der Region zeichnete die Jahrhunderte
alten Gewässer offiziell als Kulturgut aus. .jpg) Die
Geschichte der Teichkette reicht bis in das 17. Jahrhundert zurück. Seitdem
sind die Weiher im Familienbesitz, so der Eigentümer Johannes Weiß. Weil die
Flächen drum herum zu den Besitzungen der Grafen von Schönborg gehörten,
habe auch die Gebietsreform von 1972 nichts daran ausrichten können, dass
die Teiche zur Gemeinde Pommerfelden im Landkreis Bamberg und damit zu
Oberfranken gehören. Johannes Weiß produziert in den klassischen Waldteichen
Karpfen, Schleien und Zander.
Die
Geschichte der Teichkette reicht bis in das 17. Jahrhundert zurück. Seitdem
sind die Weiher im Familienbesitz, so der Eigentümer Johannes Weiß. Weil die
Flächen drum herum zu den Besitzungen der Grafen von Schönborg gehörten,
habe auch die Gebietsreform von 1972 nichts daran ausrichten können, dass
die Teiche zur Gemeinde Pommerfelden im Landkreis Bamberg und damit zu
Oberfranken gehören. Johannes Weiß produziert in den klassischen Waldteichen
Karpfen, Schleien und Zander..jpg) Neben
der prägenden Bedeutung für die Landschaft, der Bewirtschaftung und der
belegten Historie müsse ein als Kulturgut ausgezeichneter Teich auch eine
besondere ökologische Bedeutung haben, so Vorsitzender Thoma. Das alles sei
bei den Limbacher Weihern erfüllt. Damit seien sie nicht nur
Landschaftsbestandteile, sondern auch wertvolle Kulturgüter. Das sah auch
die Jury so, zu der unter anderem die Fischereifachberatung des Bezirks
Oberfranken gehört.
Neben
der prägenden Bedeutung für die Landschaft, der Bewirtschaftung und der
belegten Historie müsse ein als Kulturgut ausgezeichneter Teich auch eine
besondere ökologische Bedeutung haben, so Vorsitzender Thoma. Das alles sei
bei den Limbacher Weihern erfüllt. Damit seien sie nicht nur
Landschaftsbestandteile, sondern auch wertvolle Kulturgüter. Das sah auch
die Jury so, zu der unter anderem die Fischereifachberatung des Bezirks
Oberfranken gehört. Himmelkron.
Nach einer relativ starken Erhöhung der vermarktete Stückzahl von Nutz- und
Schlachttieren im Jahr 2016 musste die Nordbayerischen Vermarktungsgesellschaft
(NVG) Bovex GmbH 2017 einen leichten Rückgang hinnehmen. Das hat der neue
NVG-Geschäftsführer Sebastian Hill bei der Vertreterversammlung der
Viehvermarktungsgenossenschaft (VVG) Nordbayern in Himmelkron bekannt gegeben.
Die NVG Bovex ist ein Tochterunternehmen der VVG. Beide haben ihren Sitz in
Kitzingen, Geschäftsstellen gibt es in Wolpertshausen, Fensterbach und am
Schlachthof in Bayreuth.
Himmelkron.
Nach einer relativ starken Erhöhung der vermarktete Stückzahl von Nutz- und
Schlachttieren im Jahr 2016 musste die Nordbayerischen Vermarktungsgesellschaft
(NVG) Bovex GmbH 2017 einen leichten Rückgang hinnehmen. Das hat der neue
NVG-Geschäftsführer Sebastian Hill bei der Vertreterversammlung der
Viehvermarktungsgenossenschaft (VVG) Nordbayern in Himmelkron bekannt gegeben.
Die NVG Bovex ist ein Tochterunternehmen der VVG. Beide haben ihren Sitz in
Kitzingen, Geschäftsstellen gibt es in Wolpertshausen, Fensterbach und am
Schlachthof in Bayreuth. Bayreuth.
Noch ist es nur ein Anfang, doch für das kommende Jahr erwarten Johannes
Scherm vom Maschinenring Bayreuth-Pegnitz und Reinhard Ostermeier vom Amt
für Landwirtschaft einen deutlichen Anstieg: Auf rund 120 Hektar Fläche wird
der Maiszünsler (Ostrinia nubilalis), einer der wirtschaftlich relevantesten
Schädlinge in Maisbeständen, im Raum Bayreuth nicht mehr chemisch, sondern
biologisch bekämpft. Möglich machen dies Schlupfwespen. Sie fressen die
Larven des Maiszünslers einfach auf. „Wir sind damit voll auf die
biologische Schiene abgefahren“, sagt Johannes Scherm, dem es auch darum
geht, das Image der Landwirtschaft mit der alternativen
Schädlingsbekämpfungsmethode zu verbessern.
Bayreuth.
Noch ist es nur ein Anfang, doch für das kommende Jahr erwarten Johannes
Scherm vom Maschinenring Bayreuth-Pegnitz und Reinhard Ostermeier vom Amt
für Landwirtschaft einen deutlichen Anstieg: Auf rund 120 Hektar Fläche wird
der Maiszünsler (Ostrinia nubilalis), einer der wirtschaftlich relevantesten
Schädlinge in Maisbeständen, im Raum Bayreuth nicht mehr chemisch, sondern
biologisch bekämpft. Möglich machen dies Schlupfwespen. Sie fressen die
Larven des Maiszünslers einfach auf. „Wir sind damit voll auf die
biologische Schiene abgefahren“, sagt Johannes Scherm, dem es auch darum
geht, das Image der Landwirtschaft mit der alternativen
Schädlingsbekämpfungsmethode zu verbessern. .jpg) Schirradorf.
Es muss nicht immer John Deere oder Fendt sein. Eicher zum Beispiel war der
Markenname der bis in die 1990er existierenden Eicher-Traktorenfabrik in
Forstern in Oberbayern. Oder Normag: Das steht für Nordhauser Maschinenbau.
Das Unternehmen aus dem Harz hatte bereits 1957 seine Produktion
eingestellt. Es gibt sie aber noch, die teilweise Jahrzehnte alten Bulldogs
und sie funktionieren auch noch, so wie der Lanz, Baujahr 1958 von Raimund
Schramm von den Traktorfreunden Dankenfeld im unterfränkischen Landkreis
Hassberge oder der McCormick International D430 von Andrea Popp von den
Traktorfreunden Altenplos.
Schirradorf.
Es muss nicht immer John Deere oder Fendt sein. Eicher zum Beispiel war der
Markenname der bis in die 1990er existierenden Eicher-Traktorenfabrik in
Forstern in Oberbayern. Oder Normag: Das steht für Nordhauser Maschinenbau.
Das Unternehmen aus dem Harz hatte bereits 1957 seine Produktion
eingestellt. Es gibt sie aber noch, die teilweise Jahrzehnte alten Bulldogs
und sie funktionieren auch noch, so wie der Lanz, Baujahr 1958 von Raimund
Schramm von den Traktorfreunden Dankenfeld im unterfränkischen Landkreis
Hassberge oder der McCormick International D430 von Andrea Popp von den
Traktorfreunden Altenplos. .jpg) Ältestes
aller teilnehmenden Fahrzeuge war ein Normag aus dem Jahr 1951 mit 17 PS von
Manfred Kolb aus Schirradorf. Ganz aus der Reihe fiel der Unimog, Baujahr
1964 mit 32 PS von Karl Heinz Popp, ebenfalls von den Traktorfreunden
Altenplos. Sie alle schafften nicht nur den gut zwei Kilometer langen
Rundkurs durch das Dorf mit seiner über 20-prozentigen Steigung, sondern
auch die Hin- und Rückfahrt von den Heimatorten ohne Ausfall. Manche
Teilnehmer waren schon früh um acht Uhr losgefahren, um rechtzeitig beim
Oldtimertreffen zu sein.
Ältestes
aller teilnehmenden Fahrzeuge war ein Normag aus dem Jahr 1951 mit 17 PS von
Manfred Kolb aus Schirradorf. Ganz aus der Reihe fiel der Unimog, Baujahr
1964 mit 32 PS von Karl Heinz Popp, ebenfalls von den Traktorfreunden
Altenplos. Sie alle schafften nicht nur den gut zwei Kilometer langen
Rundkurs durch das Dorf mit seiner über 20-prozentigen Steigung, sondern
auch die Hin- und Rückfahrt von den Heimatorten ohne Ausfall. Manche
Teilnehmer waren schon früh um acht Uhr losgefahren, um rechtzeitig beim
Oldtimertreffen zu sein. .jpg) Zweiter
großer Programmpunkt war wie auch in den Vorjahren eine Modenschau. Dort, in
der großen Halle von Edwin Nicklas, wo sonst die schweren Schlepper und
Mähdrescher stehen, hatte Gabis Modestübchen aus Wirsberg alles aufgeboten,
was derzeit angesagt ist. Präsentiert von Amateurmodels und moderiert von
Kreisbäuerin Beate Opel gab es trendige Mode in allen Größen für jeden Typ
und jeden Anlass.
Zweiter
großer Programmpunkt war wie auch in den Vorjahren eine Modenschau. Dort, in
der großen Halle von Edwin Nicklas, wo sonst die schweren Schlepper und
Mähdrescher stehen, hatte Gabis Modestübchen aus Wirsberg alles aufgeboten,
was derzeit angesagt ist. Präsentiert von Amateurmodels und moderiert von
Kreisbäuerin Beate Opel gab es trendige Mode in allen Größen für jeden Typ
und jeden Anlass..jpg)
.jpg)
.jpg) Schwarzenbach
am Wald. „Wir wollen die Forstwirtschaft weiter voranbringen“, sagt Ralf
Kremer. Der Unternehmer aus Steinbach bei Geroldsgrün gehörte zum
Organisationsteam der Frankenwaldtages 2018, der verbunden mit einem
regionalen Waldbesitzertag wieder um die 10000 Besucher nach Schwarzenbach
lockte.
Schwarzenbach
am Wald. „Wir wollen die Forstwirtschaft weiter voranbringen“, sagt Ralf
Kremer. Der Unternehmer aus Steinbach bei Geroldsgrün gehörte zum
Organisationsteam der Frankenwaldtages 2018, der verbunden mit einem
regionalen Waldbesitzertag wieder um die 10000 Besucher nach Schwarzenbach
lockte. .jpg) Josef
Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes sprach vom
Frankenwald als „Hot Spot der nachhaltigen Forstwirtschaft“. Hier werde das
gelebt, was Waldwirtschaft ausmacht. Das sei zum einen Ökologie und
Ökonomie, zum anderen aber auch die Sozialfunktion, indem jeder Bürger ein
Betretungsrecht für den Wald habe. „Damit ist der Wald ein echtes
Multitalent“, so Ziegler. Ein Multitalent, das eben auch Verpflichtungen mit
sich bringt, sagte die bayerische Waldkönigin Johanna Gierl. Natur sei nicht
einfach nur so da, der Mensch müsse schon eingreifen.
Josef
Ziegler, Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes sprach vom
Frankenwald als „Hot Spot der nachhaltigen Forstwirtschaft“. Hier werde das
gelebt, was Waldwirtschaft ausmacht. Das sei zum einen Ökologie und
Ökonomie, zum anderen aber auch die Sozialfunktion, indem jeder Bürger ein
Betretungsrecht für den Wald habe. „Damit ist der Wald ein echtes
Multitalent“, so Ziegler. Ein Multitalent, das eben auch Verpflichtungen mit
sich bringt, sagte die bayerische Waldkönigin Johanna Gierl. Natur sei nicht
einfach nur so da, der Mensch müsse schon eingreifen..jpg) Auf
dem großzügigen Festgelände in Schwarzenbach präsentierten sich Ämter,
Forstzusammenschlüsse und Vereine, Unternehmen der Forstwirtschaft und der
Holzverarbeitung, die Jagdverbände unter anderem mit einem Laser-Schießkino
und verschiedene Kunsthandwerker vom Drechsler bis zum Motorsägenkünstler.
„Forstwirtschaft erleben“ war parallel dazu das Motto eines Waldparcours am
nahen Döbraberg. Hier konnten alle Interessierten sehen, wie Profis im Wald
arbeiten, von der Verjüngung über die Pflege bis hin zur Holzernte. In
verschiedenen Vorträgen ging es unter anderem um die Eiche im Frankenwald,
um nicht heimische Baumarten oder um Ergänzungspflanzungen bei vorhandener
Naturverjüngung.
Auf
dem großzügigen Festgelände in Schwarzenbach präsentierten sich Ämter,
Forstzusammenschlüsse und Vereine, Unternehmen der Forstwirtschaft und der
Holzverarbeitung, die Jagdverbände unter anderem mit einem Laser-Schießkino
und verschiedene Kunsthandwerker vom Drechsler bis zum Motorsägenkünstler.
„Forstwirtschaft erleben“ war parallel dazu das Motto eines Waldparcours am
nahen Döbraberg. Hier konnten alle Interessierten sehen, wie Profis im Wald
arbeiten, von der Verjüngung über die Pflege bis hin zur Holzernte. In
verschiedenen Vorträgen ging es unter anderem um die Eiche im Frankenwald,
um nicht heimische Baumarten oder um Ergänzungspflanzungen bei vorhandener
Naturverjüngung..jpg) Nach
dem Frankenwaldtag 2018 steht das nächste überregionale forstliche
Großereignis in Schwarzenbach am Wald bereits für das kommende Jahr an.
Forstunternehmer Ralf Kremer konnte entscheidend dazu beitragen, dass die
Regionalmeisterschaften der Waldarbeiter vom 21. bis zum 23. Juni 2019
erstmals in Oberfranken stattfinden.
Nach
dem Frankenwaldtag 2018 steht das nächste überregionale forstliche
Großereignis in Schwarzenbach am Wald bereits für das kommende Jahr an.
Forstunternehmer Ralf Kremer konnte entscheidend dazu beitragen, dass die
Regionalmeisterschaften der Waldarbeiter vom 21. bis zum 23. Juni 2019
erstmals in Oberfranken stattfinden..jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg) Schirradorf.
Hetzkampagnen gegen Landwirte hat Albert Deß (CSU), Europaabgeordneter aus
Neumarkt in der Oberpfalz und Agrarsprecher der Europäischen Volkspartei,
scharf verurteilt. Bei den derzeitigen Diskussionen in Deutschland könne man
nur noch den Kopf schütteln, sagte Deß beim Schirradorfer Bauerntag auf dem
Gelände des Landtechnikunternehmens Nicklas.
Schirradorf.
Hetzkampagnen gegen Landwirte hat Albert Deß (CSU), Europaabgeordneter aus
Neumarkt in der Oberpfalz und Agrarsprecher der Europäischen Volkspartei,
scharf verurteilt. Bei den derzeitigen Diskussionen in Deutschland könne man
nur noch den Kopf schütteln, sagte Deß beim Schirradorfer Bauerntag auf dem
Gelände des Landtechnikunternehmens Nicklas..jpg) Das
gleiche Thema hatte sich zuvor der stellvertretende BBV-Kreisobmann Harald
Peetz vorgenommen. „Die Landwirte stehen zu Unrecht am Pranger“, sagte er.
Den meisten Tier- und Naturschutzorganisationen warf Peetz vor, nichts
anderes im Sinn zu haben, als das Ende der konventionellen Tierhaltung.
Dafür würden gutgläubigen Mitbürgern auch noch Spendengelder aus der Tasche
gezogen.
Das
gleiche Thema hatte sich zuvor der stellvertretende BBV-Kreisobmann Harald
Peetz vorgenommen. „Die Landwirte stehen zu Unrecht am Pranger“, sagte er.
Den meisten Tier- und Naturschutzorganisationen warf Peetz vor, nichts
anderes im Sinn zu haben, als das Ende der konventionellen Tierhaltung.
Dafür würden gutgläubigen Mitbürgern auch noch Spendengelder aus der Tasche
gezogen. .jpg) Ein
weiteres Thema des Bauerntages in Schirradorf war die gemeinsame europäische
Agrarpolitik für die neue Förderperiode ab dem Jahr 2020. Leider enthalte
der bislang vorliegende Entwurf viele negative Punkte, sagte der
stellvertretende Kreisobmann. Insbesondere kritisierte Peetz die
Mittelkürzungen zu Lasten der Landwirtschaft aufgrund des Brexit.
„Direktzahlungen müssen unbedingt erhalten bleiben, schließlich steigen ja
auch die Kosten“, so Peetz. Er forderte außerdem eine bessere Unterstützung
für die bäuerlichen Familienbetriebe, für die nicht selten die gesamte
Existenz davon abhängt.
Ein
weiteres Thema des Bauerntages in Schirradorf war die gemeinsame europäische
Agrarpolitik für die neue Förderperiode ab dem Jahr 2020. Leider enthalte
der bislang vorliegende Entwurf viele negative Punkte, sagte der
stellvertretende Kreisobmann. Insbesondere kritisierte Peetz die
Mittelkürzungen zu Lasten der Landwirtschaft aufgrund des Brexit.
„Direktzahlungen müssen unbedingt erhalten bleiben, schließlich steigen ja
auch die Kosten“, so Peetz. Er forderte außerdem eine bessere Unterstützung
für die bäuerlichen Familienbetriebe, für die nicht selten die gesamte
Existenz davon abhängt..jpg) Scheßlitz,
Lks. Bamberg. Mit einem Informationstag ist das neue Waldkompetenzzentrum
nun auch offiziell in Betrieb gegangen. Unter einem Dach sind künftig am
Neumarkt in Scheßlitz neben dem Bereich Forsten des Amtes für
Landwirtschaft, der Waldbesitzervereinigung (WBV) Bamberg, der
Revierverwaltung der Bayerischen Staatsforsten auch die Forstwirtschaftliche
Vereinigung Oberfranken (FVO) und ab Juli der Bayerische Waldbesitzerverband
mit einer Außenstelle vertreten. Mit dieser einmaligen Bündelung an Wald-
und Forstkompetenz könne sich Scheßlitz getrost als Waldhauptstadt Bayerns
bezeichnen, sagte Bürgermeister Roland Kauper.
Scheßlitz,
Lks. Bamberg. Mit einem Informationstag ist das neue Waldkompetenzzentrum
nun auch offiziell in Betrieb gegangen. Unter einem Dach sind künftig am
Neumarkt in Scheßlitz neben dem Bereich Forsten des Amtes für
Landwirtschaft, der Waldbesitzervereinigung (WBV) Bamberg, der
Revierverwaltung der Bayerischen Staatsforsten auch die Forstwirtschaftliche
Vereinigung Oberfranken (FVO) und ab Juli der Bayerische Waldbesitzerverband
mit einer Außenstelle vertreten. Mit dieser einmaligen Bündelung an Wald-
und Forstkompetenz könne sich Scheßlitz getrost als Waldhauptstadt Bayerns
bezeichnen, sagte Bürgermeister Roland Kauper. .jpg) Höhepunkt
des offiziellen Teils war die öffentliche Ehrung von zwei Waldbesitzern, die
sich seit Jahrzehnten um den Wald im Landkreis Bamberg verdient gemacht
haben, durch die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml. Sie
zeichnete Alfred Deinlein aus Neudorf bei Scheßlitz und Walter Beringer aus
Busendorf bei Rattelsdorf mit Urkunden aus.
Höhepunkt
des offiziellen Teils war die öffentliche Ehrung von zwei Waldbesitzern, die
sich seit Jahrzehnten um den Wald im Landkreis Bamberg verdient gemacht
haben, durch die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml. Sie
zeichnete Alfred Deinlein aus Neudorf bei Scheßlitz und Walter Beringer aus
Busendorf bei Rattelsdorf mit Urkunden aus..jpg) Der
zweite Geehrte Walter Beringer war vor 40 Jahren Gründungsmitglied der WBV
Bamberg Nord, ebenfalls ein Vorgänger der heutigen WBV Bamberg. Auch er ist
ein langjähriger Funktionsträger und durch seine unermüdlichen Aktivitäten
weit über den Landkreis hinaus bekannt. Beringer bewirtschaftet 8,3 Hektar
Wald auf zehn Flurstücken, wo er durch den Anbau von Kirsche, Ahorn,
Elsbeere, Lärche und Douglasie ebenfalls klimatolerante Mischbestände
forciert.
Der
zweite Geehrte Walter Beringer war vor 40 Jahren Gründungsmitglied der WBV
Bamberg Nord, ebenfalls ein Vorgänger der heutigen WBV Bamberg. Auch er ist
ein langjähriger Funktionsträger und durch seine unermüdlichen Aktivitäten
weit über den Landkreis hinaus bekannt. Beringer bewirtschaftet 8,3 Hektar
Wald auf zehn Flurstücken, wo er durch den Anbau von Kirsche, Ahorn,
Elsbeere, Lärche und Douglasie ebenfalls klimatolerante Mischbestände
forciert..jpg) Zum
Wohl der Mitglieder profitierten in Scheßlitz alle Beteiligten von den
kurzen Wegen, so der FVO-Vorsitzende Wolfgang Schultheiß. Unter dem Dach der
FVO sind seinen Worten zufolge rund 20000 Mitglieder mit einer Waldfläche
von circa 140000 Hektar zusammengeschlossen. In Scheßlitz sei künftig die
geballte Kompetenz vorhanden, um für die nächsten Jahrzehnte und
Jahrhunderte gewappnet zu sein, sagte die bayerische Waldkönigin Johanna
Gierl.
Zum
Wohl der Mitglieder profitierten in Scheßlitz alle Beteiligten von den
kurzen Wegen, so der FVO-Vorsitzende Wolfgang Schultheiß. Unter dem Dach der
FVO sind seinen Worten zufolge rund 20000 Mitglieder mit einer Waldfläche
von circa 140000 Hektar zusammengeschlossen. In Scheßlitz sei künftig die
geballte Kompetenz vorhanden, um für die nächsten Jahrzehnte und
Jahrhunderte gewappnet zu sein, sagte die bayerische Waldkönigin Johanna
Gierl..jpg) Bayreuth.
Der Rinderzuchtverband Oberfranken hat im zurückliegenden Wirtschaftsjahr seinen
Umsatz von 18,2 auf 18,9 Millionen Euro gesteigert. Die Zahl der vermarkteten
Tiere war von 32600 auf 32799 angestiegen. Diese Zahlen hat der Vorsitzende
Georg Hollfelder bei der Jahresversammlung der Kreiszuchtgenossenschaft und des
Milcherzeugerrings Bayreuth genannt. Das Wirtschaftsjahr endet bei den
Rinderzüchtern am 30. September.
Bayreuth.
Der Rinderzuchtverband Oberfranken hat im zurückliegenden Wirtschaftsjahr seinen
Umsatz von 18,2 auf 18,9 Millionen Euro gesteigert. Die Zahl der vermarkteten
Tiere war von 32600 auf 32799 angestiegen. Diese Zahlen hat der Vorsitzende
Georg Hollfelder bei der Jahresversammlung der Kreiszuchtgenossenschaft und des
Milcherzeugerrings Bayreuth genannt. Das Wirtschaftsjahr endet bei den
Rinderzüchtern am 30. September..jpg) Die
Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer (CSU) hob in ihrem Grußwort hervor,
dass der Aufschlag von 15,3 Millionen Euro im Nachtragshaushalt den Stellenwert
bäuerlicher Leistungsanerkennung deutlich mache. Als Beispiele für die
Fortentwicklung des Bayerischen Weges nannte sie das nun umfassendere
KULAP-Paket, das Bayerische Sonderprogramm Landwirtschaft sowie die
erfolgreiche Bio-Regio-Strategie.
Die
Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer (CSU) hob in ihrem Grußwort hervor,
dass der Aufschlag von 15,3 Millionen Euro im Nachtragshaushalt den Stellenwert
bäuerlicher Leistungsanerkennung deutlich mache. Als Beispiele für die
Fortentwicklung des Bayerischen Weges nannte sie das nun umfassendere
KULAP-Paket, das Bayerische Sonderprogramm Landwirtschaft sowie die
erfolgreiche Bio-Regio-Strategie. Würnsreuth.
Was vor gut drei Jahrzehnten mit drei Ziegen und einer Schubkarre begann, hat
sich mittlerweile zu einer handwerklichen Ziegenkäsemanufaktur mit einer
Jahresproduktion von rund 50 Tonnen entwickelt. Um sich ausnahmslos auf die
Käseherstellung konzentrieren zu können, hatte er die Ziegenhaltung vor einigen
Jahren aufgegeben, sagt Robert Knöbel vom Ziegenhof Würnsreuth, wenige Kilometer
östlich von Bayreuth. Um die ständig steigende Nachfrage nach seinen Produkten
decken zu können, sucht er im Moment händeringend neue Ziegenmilchlieferanten.
Würnsreuth.
Was vor gut drei Jahrzehnten mit drei Ziegen und einer Schubkarre begann, hat
sich mittlerweile zu einer handwerklichen Ziegenkäsemanufaktur mit einer
Jahresproduktion von rund 50 Tonnen entwickelt. Um sich ausnahmslos auf die
Käseherstellung konzentrieren zu können, hatte er die Ziegenhaltung vor einigen
Jahren aufgegeben, sagt Robert Knöbel vom Ziegenhof Würnsreuth, wenige Kilometer
östlich von Bayreuth. Um die ständig steigende Nachfrage nach seinen Produkten
decken zu können, sucht er im Moment händeringend neue Ziegenmilchlieferanten..jpg) Bergnersreuth.
„Wir wollen der Öffentlichkeit zeigen, was die Maispflanze alles zu
bieten hat“, sagt Reinhold Wunderlich. Er ist der Leiter des
Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit beim BBV Wunsiedel und war auch
in diesem Jahr wieder federführend tätig beim Aufbau des
Mais-Irrgartens am Volkskundlichen Gerätemuseum
Arzberg-Bergnersreuth.
Bergnersreuth.
„Wir wollen der Öffentlichkeit zeigen, was die Maispflanze alles zu
bieten hat“, sagt Reinhold Wunderlich. Er ist der Leiter des
Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit beim BBV Wunsiedel und war auch
in diesem Jahr wieder federführend tätig beim Aufbau des
Mais-Irrgartens am Volkskundlichen Gerätemuseum
Arzberg-Bergnersreuth..jpg) Wie
Reinhold Wunderlich erklärte, soll der Mais-Irrgarten aber nicht nur
eine Ferienattraktion für Jung und Alt sein, der Irrgarten soll auch
das Image der Maispflanze verbessern. „Mais bringt die größte
Ertragsleistung pro Hektar, egal ob als Futter- oder als
Energiepflanze“, sagt Wunderlich und verweist auf den relativ
geringen Pflanzenschutzaufwand und den guten Vorfruchtwert.
Wie
Reinhold Wunderlich erklärte, soll der Mais-Irrgarten aber nicht nur
eine Ferienattraktion für Jung und Alt sein, der Irrgarten soll auch
das Image der Maispflanze verbessern. „Mais bringt die größte
Ertragsleistung pro Hektar, egal ob als Futter- oder als
Energiepflanze“, sagt Wunderlich und verweist auf den relativ
geringen Pflanzenschutzaufwand und den guten Vorfruchtwert.  Neufang.
Gut zur Hälfte ist die Ernte in Oberfranken abgeschlossen, deutlich früher als
in den vergangenen Jahren. Schuld daran ist die Witterung, die von den
Landwirten einiges abverlangt hat. „Das trockene Franken ist heuer noch etwas
trockener gewesen“, sagte der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif. In
einer ersten Bilanz kommt der Bauernverband auf zufriedenstellende Erträge bei
den meisten Feldfrüchten. Die wirtschaftliche Situation bei den Bauern ist
dagegen wesentlich schlechter. „Wir sind teilweise weit weg von einer
Kostendeckung oder gar von Gewinnen“, sagte Greif in Neufang bei Wirsberg auf
dem Betrieb der Kulmbacher Kreisbäuerin Beate Opel.
Neufang.
Gut zur Hälfte ist die Ernte in Oberfranken abgeschlossen, deutlich früher als
in den vergangenen Jahren. Schuld daran ist die Witterung, die von den
Landwirten einiges abverlangt hat. „Das trockene Franken ist heuer noch etwas
trockener gewesen“, sagte der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif. In
einer ersten Bilanz kommt der Bauernverband auf zufriedenstellende Erträge bei
den meisten Feldfrüchten. Die wirtschaftliche Situation bei den Bauern ist
dagegen wesentlich schlechter. „Wir sind teilweise weit weg von einer
Kostendeckung oder gar von Gewinnen“, sagte Greif in Neufang bei Wirsberg auf
dem Betrieb der Kulmbacher Kreisbäuerin Beate Opel.
 Pottenstein,
Lks. Bayreuth. Trotz Facebook und Globalisierung: Urlaub auf dem Bauernhof ist
kein Auslaufmodell. „Im Gegenteil“, sagt Susanne Warlimont, Geschäftsführerin
des Landesverbandes Urlaub auf dem Bauernhof mit Sitz in München. Natur,
Gesundheit, Regionalität und Nachhaltigkeit, all das seien Trends, die der
Bauernhofurlaub auffängt. Von einem Vorurteil, das noch in vielen Köpfen
herumgeistert, müsse sich der Gast allerdings verabschieden: „Urlaub auf dem
Bauernhof ist kein Billigurlaub“, so die Sprecherin beim Bauerntag in
Pottenstein.
Pottenstein,
Lks. Bayreuth. Trotz Facebook und Globalisierung: Urlaub auf dem Bauernhof ist
kein Auslaufmodell. „Im Gegenteil“, sagt Susanne Warlimont, Geschäftsführerin
des Landesverbandes Urlaub auf dem Bauernhof mit Sitz in München. Natur,
Gesundheit, Regionalität und Nachhaltigkeit, all das seien Trends, die der
Bauernhofurlaub auffängt. Von einem Vorurteil, das noch in vielen Köpfen
herumgeistert, müsse sich der Gast allerdings verabschieden: „Urlaub auf dem
Bauernhof ist kein Billigurlaub“, so die Sprecherin beim Bauerntag in
Pottenstein..jpg) Alle
Beteiligten, Amprion genauso wie die Bundesnetzagentur, bestätigen immer wieder,
dass das Verfahren zur exakten Trassenfindung mit größtmöglicher Transparenz
durchgeführt werden soll. Doch genau da setzt die Kritik der Trassengegner, in
der Regel Bürger aus den betroffenen Kommunen, an. Er habe aus der Zeitung von
der geplanten Trasse erfahren, sagt Oliver Bär (CSU) aus Berg bei Hof. Der
Rechtsanwalt und Landratskandidat seiner Partei sieht gute Möglichkeiten, gegen
die Trasse vorzugehen.
Alle
Beteiligten, Amprion genauso wie die Bundesnetzagentur, bestätigen immer wieder,
dass das Verfahren zur exakten Trassenfindung mit größtmöglicher Transparenz
durchgeführt werden soll. Doch genau da setzt die Kritik der Trassengegner, in
der Regel Bürger aus den betroffenen Kommunen, an. Er habe aus der Zeitung von
der geplanten Trasse erfahren, sagt Oliver Bär (CSU) aus Berg bei Hof. Der
Rechtsanwalt und Landratskandidat seiner Partei sieht gute Möglichkeiten, gegen
die Trasse vorzugehen. Himmelkron.
Wenn es so weiter geht mit dem Flächenfraß und wenn die Auflagen auch künftig so
zunehmen, dann befürchtet der BBV nicht nur in Oberfranken einen „Strukturwandel
durch die Hintertür“. Als Grund dafür nannten der oberfränkische BBV-Präsident
Hermann Greiff und Direktor Wilhelm Böhmer vor der Presse in Himmelkron die
Tatsache, dass vor allem die vielen kleinen Betriebe, die meist im Nebenerwerb
bewirtschaftet werden, von den Auflagen extrem betroffen sind.
Himmelkron.
Wenn es so weiter geht mit dem Flächenfraß und wenn die Auflagen auch künftig so
zunehmen, dann befürchtet der BBV nicht nur in Oberfranken einen „Strukturwandel
durch die Hintertür“. Als Grund dafür nannten der oberfränkische BBV-Präsident
Hermann Greiff und Direktor Wilhelm Böhmer vor der Presse in Himmelkron die
Tatsache, dass vor allem die vielen kleinen Betriebe, die meist im Nebenerwerb
bewirtschaftet werden, von den Auflagen extrem betroffen sind..jpg) Oberalbach,
Lks. Erlangen-Höchstadt. Vier Millionen Christbäume werden pro Jahr in
Bayern benötigt, doch nur die Hälfte stammt auch aus dem Freistaat. Da ist
noch einiges an Überzeugungsarbeit notwendig, um die Verbraucher auf die
heimischen Bäume hinzuweisen. Ein Teil dieser Überzeugungsarbeit ist die
alljährliche werbewirksame Eröffnung der bayerischen Christbaumsaison,
diesmal mitten in den riesigen Christbaumkulturen des Betriebs Rippel-Beßler
im mittelfränkischen Oberalbach bei Wachenroth.
Oberalbach,
Lks. Erlangen-Höchstadt. Vier Millionen Christbäume werden pro Jahr in
Bayern benötigt, doch nur die Hälfte stammt auch aus dem Freistaat. Da ist
noch einiges an Überzeugungsarbeit notwendig, um die Verbraucher auf die
heimischen Bäume hinzuweisen. Ein Teil dieser Überzeugungsarbeit ist die
alljährliche werbewirksame Eröffnung der bayerischen Christbaumsaison,
diesmal mitten in den riesigen Christbaumkulturen des Betriebs Rippel-Beßler
im mittelfränkischen Oberalbach bei Wachenroth..jpg) Thomas
Emslander, Vorsitzender des Vereins der Bayerischen Christbaumanbauer aus
Ergolding, lobt die spezielle Nadelhaltbarkeit heimischer Bäume, die während
einer Mondphase gefällt werden. Bäume, die erst kurz vor dem Fest
geschnitten werden, müssten nicht zwangsläufig auch am längsten halten, so
Emslander. Er sprach von einem guten Jahr für die Christbaumanbauer, vor
allem, weil es keine Spätfröste gegeben habe. Spätfröste seien das
Schlimmste für Christbäume, Trockenheit sei dagegen kein großes Problem, das
halte der Baum meist besser aus als der Mensch.
Thomas
Emslander, Vorsitzender des Vereins der Bayerischen Christbaumanbauer aus
Ergolding, lobt die spezielle Nadelhaltbarkeit heimischer Bäume, die während
einer Mondphase gefällt werden. Bäume, die erst kurz vor dem Fest
geschnitten werden, müssten nicht zwangsläufig auch am längsten halten, so
Emslander. Er sprach von einem guten Jahr für die Christbaumanbauer, vor
allem, weil es keine Spätfröste gegeben habe. Spätfröste seien das
Schlimmste für Christbäume, Trockenheit sei dagegen kein großes Problem, das
halte der Baum meist besser aus als der Mensch..jpg) Brunner
zufolge entscheiden sich fast drei Viertel aller Verbraucher in Bayern für
eine Nordmanntanne, gefolgt von der Blaufichte. Aber auch Exoten, wie etwa
die Korktanne seien auf dem Vormarsch. Nicht ganz so der Renner sei dagegen
die heimische Tanne. Gute Nachrichten für den Verbraucher hatte der Minister
auch im Gepäck: so sollen die Endpreise stabil bei 18 bis 22 Euro pro Meter
bleiben.
Brunner
zufolge entscheiden sich fast drei Viertel aller Verbraucher in Bayern für
eine Nordmanntanne, gefolgt von der Blaufichte. Aber auch Exoten, wie etwa
die Korktanne seien auf dem Vormarsch. Nicht ganz so der Renner sei dagegen
die heimische Tanne. Gute Nachrichten für den Verbraucher hatte der Minister
auch im Gepäck: so sollen die Endpreise stabil bei 18 bis 22 Euro pro Meter
bleiben. Thüngfeld.
Teichwirt Johannes Weiner ist zufrieden. Seine Helfer holen gerade echte
Prachtexemplare aus den neuen Teichen in Thüngfeld bei Schlüsselfeld im
Landkreis Bamberg. Drei Pfund dürfte so ein Karpfen haben. Kein Wunder,
obwohl das Wetter in diesem Jahr absolut zweigeteilt, zuerst kühl und
regnerisch, dann sonnig und heiß, war, dauert es doch drei Jahre, bis der
Karpfen heranwächst.
Thüngfeld.
Teichwirt Johannes Weiner ist zufrieden. Seine Helfer holen gerade echte
Prachtexemplare aus den neuen Teichen in Thüngfeld bei Schlüsselfeld im
Landkreis Bamberg. Drei Pfund dürfte so ein Karpfen haben. Kein Wunder,
obwohl das Wetter in diesem Jahr absolut zweigeteilt, zuerst kühl und
regnerisch, dann sonnig und heiß, war, dauert es doch drei Jahre, bis der
Karpfen heranwächst. Altenreuth,
Lks. Kulmbach. Erst zu kühl, zu feucht, zu wenig Sonne und dann die knallige
Hitze ohne Niederschläge: die oberfränkischen Bauern befürchten in diesem Jahr
Ernteeinbußen von durchschnittlich bis zu 25 Prozent.
Altenreuth,
Lks. Kulmbach. Erst zu kühl, zu feucht, zu wenig Sonne und dann die knallige
Hitze ohne Niederschläge: die oberfränkischen Bauern befürchten in diesem Jahr
Ernteeinbußen von durchschnittlich bis zu 25 Prozent. Wonsees.
Eine flächendeckende Landbewirtschaftung muss auch in Zukunft möglich sein. Das
ist das oberste Anliegen von Bauern und Politikern zugleich. Bei einem Besuch
von Bundesagrarministerin Ilse Aigner am Montagabend auf dem Betrieb der Familie
Schleicher in Schlötzmühle bei Wonsees ging es aber auch um ganz aktuelle und
handfeste Themen, wie umstrittene Stallneubauten in Oberfranken oder die
manchmal recht einseitige Tierschutzdebatte.
Wonsees.
Eine flächendeckende Landbewirtschaftung muss auch in Zukunft möglich sein. Das
ist das oberste Anliegen von Bauern und Politikern zugleich. Bei einem Besuch
von Bundesagrarministerin Ilse Aigner am Montagabend auf dem Betrieb der Familie
Schleicher in Schlötzmühle bei Wonsees ging es aber auch um ganz aktuelle und
handfeste Themen, wie umstrittene Stallneubauten in Oberfranken oder die
manchmal recht einseitige Tierschutzdebatte..jpg) Neuhof.
Drei Erfolgsfaktoren sind es nach den Worten von Anton Hepple, dem Leiter
des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken in Bamberg, mit denen die
Akzeptanz von Windrädern erreicht wird: die Einwohner müssen in den Prozess
von Anfang an eingebunden werden, ein ausreichender Abstand der Anlagen zur
Wohnbebauung muss gegeben sein und die Ortschaft darf nicht von Windrädern
umzingelt werden.
Neuhof.
Drei Erfolgsfaktoren sind es nach den Worten von Anton Hepple, dem Leiter
des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken in Bamberg, mit denen die
Akzeptanz von Windrädern erreicht wird: die Einwohner müssen in den Prozess
von Anfang an eingebunden werden, ein ausreichender Abstand der Anlagen zur
Wohnbebauung muss gegeben sein und die Ortschaft darf nicht von Windrädern
umzingelt werden..jpg) In
diese Situation kam ein Anruf der Firma SoWiTec beim Vorsitzenden der
Teilnehmergemeinschaft. Der namhafte Windkraft-Projektentwickler und
Betreiber aus Baden-Württemberg wollte in Neuhof einen Windpark realisieren
und dazu Nutzungsverträge mit den Grundeigentümern abschließen und
Entschädigungen auszahlen. „Da ist das Thema hochgekocht, und wir wussten,
dass wie reagieren mussten“, erinnert sich Robert Büdel. Er und sein
Vorstand fürchteten nun um die Weiterführung der Flurneuordnung. Wohl nicht
zu Unrecht bestand die Sorge, dass die Grundeigentümer nun an kleinen
Einlageflächen festhalten würden und die im Interesse der Landwirtschaft
stehende Flächenzusammenlegung behindern wird. Weiteres Problem war, dass
die neue Situation bei der durchgeführten Wertermittlung natürlich nicht
berücksichtigt war. „Wir befürchteten, dass sich insgesamt in der Ortschaft
ein Spannungsfeld Pro und Contra Windkraft aufbaut“, so Robert Büdel.
In
diese Situation kam ein Anruf der Firma SoWiTec beim Vorsitzenden der
Teilnehmergemeinschaft. Der namhafte Windkraft-Projektentwickler und
Betreiber aus Baden-Württemberg wollte in Neuhof einen Windpark realisieren
und dazu Nutzungsverträge mit den Grundeigentümern abschließen und
Entschädigungen auszahlen. „Da ist das Thema hochgekocht, und wir wussten,
dass wie reagieren mussten“, erinnert sich Robert Büdel. Er und sein
Vorstand fürchteten nun um die Weiterführung der Flurneuordnung. Wohl nicht
zu Unrecht bestand die Sorge, dass die Grundeigentümer nun an kleinen
Einlageflächen festhalten würden und die im Interesse der Landwirtschaft
stehende Flächenzusammenlegung behindern wird. Weiteres Problem war, dass
die neue Situation bei der durchgeführten Wertermittlung natürlich nicht
berücksichtigt war. „Wir befürchteten, dass sich insgesamt in der Ortschaft
ein Spannungsfeld Pro und Contra Windkraft aufbaut“, so Robert Büdel.
 Ebermannstadt.
Kleine Klassen, persönliche Betreuung und individuelle Förderung: an der
Privaten Fachoberschule Fränkische Schweiz in Ebermannstadt (Landkreis
Forchheim) haben die Schüler gerade die Fachabiturprüfungen hinter sich
gebracht. Darunter erstmals auch sechs junge Leute zwischen 18 und 23 Jahren im
Fachbereich Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie.
Ebermannstadt.
Kleine Klassen, persönliche Betreuung und individuelle Förderung: an der
Privaten Fachoberschule Fränkische Schweiz in Ebermannstadt (Landkreis
Forchheim) haben die Schüler gerade die Fachabiturprüfungen hinter sich
gebracht. Darunter erstmals auch sechs junge Leute zwischen 18 und 23 Jahren im
Fachbereich Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie. Muggendorf,
Lks. Forchheim. Sobald es draußen wärmer ist, werden der Grill
entstaubt, die Gartenstühle aufgebaut, die Salate zubereitet,
Familie und Freunde eingeladen. Beim Grillen sind die deutschen
Weltmeister. Wenn es aber um das Grillgut geht, dann hört der
Einfallsreichtum schnell auf. Steaks. Bratwürste, allenfalls noch
Gemüse. „Warum nicht auch heimischen Süßwasserfisch“, hat sich die
Teichgenossenschaft Oberfranken schon vor Jahren gedacht. Seitdem
wird die Fischgrillsaison Anfang Mai eröffnet und der Absatz
werbewirksam angekurbelt.
Muggendorf,
Lks. Forchheim. Sobald es draußen wärmer ist, werden der Grill
entstaubt, die Gartenstühle aufgebaut, die Salate zubereitet,
Familie und Freunde eingeladen. Beim Grillen sind die deutschen
Weltmeister. Wenn es aber um das Grillgut geht, dann hört der
Einfallsreichtum schnell auf. Steaks. Bratwürste, allenfalls noch
Gemüse. „Warum nicht auch heimischen Süßwasserfisch“, hat sich die
Teichgenossenschaft Oberfranken schon vor Jahren gedacht. Seitdem
wird die Fischgrillsaison Anfang Mai eröffnet und der Absatz
werbewirksam angekurbelt..jpg) Betzenstein,
Lks. Bayreuth. „Die kleine Stadt ist zum echten Kleinod geworden.“
Landwirtschaftsminister Helmut Brunner hatte sich trotz der widrigen
Witterung viel Zeit genommen, um die Dorferneuerungsmaßnahmen in
Betzenstein zu besichtigen. 3,6 Millionen Euro wurden bisher in
einem ersten Bauabschnitt investiert, weitere 1,3 Millionen Euro
sollen bis Ende 2014 im zweiten Bauabschnitt folgen. Den
Förderbescheid über die Hälfte, also über 650000 Euro überreichte
Brunner am Ende seines Rundgangs an Bürgermeister Claus Meyer. Die
Federführung der Dorferneuerung Betzenstein liegt beim Amt für
ländliche Entwicklung Oberfranken.
Betzenstein,
Lks. Bayreuth. „Die kleine Stadt ist zum echten Kleinod geworden.“
Landwirtschaftsminister Helmut Brunner hatte sich trotz der widrigen
Witterung viel Zeit genommen, um die Dorferneuerungsmaßnahmen in
Betzenstein zu besichtigen. 3,6 Millionen Euro wurden bisher in
einem ersten Bauabschnitt investiert, weitere 1,3 Millionen Euro
sollen bis Ende 2014 im zweiten Bauabschnitt folgen. Den
Förderbescheid über die Hälfte, also über 650000 Euro überreichte
Brunner am Ende seines Rundgangs an Bürgermeister Claus Meyer. Die
Federführung der Dorferneuerung Betzenstein liegt beim Amt für
ländliche Entwicklung Oberfranken..jpg) Mittlerweile
im Besitz der Stadt sollen im Maasen-Haus künftig die Tourismus
Information, eine Bücherei und ein Trauungszimmer eingerichtet
werden. Das Besondere an dem denkmalgeschütztem Gebäude war es, dass
in der Vergangenheit Mensch und Tier hier ganz eng beieinander
gelebt hätten. Während im Erdgeschoss die Stallungen waren seien im
ersten Stock die Wohn- und Schlafräume gewesen. „Eine derartige
Konstellation mitten im Ort ist sehr selten“, so Architekt Manfred
Witt.
Mittlerweile
im Besitz der Stadt sollen im Maasen-Haus künftig die Tourismus
Information, eine Bücherei und ein Trauungszimmer eingerichtet
werden. Das Besondere an dem denkmalgeschütztem Gebäude war es, dass
in der Vergangenheit Mensch und Tier hier ganz eng beieinander
gelebt hätten. Während im Erdgeschoss die Stallungen waren seien im
ersten Stock die Wohn- und Schlafräume gewesen. „Eine derartige
Konstellation mitten im Ort ist sehr selten“, so Architekt Manfred
Witt. Himmelkron. Das „Grüne Band“ bereitet Fischern und Teichwirten
Kopfzerbrechen. Ursprünglich als harmloser Streifen für den
Naturschutz entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze gedacht,
sollen nun Korridore in einer Entfernung von bis zu 25 Kilometern
einbezogen werden. Viele Teichwirte könnten davon betroffen sein,
warnte Otto Norbert Grußka, Geschäftsführer der Teichgenossenschaft
Oberfranken.
Himmelkron. Das „Grüne Band“ bereitet Fischern und Teichwirten
Kopfzerbrechen. Ursprünglich als harmloser Streifen für den
Naturschutz entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze gedacht,
sollen nun Korridore in einer Entfernung von bis zu 25 Kilometern
einbezogen werden. Viele Teichwirte könnten davon betroffen sein,
warnte Otto Norbert Grußka, Geschäftsführer der Teichgenossenschaft
Oberfranken. Bayreuth.
„Regionalität ist keine Modeerscheinung, sondern ein langfristiger Trend,
deshalb lohnt es sich auch, zu investieren.“ Diese klare Handlungsempfehlung
gibt Nicole Weik vom Bundesverband der Regionalbewegung mit Sitz in Feuchtwangen
allen landwirtschaftlichen Direktvermarktern mit auf dem Weg. Die Sprecherin
warnt aber auch vor schwarzen Schafen in der Branche: „Es gibt viele, die auf
regional machen wollen, obwohl gar keine Regionalität dahinter steckt.“ Allen
potentiellen Direktvermarktern empfiehlt sie deshalb, sich klar von den
„Scheinregionalen“ abzugrenzen, um keinen Imageverlust zu erleiden. Außerdem
kritisiert Nicole Weik die schwammigen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Sachen
regionale Lebensmittel.
Bayreuth.
„Regionalität ist keine Modeerscheinung, sondern ein langfristiger Trend,
deshalb lohnt es sich auch, zu investieren.“ Diese klare Handlungsempfehlung
gibt Nicole Weik vom Bundesverband der Regionalbewegung mit Sitz in Feuchtwangen
allen landwirtschaftlichen Direktvermarktern mit auf dem Weg. Die Sprecherin
warnt aber auch vor schwarzen Schafen in der Branche: „Es gibt viele, die auf
regional machen wollen, obwohl gar keine Regionalität dahinter steckt.“ Allen
potentiellen Direktvermarktern empfiehlt sie deshalb, sich klar von den
„Scheinregionalen“ abzugrenzen, um keinen Imageverlust zu erleiden. Außerdem
kritisiert Nicole Weik die schwammigen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Sachen
regionale Lebensmittel..jpg) Stiebarlimbach.
Gute Nachricht für alle Oberfränkischen Feinschmecker: Ab sofort gibt es in
allen Monaten mit dem Buchstaben „r“ im Namen wieder fangfrischen Karpfen
aus heimischen Teichen. „Das Karpfenjahr war hervorragend“, sagte der
Vorsitzende der Teichgenossenschaft Oberfranken, Dr. Peter Thoma aus
Thiersheim, bei der oberfränkischen Karpfensaisoneröffnung in Stiebarlimbach
bei Hallerndorf im Landkreis Forchheim. Bedingt durch das Wetter seien die
Karpfen in bester Qualität herangewachsen. Nach Mittelfranken und der
Oberpfalz gilt der Regierungsbezirk Oberfranken als drittstärkster
Karpfenproduzent in Bayern.
Stiebarlimbach.
Gute Nachricht für alle Oberfränkischen Feinschmecker: Ab sofort gibt es in
allen Monaten mit dem Buchstaben „r“ im Namen wieder fangfrischen Karpfen
aus heimischen Teichen. „Das Karpfenjahr war hervorragend“, sagte der
Vorsitzende der Teichgenossenschaft Oberfranken, Dr. Peter Thoma aus
Thiersheim, bei der oberfränkischen Karpfensaisoneröffnung in Stiebarlimbach
bei Hallerndorf im Landkreis Forchheim. Bedingt durch das Wetter seien die
Karpfen in bester Qualität herangewachsen. Nach Mittelfranken und der
Oberpfalz gilt der Regierungsbezirk Oberfranken als drittstärkster
Karpfenproduzent in Bayern..jpg) „Heimischer
Karpfen ist ein reines Naturprodukt, das seit Jahrhunderten nahezu
unverändert erzeugt wird“, so der oberfränkische Bezirkstagspräsident Dr.
Günther Denzler. Bevor die Teiche abgefischt werden, müssten die Karpfen
drei Jahre lang heranwachsen. Während dieser Zeit ernährten sie sich
ausschließlich von Plankton und anderen Kleinlebewesen. Zugefüttert werden
müsse lediglich Getreide, das in Oberfranken meist aus eigener Erzeugung der
Teichwirte stammt. „Damit ist der Karpfen ein artgerechtes und
naturverträgliches Erzeugnis“, sagte Denzler. Doch damit nicht genug:
Rechnerisch stünden stehe jedem oberfränkischen Karpfen rund 20000 Liter
Wasser als Lebensraum zur Verfügung. „Das sind paradiesische Zustände“, so
der Präsident. Schließlich werde der Karpfen auch älter, als jedes andere
landwirtschaftliche Nutztier.
„Heimischer
Karpfen ist ein reines Naturprodukt, das seit Jahrhunderten nahezu
unverändert erzeugt wird“, so der oberfränkische Bezirkstagspräsident Dr.
Günther Denzler. Bevor die Teiche abgefischt werden, müssten die Karpfen
drei Jahre lang heranwachsen. Während dieser Zeit ernährten sie sich
ausschließlich von Plankton und anderen Kleinlebewesen. Zugefüttert werden
müsse lediglich Getreide, das in Oberfranken meist aus eigener Erzeugung der
Teichwirte stammt. „Damit ist der Karpfen ein artgerechtes und
naturverträgliches Erzeugnis“, sagte Denzler. Doch damit nicht genug:
Rechnerisch stünden stehe jedem oberfränkischen Karpfen rund 20000 Liter
Wasser als Lebensraum zur Verfügung. „Das sind paradiesische Zustände“, so
der Präsident. Schließlich werde der Karpfen auch älter, als jedes andere
landwirtschaftliche Nutztier. Gößmannsreuth.
Eine durchschnittliche Ernte, gute Preise aber nicht unbedingt höhere Gewinne:
Die oberfränkischen Landwirte blicken zur Erntehalbzeit mit gemischten Gefühlen
nach vorne. Während Wetterkapriolen längst an der Tagesordnung sind,
bezeichneten der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif und BBV-Direktor Dr.
Wilhelm Böhmer bei einem Ortstermin auf dem Hof von Gerhard Reif in
Gößmannsreuth bei Kulmbach die extrem gestiegenen Produktionskosten als größtes
Problem.
Gößmannsreuth.
Eine durchschnittliche Ernte, gute Preise aber nicht unbedingt höhere Gewinne:
Die oberfränkischen Landwirte blicken zur Erntehalbzeit mit gemischten Gefühlen
nach vorne. Während Wetterkapriolen längst an der Tagesordnung sind,
bezeichneten der oberfränkische BBV-Präsident Hermann Greif und BBV-Direktor Dr.
Wilhelm Böhmer bei einem Ortstermin auf dem Hof von Gerhard Reif in
Gößmannsreuth bei Kulmbach die extrem gestiegenen Produktionskosten als größtes
Problem..jpg) Selb. Mit dem Prädikat „Kulturgut“ sind die
„Markgrafenteiche“ in Selb ausgezeichnet worden. Die Anlage könne
auf eine über 500 Jahre alte Geschichte zurückblicken, begründete
Dr. Peter Thoma, Vorsitzender der Teichgenossenschaft Oberfranken,
die Auszeichnung.
Selb. Mit dem Prädikat „Kulturgut“ sind die
„Markgrafenteiche“ in Selb ausgezeichnet worden. Die Anlage könne
auf eine über 500 Jahre alte Geschichte zurückblicken, begründete
Dr. Peter Thoma, Vorsitzender der Teichgenossenschaft Oberfranken,
die Auszeichnung..jpg) Die
Entstehung der „Markgrafenteiche“ geht nachweislich bis in das 15.
Jahrhundert zurück. Bereits zwischen 1412 und 1414 fiel das Gebiet
um Selb, und damit auch die Teichflächen, der späteren
Markgrafschaft Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth zu. Kurios mutet die
Tatsache an, dass Markgraf Christian Ernst mit den Erträgen aus den
Gütern in Selb und damit auch aus den Markgrafenteichen dazu
benutzte, um das von ihm gestiftete Gymnasium Christian Ernestinum
in Bayreuth zu finanzieren. Der spätere Markgraf Friedrich, Gemahl
der berühmten Markgräfin Wilhelmine, finanzierte wiederum mit den
Einkünften aus den Selber Kammergütern die Gründung der Universität
Erlangen.
Die
Entstehung der „Markgrafenteiche“ geht nachweislich bis in das 15.
Jahrhundert zurück. Bereits zwischen 1412 und 1414 fiel das Gebiet
um Selb, und damit auch die Teichflächen, der späteren
Markgrafschaft Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth zu. Kurios mutet die
Tatsache an, dass Markgraf Christian Ernst mit den Erträgen aus den
Gütern in Selb und damit auch aus den Markgrafenteichen dazu
benutzte, um das von ihm gestiftete Gymnasium Christian Ernestinum
in Bayreuth zu finanzieren. Der spätere Markgraf Friedrich, Gemahl
der berühmten Markgräfin Wilhelmine, finanzierte wiederum mit den
Einkünften aus den Selber Kammergütern die Gründung der Universität
Erlangen..jpg) Landrat
Karl Döhler bezeichnete die Markgrafenteiche nicht nur als größte
Teiche im Landkreis Wunsiedel, sondern auch als echte Schmuckstücke
und als Musterbeispiel für den Einklang von Ökologie und Ökonomie.
Der Oberbürgermeister von Selb Wolfgang Kreil erinnerte daran, dass
die Markgrafenteiche direkt an die historische Verbindungstrasse von
Selb nach Eger angrenzen. Was heute ein verträumter Waldweg ist, sei
früher eine bedeutende Verbindung gewesen, die während des
30-Jährigen Krieges an die 60000 Soldaten durchzogen.
Landrat
Karl Döhler bezeichnete die Markgrafenteiche nicht nur als größte
Teiche im Landkreis Wunsiedel, sondern auch als echte Schmuckstücke
und als Musterbeispiel für den Einklang von Ökologie und Ökonomie.
Der Oberbürgermeister von Selb Wolfgang Kreil erinnerte daran, dass
die Markgrafenteiche direkt an die historische Verbindungstrasse von
Selb nach Eger angrenzen. Was heute ein verträumter Waldweg ist, sei
früher eine bedeutende Verbindung gewesen, die während des
30-Jährigen Krieges an die 60000 Soldaten durchzogen. Lehen.
Die neue Imagekampagne des Bauernverbandes zeigt die Landwirtschaft so, wie sie
wirklich ist. Bayreuths Kreisbäuerin Katrin Lang ist begeistert von den
großflächigen Plakaten, die authentische Bilder aus der täglichen Arbeit mit
witzigen und ungewöhnlichen Schlagworten („Herzblatt“, „Sahneschnitten“, „Frauenversteher“)
kombinieren. Künftig sollen die Motive nicht nur als Postkarten und Poster die
Runde machen, sondern ganz groß auf möglichst vielen Scheunen und bäuerlichen
Anwesen im Bayreuther Landkreis zu finden sein.
Lehen.
Die neue Imagekampagne des Bauernverbandes zeigt die Landwirtschaft so, wie sie
wirklich ist. Bayreuths Kreisbäuerin Katrin Lang ist begeistert von den
großflächigen Plakaten, die authentische Bilder aus der täglichen Arbeit mit
witzigen und ungewöhnlichen Schlagworten („Herzblatt“, „Sahneschnitten“, „Frauenversteher“)
kombinieren. Künftig sollen die Motive nicht nur als Postkarten und Poster die
Runde machen, sondern ganz groß auf möglichst vielen Scheunen und bäuerlichen
Anwesen im Bayreuther Landkreis zu finden sein..jpg) Schirradorf.
„Man hatte schon mal das Gefühl, dass alles bergab geht“, sagt Edwin Nicklas,
Inhaber und Geschäftsleiter des Unternehmens Landtechnik Nicklas in Schirradorf
im Landkreis Kulmbach. Doch seit einiger Zeit habe seine Branche allen Grund,
wieder optimistisch in die Zukunft zu blicken. „Die Stimmung ist positiv und das
Image ganz gut“, so Nicklas. Er ist der festen Überzeugung, dass die
Landwirtschaft in unseren Breiten und somit auch die Landtechnik Zukunft haben.
Klimawandel, ein weltweites Bevölkerungswachstum, andere Ernährungsgewohnheiten
und die Energiewende, das alles sind Schlagworte, die zu einer Veränderung der
Situation beigetragen hätten. Eine Folge davon ist, dass die Landtechnikbranche
zum boomenden Sektor der Landwirtschaft geworden ist. Für Nicklas war 2011 aus
wirtschaftlicher Sicht ein gutes Jahr. Sowohl beim Umsatz, als auch
betriebswirtschaftlich habe ein erfreulicher Zuwachs realisiert werden können.
Schirradorf.
„Man hatte schon mal das Gefühl, dass alles bergab geht“, sagt Edwin Nicklas,
Inhaber und Geschäftsleiter des Unternehmens Landtechnik Nicklas in Schirradorf
im Landkreis Kulmbach. Doch seit einiger Zeit habe seine Branche allen Grund,
wieder optimistisch in die Zukunft zu blicken. „Die Stimmung ist positiv und das
Image ganz gut“, so Nicklas. Er ist der festen Überzeugung, dass die
Landwirtschaft in unseren Breiten und somit auch die Landtechnik Zukunft haben.
Klimawandel, ein weltweites Bevölkerungswachstum, andere Ernährungsgewohnheiten
und die Energiewende, das alles sind Schlagworte, die zu einer Veränderung der
Situation beigetragen hätten. Eine Folge davon ist, dass die Landtechnikbranche
zum boomenden Sektor der Landwirtschaft geworden ist. Für Nicklas war 2011 aus
wirtschaftlicher Sicht ein gutes Jahr. Sowohl beim Umsatz, als auch
betriebswirtschaftlich habe ein erfreulicher Zuwachs realisiert werden können.
.jpg) Heute
gilt Nicklas Landtechnik nach Aussage des Firmenchefs als „leistungsstarker
Partner für innovative Landtechnik renommierter Hersteller“. Seit 1998 ist das
Unternehmen mit Firmensitz in Schirradorf sowie je einem Standort im
unterfränkischen Hofheim (seit 2003) und im mittelfränkischen Grüb bei Ansbach
(seit 2011) auch autorisierter John-Deere-Vertragshändler. An den drei
Standorten beschäftigt Nicklas 50 Mitarbeiter, im wesentlichen
Landmaschinenmechaniker, Elektriker und kaufmännische Angestellte. „Unsere
Kunden schätzen unseren persönlichen Stil und unser fundiertes Fachwissen, das
jederzeit auf dem neuesten Stand und zudem äußerst praxisorientiert ist“, sagt
Nicklas. Sein Unternehmen verstehe sich als Dienstleister, der mit seiner Arbeit
aktiv zum Erfolg der Kunden beiträgt und ihnen hilft, mit moderner Technik einen
attraktiven Ertrag zu erzielen.
Heute
gilt Nicklas Landtechnik nach Aussage des Firmenchefs als „leistungsstarker
Partner für innovative Landtechnik renommierter Hersteller“. Seit 1998 ist das
Unternehmen mit Firmensitz in Schirradorf sowie je einem Standort im
unterfränkischen Hofheim (seit 2003) und im mittelfränkischen Grüb bei Ansbach
(seit 2011) auch autorisierter John-Deere-Vertragshändler. An den drei
Standorten beschäftigt Nicklas 50 Mitarbeiter, im wesentlichen
Landmaschinenmechaniker, Elektriker und kaufmännische Angestellte. „Unsere
Kunden schätzen unseren persönlichen Stil und unser fundiertes Fachwissen, das
jederzeit auf dem neuesten Stand und zudem äußerst praxisorientiert ist“, sagt
Nicklas. Sein Unternehmen verstehe sich als Dienstleister, der mit seiner Arbeit
aktiv zum Erfolg der Kunden beiträgt und ihnen hilft, mit moderner Technik einen
attraktiven Ertrag zu erzielen. .jpg) Das
Einzugsgebiet des Unternehmens umfasst Ober- und Unterfranken sowie
Südthüringen. Neben einem Vollsortiment an Landmaschinen und Kleingeräten bietet
das Unternehmen auch eine Vielzahl an Serviceleistungen an. „Die Werkstätten
sowie ein hervorragender Ersatzteil- und Reparaturservice bringen alles schnell
wieder in Gang.“. Zum Service gehöre dabei auch eine seriöse Beratung im Vorfeld
der Kaufentscheidung. So bietet Nicklas beispielsweise den Besuch von
Außendienstmitarbeitern im landwirtschaftlichen Betrieb an, der unter
Berücksichtigung des vorhandenen Maschinenparks und der konkreten
Einsatzbereiche die jeweils optimale Maschine ermittelt. Seit dem
zurückliegenden Jahr hat das Unternehmen als weiteres Standbein auch den
Vertrieb für den Marktführer von automatischen Melksystemen, dem
niederländischen Agrartechnikhersteller Lely, übernommen.
Das
Einzugsgebiet des Unternehmens umfasst Ober- und Unterfranken sowie
Südthüringen. Neben einem Vollsortiment an Landmaschinen und Kleingeräten bietet
das Unternehmen auch eine Vielzahl an Serviceleistungen an. „Die Werkstätten
sowie ein hervorragender Ersatzteil- und Reparaturservice bringen alles schnell
wieder in Gang.“. Zum Service gehöre dabei auch eine seriöse Beratung im Vorfeld
der Kaufentscheidung. So bietet Nicklas beispielsweise den Besuch von
Außendienstmitarbeitern im landwirtschaftlichen Betrieb an, der unter
Berücksichtigung des vorhandenen Maschinenparks und der konkreten
Einsatzbereiche die jeweils optimale Maschine ermittelt. Seit dem
zurückliegenden Jahr hat das Unternehmen als weiteres Standbein auch den
Vertrieb für den Marktführer von automatischen Melksystemen, dem
niederländischen Agrartechnikhersteller Lely, übernommen..jpg) Bamberg.
Hermann Greif aus Pinzberg im Landkreis Forchheim ist neuer Bezirkspräsident des
Bayerischen Bauernverbandes in Oberfranken. Der 48-jährige bisherige
Vizepräsident löst Werner Reihl (67) aus Bergnersreuth bei Arzberg im Landkreis
Wunsiedel ab, der zehn Jahre lang an der Spitze des BBV im Regierungsbezirk
stand und sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stellen konnte. Greif ist
damit in den kommenden fünf Jahren nicht nur der wichtigste Vertreter
bäuerlicher Interessen in Oberfranken, sondern steht auch an der Spitze von über
20000 Mitgliedern. Bei der Wahl in Bamberg konnte sich Greif gegen den Coburger
BBV-Kreisobmann Gerhard Ehrlich mit 34 zu 22 Stimmen durchsetzen. Ehrlich wurde
daraufhin ohne Gegenstimme zum Vizepräsidenten gewählt.
Bamberg.
Hermann Greif aus Pinzberg im Landkreis Forchheim ist neuer Bezirkspräsident des
Bayerischen Bauernverbandes in Oberfranken. Der 48-jährige bisherige
Vizepräsident löst Werner Reihl (67) aus Bergnersreuth bei Arzberg im Landkreis
Wunsiedel ab, der zehn Jahre lang an der Spitze des BBV im Regierungsbezirk
stand und sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stellen konnte. Greif ist
damit in den kommenden fünf Jahren nicht nur der wichtigste Vertreter
bäuerlicher Interessen in Oberfranken, sondern steht auch an der Spitze von über
20000 Mitgliedern. Bei der Wahl in Bamberg konnte sich Greif gegen den Coburger
BBV-Kreisobmann Gerhard Ehrlich mit 34 zu 22 Stimmen durchsetzen. Ehrlich wurde
daraufhin ohne Gegenstimme zum Vizepräsidenten gewählt..jpg) „Ich
habe fertig, aber die Flasche ist noch lange nicht leer.“ Mit diesem, dem
ehemaligen Bayern-Coach Giovannis Trappatoni angelehnten Worten hatte sich zuvor
Werner Reihl von den Mitgliedern der oberfränkischen Kreisvorstandschaften
verabschiedet. Mit seiner Wahl vor zehn Jahren sei ihm ein Herzenswunsch in
Erfüllung gegangen, er habe das Amt vom ersten bis zum letzten Tag mit
Leidenschaft ausgeübt. Sein Ziel sei es gewesen, sich immer an der Realität zu
orientieren und mit Sachlichkeit zu argumentieren, auch wenn Themen wie BSE oder
Milchstreik oft im Strudel der Emotionen untergegangen seien.
„Ich
habe fertig, aber die Flasche ist noch lange nicht leer.“ Mit diesem, dem
ehemaligen Bayern-Coach Giovannis Trappatoni angelehnten Worten hatte sich zuvor
Werner Reihl von den Mitgliedern der oberfränkischen Kreisvorstandschaften
verabschiedet. Mit seiner Wahl vor zehn Jahren sei ihm ein Herzenswunsch in
Erfüllung gegangen, er habe das Amt vom ersten bis zum letzten Tag mit
Leidenschaft ausgeübt. Sein Ziel sei es gewesen, sich immer an der Realität zu
orientieren und mit Sachlichkeit zu argumentieren, auch wenn Themen wie BSE oder
Milchstreik oft im Strudel der Emotionen untergegangen seien..jpg) Haid.
Das Aischgründer Modellprojekt der sogenannten Kormoranvergrämung zeigt
Erfolg: „Durch die räumliche wie auch zeitliche Ausweitung von
Kormoranabschüssen konnten wir im zurückliegenden Herbst die beste Ernte
seit vielen Jahren einfahren“, sagte Teichwirt Fritz Nagel, der im unteren
Aischgrund bei Haid im Landkreis Forchheim rund 60 Hektar Teichfläche
bewirtschaftet. Nun fordern die Teichwirte eine Ausweitung des
Modellprojekts durch eine ganzjährige Jagdzeit für den Kormoran sowie eine
Ausdehnung der Jagd auch auf die bisherigen Schutzgebiete ohne bürokratische
Erschwernisse.
Haid.
Das Aischgründer Modellprojekt der sogenannten Kormoranvergrämung zeigt
Erfolg: „Durch die räumliche wie auch zeitliche Ausweitung von
Kormoranabschüssen konnten wir im zurückliegenden Herbst die beste Ernte
seit vielen Jahren einfahren“, sagte Teichwirt Fritz Nagel, der im unteren
Aischgrund bei Haid im Landkreis Forchheim rund 60 Hektar Teichfläche
bewirtschaftet. Nun fordern die Teichwirte eine Ausweitung des
Modellprojekts durch eine ganzjährige Jagdzeit für den Kormoran sowie eine
Ausdehnung der Jagd auch auf die bisherigen Schutzgebiete ohne bürokratische
Erschwernisse..jpg) Walter
Jacob von der Teichgenossenschaft Aischgrund etwa bezifferte die Schäden an
seinen Fischen auf 70 Prozent, erst mit Einführung der Kormoranvergrämung im
zurückliegenden Jahr hätten sie sich auf 30 Prozent reduziert. Das sei sehr
zu begrüßen, denn die Teichwirte wollten weder von Zuschüssen noch von
Almosen des Staates leben, sondern vom Verkauf ihrer regionalen Produkte.
Kommen die Teichwirte allerdings in Existenznöte, dann werde sich
langfristig niemand mehr finden, der die fränkische Teichlandschaft mit
ihrer Jahrhunderte alten Tradition bewirtschaftet. Schon jetzt sei die
Altersstruktur der Teichwirte relativ hoch. Ohne langfristige
Planungssicherheit werde die Teichwirtschaft von jüngeren Nachfolgern nicht
forstgesetzt werden.
Walter
Jacob von der Teichgenossenschaft Aischgrund etwa bezifferte die Schäden an
seinen Fischen auf 70 Prozent, erst mit Einführung der Kormoranvergrämung im
zurückliegenden Jahr hätten sie sich auf 30 Prozent reduziert. Das sei sehr
zu begrüßen, denn die Teichwirte wollten weder von Zuschüssen noch von
Almosen des Staates leben, sondern vom Verkauf ihrer regionalen Produkte.
Kommen die Teichwirte allerdings in Existenznöte, dann werde sich
langfristig niemand mehr finden, der die fränkische Teichlandschaft mit
ihrer Jahrhunderte alten Tradition bewirtschaftet. Schon jetzt sei die
Altersstruktur der Teichwirte relativ hoch. Ohne langfristige
Planungssicherheit werde die Teichwirtschaft von jüngeren Nachfolgern nicht
forstgesetzt werden. Bamberg.
Die oberfränkische Forstwirtschaft ist mit dem zurückliegenden Jahr absolut
zufrieden. „Wir haben ein in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Jahr hinter uns“,
sagte der Vorsitzende der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberfranken (FVO),
der Bamberger Landtagsabgeordnete Heinrich Rudroff. Neben guten Holzpreisen habe
vor allem der Wald im Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit gestanden.
Grund dafür war das von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Jahr
der Wälder. Die FVO, die beim Bauernverband in Bamberg ihren Sitz hat, vertritt
17 oberfränkische Waldbesitzervereinigungen mit zusammen rund 22000 Mitgliedern
und einer bewirtschafteten Waldfläche von circa 140000 Hektar.
Bamberg.
Die oberfränkische Forstwirtschaft ist mit dem zurückliegenden Jahr absolut
zufrieden. „Wir haben ein in vielerlei Hinsicht erfolgreiches Jahr hinter uns“,
sagte der Vorsitzende der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Oberfranken (FVO),
der Bamberger Landtagsabgeordnete Heinrich Rudroff. Neben guten Holzpreisen habe
vor allem der Wald im Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit gestanden.
Grund dafür war das von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Jahr
der Wälder. Die FVO, die beim Bauernverband in Bamberg ihren Sitz hat, vertritt
17 oberfränkische Waldbesitzervereinigungen mit zusammen rund 22000 Mitgliedern
und einer bewirtschafteten Waldfläche von circa 140000 Hektar. Leinburg/Nürnberg.
Regionalität ist vielen Verbrauchern mittlerweile wichtiger als Bio. Diesen
Trend greift der Bauernverband im Nürnberger Land zur Verbrauchermesse „Consumenta“
auf, die vom 26. Oktober bis zum 1. November auf dem Messegelände stattfindet.
Der BBV, ein halbes Dutzend Landwirte aus dem Nürnberger Land, drei örtliche
Brauereien und die Mälzerei Klostermalz in Frauenaurach haben sich dabei
zusammengetan, um den Braugerstenanbau im Landkreis wieder zu forcieren.
Leinburg/Nürnberg.
Regionalität ist vielen Verbrauchern mittlerweile wichtiger als Bio. Diesen
Trend greift der Bauernverband im Nürnberger Land zur Verbrauchermesse „Consumenta“
auf, die vom 26. Oktober bis zum 1. November auf dem Messegelände stattfindet.
Der BBV, ein halbes Dutzend Landwirte aus dem Nürnberger Land, drei örtliche
Brauereien und die Mälzerei Klostermalz in Frauenaurach haben sich dabei
zusammengetan, um den Braugerstenanbau im Landkreis wieder zu forcieren..jpg) Tirschenreuth.
Sieben Jahre nach dem entsprechenden Kabinettsbeschluss hat Minister
Helmut Brunner in Tirschenreuth am Dienstag den symbolischen ersten
Spatenstich für den Neubau des Oberpfälzer Amtes für ländliche
Entwicklung getätigt. Damit gab der Minister grünes Licht für die
heftig umstrittene Verlagerung des Amtes von Regensburg in die
nördliche Oberpfalz.
Tirschenreuth.
Sieben Jahre nach dem entsprechenden Kabinettsbeschluss hat Minister
Helmut Brunner in Tirschenreuth am Dienstag den symbolischen ersten
Spatenstich für den Neubau des Oberpfälzer Amtes für ländliche
Entwicklung getätigt. Damit gab der Minister grünes Licht für die
heftig umstrittene Verlagerung des Amtes von Regensburg in die
nördliche Oberpfalz..jpg) Er
könne nicht verhehlen, dass sich bei einem Großteil der Mitarbeiter
die Freude über die Verlagerung in engen Grenzen hält, sagte zuvor
Amtschef Thomas Gollwitzer. Er räumte aber auch ein, dass die Würfel
nun gefallen sind und appellierte deshalb an alle Skeptiker, jetzt
nach vorne zu blicken. Was die Ausstattung mit Personal angehe, so
stufte er sein Amt allerdings als wenig gut gerüstet ein. Gollwitzer
sprach von einem dramatisch sinkenden Personalbestand, der bereits
zu spürbaren Kompetenz- und Wissensverlusten geführt habe.
Er
könne nicht verhehlen, dass sich bei einem Großteil der Mitarbeiter
die Freude über die Verlagerung in engen Grenzen hält, sagte zuvor
Amtschef Thomas Gollwitzer. Er räumte aber auch ein, dass die Würfel
nun gefallen sind und appellierte deshalb an alle Skeptiker, jetzt
nach vorne zu blicken. Was die Ausstattung mit Personal angehe, so
stufte er sein Amt allerdings als wenig gut gerüstet ein. Gollwitzer
sprach von einem dramatisch sinkenden Personalbestand, der bereits
zu spürbaren Kompetenz- und Wissensverlusten geführt habe..jpg) Speinshart
– „Manche hat es richtig in die Krise gestürzt“, sagt Prior Pater
Benedikt von der Praemonstratenserabtei Speinshart im
oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Pater Benedikt
spricht von den Auszubildenden zur Hauswirtschaft, die hier im
Kloster tätig sind. Vor allem mit ihrer freien Zeit hätten manche
Lehrlinge erhebliche Probleme, was schließlich dazu führte, dass sie
nur noch weg wollten.
Speinshart
– „Manche hat es richtig in die Krise gestürzt“, sagt Prior Pater
Benedikt von der Praemonstratenserabtei Speinshart im
oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Pater Benedikt
spricht von den Auszubildenden zur Hauswirtschaft, die hier im
Kloster tätig sind. Vor allem mit ihrer freien Zeit hätten manche
Lehrlinge erhebliche Probleme, was schließlich dazu führte, dass sie
nur noch weg wollten..jpg) Ein
großer Unterschied freilich ist der, dass sie den Klausurbereich,
also den gesamten zweiten Stock des Klosters nie betreten durfte.
Dafür gibt es sogar eigene Reinigungskräfte, sagt
Hauswirtschaftsleiterin Jutta Bundscherer. Zumindest
gewöhnungsbedürftig war auch das Bügeln der langen weißen Habits,
also der Ordenstracht. Daneben ist Theresia Brandl wohl auch die
einzige angehende Hauswirtschafterin, die für die Pflege der zum
Kloster gehörenden Gräber auf dem nahe gelegenen Friedhof zuständig
war. Aber auch das machte ihr, die schon ein Praktikum in einem
Floristik-Betrieb absolviert hatte und laut ihrer älteren Schwester
Christine „super Sträuße“ binden kann, sichtlich Spaß. Und auch mit
dem fast schon historischen Holzofen hatte sie sich schnell
arrangiert.
Ein
großer Unterschied freilich ist der, dass sie den Klausurbereich,
also den gesamten zweiten Stock des Klosters nie betreten durfte.
Dafür gibt es sogar eigene Reinigungskräfte, sagt
Hauswirtschaftsleiterin Jutta Bundscherer. Zumindest
gewöhnungsbedürftig war auch das Bügeln der langen weißen Habits,
also der Ordenstracht. Daneben ist Theresia Brandl wohl auch die
einzige angehende Hauswirtschafterin, die für die Pflege der zum
Kloster gehörenden Gräber auf dem nahe gelegenen Friedhof zuständig
war. Aber auch das machte ihr, die schon ein Praktikum in einem
Floristik-Betrieb absolviert hatte und laut ihrer älteren Schwester
Christine „super Sträuße“ binden kann, sichtlich Spaß. Und auch mit
dem fast schon historischen Holzofen hatte sie sich schnell
arrangiert..jpg) Zunächst
als Mittel gegen Langeweile gedacht, hatte sich Theresie Brandl in
Speinshart ungewöhnliche Haustiere angeschafft: Zwei Bienenvölker.
Den Patres war es recht, zum einen gab es schon bald Honig, zum
anderen wurde damit eine uralte Tradition wieder aufgegriffen. Das
notwendige Wissen hatte sie sich angelesen, wie sie bescheiden sagt,
und mit nur drei Stichen ist sie relativ glimpflich davongekommen.
Den Honigsachkundenachweis hat sie mittlerweile auch erfolgreich
absolviert.
Zunächst
als Mittel gegen Langeweile gedacht, hatte sich Theresie Brandl in
Speinshart ungewöhnliche Haustiere angeschafft: Zwei Bienenvölker.
Den Patres war es recht, zum einen gab es schon bald Honig, zum
anderen wurde damit eine uralte Tradition wieder aufgegriffen. Das
notwendige Wissen hatte sie sich angelesen, wie sie bescheiden sagt,
und mit nur drei Stichen ist sie relativ glimpflich davongekommen.
Den Honigsachkundenachweis hat sie mittlerweile auch erfolgreich
absolviert..jpg) Marktschorgast
– „Wir bedienen von Marktschorgast aus den Weltmarkt.“ Heinz Zießler,
Geschäftsführer des Traditionsunternehmens BSA-Gülletechnik in Marktschorgast
(Landkreis Kulmbach) spricht vom außerordentlichen Erfolg und einem rasanten
Wachstum seines Unternehmens, das 1961 aus kleinsten Anfängen heraus begonnen
hatte und heute zur weltweit operierenden Bauer Group im österreichischen
Voitsberg gehört.
Marktschorgast
– „Wir bedienen von Marktschorgast aus den Weltmarkt.“ Heinz Zießler,
Geschäftsführer des Traditionsunternehmens BSA-Gülletechnik in Marktschorgast
(Landkreis Kulmbach) spricht vom außerordentlichen Erfolg und einem rasanten
Wachstum seines Unternehmens, das 1961 aus kleinsten Anfängen heraus begonnen
hatte und heute zur weltweit operierenden Bauer Group im österreichischen
Voitsberg gehört..jpg) 1978
wurde der Betrieb dann von Münchberg nach Marktschorgast verlegt. Hauptgrund sei
die Schaffung von wesentlich erweiterten Produktionsmöglichkeiten gewesen, sagt
Geschäftsführer Zießler. Aufgenommen wurde der Betrieb im heutigen Kerngebäude,
das bis dahin die Kulmbacher Spinnerei genutzt hatte. Nach und nach kamen Neu-
und Anbauten dazu, so dass die BSA heute auf rund 10000 Quadratmeter
Produktionsfläche verweisen kann. Auch der Gleisanschluss soll damals bei der
Entscheidung für Marktschorgast eine wichtige Rolle gespielt haben. Nach
24-jähriger Zusammenarbeit kam es dann 1995 immer noch mit Paul Langer an der
Spitze zur Übernahme des Betriebes durch die Alfa-Laval-Gruppe, die später nach
ihrem schwedischen Gründer Gustaf DeLaval, dem Erfinder der Melkmaschine
umbenannt wurde.
1978
wurde der Betrieb dann von Münchberg nach Marktschorgast verlegt. Hauptgrund sei
die Schaffung von wesentlich erweiterten Produktionsmöglichkeiten gewesen, sagt
Geschäftsführer Zießler. Aufgenommen wurde der Betrieb im heutigen Kerngebäude,
das bis dahin die Kulmbacher Spinnerei genutzt hatte. Nach und nach kamen Neu-
und Anbauten dazu, so dass die BSA heute auf rund 10000 Quadratmeter
Produktionsfläche verweisen kann. Auch der Gleisanschluss soll damals bei der
Entscheidung für Marktschorgast eine wichtige Rolle gespielt haben. Nach
24-jähriger Zusammenarbeit kam es dann 1995 immer noch mit Paul Langer an der
Spitze zur Übernahme des Betriebes durch die Alfa-Laval-Gruppe, die später nach
ihrem schwedischen Gründer Gustaf DeLaval, dem Erfinder der Melkmaschine
umbenannt wurde..jpg) Lautertal
– Blau, gebacken, paniert und geräuchert, als Filet oder als Sülze: In den
kommenden Monaten mit dem Buchstaben „R“ im Namen werden zahlreiche
Gaststätten in Oberfranken wieder den Karpfen als typisch fränkisches
Produkt auf ihren Speisekarten anbieten. Eröffnet wurde die Karpfensaison am
Wochenende von der Teichgenossenschaft Oberfranken traditionell mit dem
Abfischen eines Karpfenteichs, diesmal in Lautertal im Coburger Land. Dort
feierte der Betrieb Forellen- und Fischzucht Lautertal von Werner Humann
sein 50-jähriges Bestehen mit einem großen Hoffest.
Lautertal
– Blau, gebacken, paniert und geräuchert, als Filet oder als Sülze: In den
kommenden Monaten mit dem Buchstaben „R“ im Namen werden zahlreiche
Gaststätten in Oberfranken wieder den Karpfen als typisch fränkisches
Produkt auf ihren Speisekarten anbieten. Eröffnet wurde die Karpfensaison am
Wochenende von der Teichgenossenschaft Oberfranken traditionell mit dem
Abfischen eines Karpfenteichs, diesmal in Lautertal im Coburger Land. Dort
feierte der Betrieb Forellen- und Fischzucht Lautertal von Werner Humann
sein 50-jähriges Bestehen mit einem großen Hoffest. Gundlitz,
Lks. Hof – „Im Moment leben wir von der Hand in den Mund.“ Martina
und Michael Eckl aus Gundlitz zwischen Marktschorgast und Stammbach
produzieren derzeit unter dem Preis, der eigentlich zur Deckung der
Kosten notwendig wäre. Das Ehepaar betreibt auf seinem
landwirtschaftlichen Anwesen eine Ferkelerzeugung mit rund 175
Zuchtsauen und vermarktet die Tiere an feste Mäster im den
Landkreisen Bayreuth und Hof. Jedes Ferkel, das den Hof verlässt,
müsste rund 15 Euro mehr kosten, damit wenigstens etwas verdient
ist. „So schlimm war es noch nie“, sind sich Martina und Michael
Eckl einig.
Gundlitz,
Lks. Hof – „Im Moment leben wir von der Hand in den Mund.“ Martina
und Michael Eckl aus Gundlitz zwischen Marktschorgast und Stammbach
produzieren derzeit unter dem Preis, der eigentlich zur Deckung der
Kosten notwendig wäre. Das Ehepaar betreibt auf seinem
landwirtschaftlichen Anwesen eine Ferkelerzeugung mit rund 175
Zuchtsauen und vermarktet die Tiere an feste Mäster im den
Landkreisen Bayreuth und Hof. Jedes Ferkel, das den Hof verlässt,
müsste rund 15 Euro mehr kosten, damit wenigstens etwas verdient
ist. „So schlimm war es noch nie“, sind sich Martina und Michael
Eckl einig. Himmelkron.
Extreme Trockenheit und hochsommerliche Temperaturen im Frühjahr gefolgt von
ungewöhnlich heftigen Regenfällen im Juni: Die extreme Witterung in den
vergangenen Monaten ist nicht ohne Auswirkungen auf die Ernte in Oberfranken
geblieben. BBV-Bezirkspräsident Werner Reihl und Direktor Dr. Wilhelm Böhmer
berichteten bei der Vorlage der Erntebilanz in Himmelkron von teilweise heftigen
Ertragsrückgängen. „Die Ernte wird heuer deutlich niedriger ausfallen“, sagte
Reihl. Einziger Lichtblick: Die oberfränkischen Bauern können heuer im Gegensatz
zum Vorjahr mit stabilen Preisen rechnen. „Die Preise haben sich mittlerweile
wieder gefangen“, so der BBV-Präsident.
Himmelkron.
Extreme Trockenheit und hochsommerliche Temperaturen im Frühjahr gefolgt von
ungewöhnlich heftigen Regenfällen im Juni: Die extreme Witterung in den
vergangenen Monaten ist nicht ohne Auswirkungen auf die Ernte in Oberfranken
geblieben. BBV-Bezirkspräsident Werner Reihl und Direktor Dr. Wilhelm Böhmer
berichteten bei der Vorlage der Erntebilanz in Himmelkron von teilweise heftigen
Ertragsrückgängen. „Die Ernte wird heuer deutlich niedriger ausfallen“, sagte
Reihl. Einziger Lichtblick: Die oberfränkischen Bauern können heuer im Gegensatz
zum Vorjahr mit stabilen Preisen rechnen. „Die Preise haben sich mittlerweile
wieder gefangen“, so der BBV-Präsident..jpg) Bayreuth.
90 Prozent der Fläche im Landkreis Bayreuth werden land- und
forstwirtschaftliche genutzt. „Damit ist die Bioenergieregion startklar“,
sagte Landrat Hermann Hübner bei der Freischaltung des „Kommunalen
Informationssystems Erneuerbare Energien“ im Bayreuther Landratsamt. Mit dem
Sieg im entsprechenden bundesweiten Projektwettbewerb habe die
Bioenergieregion vor zwei Jahren gewaltig an Fahrt aufgenommen, so Hübner
weiter. Einen weiteren Schub erhält das ehrgeizige Projekt jetzt mit der
offiziellen Online-Schaltung des Informationssystems durch
Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner. Auf der Internet-Plattform
Bayreuth.
90 Prozent der Fläche im Landkreis Bayreuth werden land- und
forstwirtschaftliche genutzt. „Damit ist die Bioenergieregion startklar“,
sagte Landrat Hermann Hübner bei der Freischaltung des „Kommunalen
Informationssystems Erneuerbare Energien“ im Bayreuther Landratsamt. Mit dem
Sieg im entsprechenden bundesweiten Projektwettbewerb habe die
Bioenergieregion vor zwei Jahren gewaltig an Fahrt aufgenommen, so Hübner
weiter. Einen weiteren Schub erhält das ehrgeizige Projekt jetzt mit der
offiziellen Online-Schaltung des Informationssystems durch
Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner. Auf der Internet-Plattform
.jpg) Langfristiges
Ziel der Bioenergieregion ist es, die Abhängigkeit von Energieimporten zu
verringern, die Wertschöpfung vor Ort zu erhöhen und den ländlichen Raum zu
stärken. Dazu ist unter anderem vorgesehen, den Anteil regional erzeugter
Bioenergie am Endenergieverbrauch der Privathaushalte in der Region von
aktuell unter 20 auf über 50 Prozent zu erhöhen. Neben der Umweltbildung
sollen dazu auch die Themen Information und Verbraucheraufklärung eine
wichtige Rolle spielen. Mit neuen Materialien zum unterhaltsamen Lernen und
entsprechenden didaktischen Konzepten könnten Schulen und
Umweltbildungseinrichtungen den Zugang zu dem Thema erleichtern.
Langfristiges
Ziel der Bioenergieregion ist es, die Abhängigkeit von Energieimporten zu
verringern, die Wertschöpfung vor Ort zu erhöhen und den ländlichen Raum zu
stärken. Dazu ist unter anderem vorgesehen, den Anteil regional erzeugter
Bioenergie am Endenergieverbrauch der Privathaushalte in der Region von
aktuell unter 20 auf über 50 Prozent zu erhöhen. Neben der Umweltbildung
sollen dazu auch die Themen Information und Verbraucheraufklärung eine
wichtige Rolle spielen. Mit neuen Materialien zum unterhaltsamen Lernen und
entsprechenden didaktischen Konzepten könnten Schulen und
Umweltbildungseinrichtungen den Zugang zu dem Thema erleichtern. Thurnau – Der Schlossweiher von Thurnau ist offiziell zu einem überregional
bedeutsamen Kulturgut erklärt worden. Der Weiher präge seit über 300 Jahren
das gesamte Ensemble, er werde bis heute teichwirtschaftlich genutzt und
trage maßgeblich zum Erhalt der Artenvielfalt bei, heißt es auf der Urkunde,
die Landtagsvizepräsident Peter Meyer an Bürgermeister Dietmar Hofmann
überreichte. Vergeben wird die Auszeichnung „Kulturgut Teich“ seit 1998 von
der Teichgenossenschaft Oberfranken. Dokumentiert wird die Auszeichnung
durch eine Informationstafel, die direkt am Ufer in unmittelbarer Nähe zum
Schloss platziert wurde.
Thurnau – Der Schlossweiher von Thurnau ist offiziell zu einem überregional
bedeutsamen Kulturgut erklärt worden. Der Weiher präge seit über 300 Jahren
das gesamte Ensemble, er werde bis heute teichwirtschaftlich genutzt und
trage maßgeblich zum Erhalt der Artenvielfalt bei, heißt es auf der Urkunde,
die Landtagsvizepräsident Peter Meyer an Bürgermeister Dietmar Hofmann
überreichte. Vergeben wird die Auszeichnung „Kulturgut Teich“ seit 1998 von
der Teichgenossenschaft Oberfranken. Dokumentiert wird die Auszeichnung
durch eine Informationstafel, die direkt am Ufer in unmittelbarer Nähe zum
Schloss platziert wurde. Der Schlossweiher von Thurnau sei ein Paradebeispiel dafür, wie Ökologie und
Ökonomie in Einklang gebracht werden können, sagte Landtagsvizepräsident
Meyer. Er bezeichnete den Weiher vor dem Schloss als eines der beliebtesten
Postkartenmotive Oberfrankens. Um den Beweis anzutreten, dass der Thurnauer
Schlossweiher die durchaus anspruchsvollen Kriterien eines Kulturguts
erfülle, sei in den zurückliegenden Monaten einiges an Recherchearbeiten
notwendig gewesen, so der Thurnauer Bürgermeister Dietmar Hofmann. Die
kulturhistorische Bedeutung des Gewässers sei unbestritten und habe als
Fischgewässer mit reichlichem Besatz eine herausragende Bedeutung.
Der Schlossweiher von Thurnau sei ein Paradebeispiel dafür, wie Ökologie und
Ökonomie in Einklang gebracht werden können, sagte Landtagsvizepräsident
Meyer. Er bezeichnete den Weiher vor dem Schloss als eines der beliebtesten
Postkartenmotive Oberfrankens. Um den Beweis anzutreten, dass der Thurnauer
Schlossweiher die durchaus anspruchsvollen Kriterien eines Kulturguts
erfülle, sei in den zurückliegenden Monaten einiges an Recherchearbeiten
notwendig gewesen, so der Thurnauer Bürgermeister Dietmar Hofmann. Die
kulturhistorische Bedeutung des Gewässers sei unbestritten und habe als
Fischgewässer mit reichlichem Besatz eine herausragende Bedeutung. Himmelkron
– Die Stimmung in den landwirtschaftlichen Familienbetrieben in Oberfranken ist
derzeit gedämpft. Schuld daran sind nach den Worten des oberfränkischen
BBV-Bezirkspräsidenten Werner Reihl und des BBV-Direktors Dr. Wilhelm Böhmer
nicht nur die schwierigen Witterungsverhältnisse, sondern auch der so genannte
Dioxin-Skandal, der den hiesigen Bauern schwer zu schaffen macht. Für das
laufende Wirtschaftsjahr rechnet der Bauernverband ausgehend von dem noch immer
viel zu niedrigen Einkommensniveau in der Landwirtschaft allenfalls mit einer
leichten Besserung, so Reihl in Himmelkron.
Himmelkron
– Die Stimmung in den landwirtschaftlichen Familienbetrieben in Oberfranken ist
derzeit gedämpft. Schuld daran sind nach den Worten des oberfränkischen
BBV-Bezirkspräsidenten Werner Reihl und des BBV-Direktors Dr. Wilhelm Böhmer
nicht nur die schwierigen Witterungsverhältnisse, sondern auch der so genannte
Dioxin-Skandal, der den hiesigen Bauern schwer zu schaffen macht. Für das
laufende Wirtschaftsjahr rechnet der Bauernverband ausgehend von dem noch immer
viel zu niedrigen Einkommensniveau in der Landwirtschaft allenfalls mit einer
leichten Besserung, so Reihl in Himmelkron. Aufseß – Diesen rund 1,10 Meter langen Hecht haben Mitarbeiter der
Lehranstalt für Fischerei in Aufseß im Zuge von Gewässererkundungen bei
Elektroabfischungen im Main bei Breitengüßbach (Landkreis Bamberg) gefangen.
Der rund 25 Pfund schwere und schätzungsweise zwölf bis 14 Jahre alte Fisch
ist derzeit in einem Becken der Lehranstalt untergebracht und soll
voraussichtlich zu Unterrichtszwecken präpariert werden, so der Leiter der
Lehranstalt Ronny Seyfried (Bild). In der Einrichtung des Bezirks
Oberfranken gibt es zurzeit neben Aalen, Zandern, Karpfen und Schleien auch
seltenere Gewässerbewohner wie etwa Teichmuscheln und Krebse. Sie alle
zeigten die immensen Artenvielfalt in den oberfränkischen Gewässern, sagt
Fischereifachberater Robert Klupp. Diese Vielfalt dürfe nicht leichtfertig
aufs Spiel gesetzt werden. Besonders zu schaffen macht den oberfränkischen
Fischern und Teichwirten seit Jahren der Kormoran. Auch in Fließgewässern
treibe dieser Raubvogel sein Unwesen, so Klupp. So würden besonders Äschen
unter dem Kormoran leiden. In Aufseß hat man sich deshalb besonders dem
Schutz der Äsche verschrieben, von denen derzeit einige ganz besondere
Exemplare in der Lehranstalt zu besichtigen sind. Es handelt sich dabei um
mutierte Äschen, die durch eine Laune der Natur blau gefärbt sind.
Aufseß – Diesen rund 1,10 Meter langen Hecht haben Mitarbeiter der
Lehranstalt für Fischerei in Aufseß im Zuge von Gewässererkundungen bei
Elektroabfischungen im Main bei Breitengüßbach (Landkreis Bamberg) gefangen.
Der rund 25 Pfund schwere und schätzungsweise zwölf bis 14 Jahre alte Fisch
ist derzeit in einem Becken der Lehranstalt untergebracht und soll
voraussichtlich zu Unterrichtszwecken präpariert werden, so der Leiter der
Lehranstalt Ronny Seyfried (Bild). In der Einrichtung des Bezirks
Oberfranken gibt es zurzeit neben Aalen, Zandern, Karpfen und Schleien auch
seltenere Gewässerbewohner wie etwa Teichmuscheln und Krebse. Sie alle
zeigten die immensen Artenvielfalt in den oberfränkischen Gewässern, sagt
Fischereifachberater Robert Klupp. Diese Vielfalt dürfe nicht leichtfertig
aufs Spiel gesetzt werden. Besonders zu schaffen macht den oberfränkischen
Fischern und Teichwirten seit Jahren der Kormoran. Auch in Fließgewässern
treibe dieser Raubvogel sein Unwesen, so Klupp. So würden besonders Äschen
unter dem Kormoran leiden. In Aufseß hat man sich deshalb besonders dem
Schutz der Äsche verschrieben, von denen derzeit einige ganz besondere
Exemplare in der Lehranstalt zu besichtigen sind. Es handelt sich dabei um
mutierte Äschen, die durch eine Laune der Natur blau gefärbt sind..jpg) Bayreuth.
Den Status des berühmt-berüchtigten Pirelli-Kalenders hat er noch
nicht erreicht, Kultobjekt und begehrtes Sammlerstück ist er
trotzdem: der Jungbauernkalender der bayerischen Landjugend.
Vorgestellt wurde er diesmal in Bayreuth, was hauptsächlich darin
begründet ist, dass mit Lisa (19) und Christina (18) gleich zwei der
Models aus dem Landkreis stammen. Nachnamen und Wohnort wollen die
Kalendergirls bewusst nicht veröffentlicht haben, wohl um sich vor
aufdringlichen Verehrern zu schützen.
Bayreuth.
Den Status des berühmt-berüchtigten Pirelli-Kalenders hat er noch
nicht erreicht, Kultobjekt und begehrtes Sammlerstück ist er
trotzdem: der Jungbauernkalender der bayerischen Landjugend.
Vorgestellt wurde er diesmal in Bayreuth, was hauptsächlich darin
begründet ist, dass mit Lisa (19) und Christina (18) gleich zwei der
Models aus dem Landkreis stammen. Nachnamen und Wohnort wollen die
Kalendergirls bewusst nicht veröffentlicht haben, wohl um sich vor
aufdringlichen Verehrern zu schützen..jpg) Wichtigster
Punkt für die sechs bayerischen Kalendergirls, die unter 250
Bewerbungen ausgewählt wurden, war der Bezug zur Landwirtschaft.
„Septembergirl“ Lisa aus dem Landkreis Bayreuth beispielsweise ist
selbst Mitglied der Landjugend, die Eltern von „April-Model“
Christina haben einen Milchviehbetrieb, die Eltern von Andrea aus
Niederbayern einen Ackerbaubetrieb. Jasmin studiert im dritten
Semester Landwirtschaft, Anna aus Oberbayern hat die Übernahme des
elterlichen Hofs bereits fest im Blick, genauso wie Männermodel
Matthias aus Schwaben, der gerade seinen Landwirtschaftsmeister
macht.
Wichtigster
Punkt für die sechs bayerischen Kalendergirls, die unter 250
Bewerbungen ausgewählt wurden, war der Bezug zur Landwirtschaft.
„Septembergirl“ Lisa aus dem Landkreis Bayreuth beispielsweise ist
selbst Mitglied der Landjugend, die Eltern von „April-Model“
Christina haben einen Milchviehbetrieb, die Eltern von Andrea aus
Niederbayern einen Ackerbaubetrieb. Jasmin studiert im dritten
Semester Landwirtschaft, Anna aus Oberbayern hat die Übernahme des
elterlichen Hofs bereits fest im Blick, genauso wie Männermodel
Matthias aus Schwaben, der gerade seinen Landwirtschaftsmeister
macht..jpg) Die
sechs Mädels aus Bayern sollen die schönen Seiten der Landwirtschaft
verkörpern, sagte die Vorsitzende der oberfränkischen
Jungbauernschaft Katrin Engelbrecht. Sie nannte den Kalender ein
fotografisches Kunstwerk, das durchaus auch das neue
Selbstbewusstsein der Landwirtschaft widerspiegle. Kritik am
Jungbauernkalender ließ Alexandra Krause, Jugendreferentin der
Jungbauernschaft Oberfranken nicht gelten. „Über Schönheit und
Geschmack lässt sich streiten“, erklärte sie, außerdem sei oft auch
Neid im Spiel. Den Spagat zwischen konservativ und modern schaffe
der Kalender in jedem Fall. Ein weit verbreitetes Vorurteil sei es
auch, dass ausschließlich Männer den Kalender erwerben. Freilich
kaufen Frauen den Kalender vor allem deshalb, um ihn (ihren) Männern
zu schenken. Bestellungen lägen im Büro mittlerweile nicht nur aus
ganz Deutschland, sondern auch aus Belgien und Luxemburg vor, eine
Mail hatte das Büro sogar aus Mexiko erreicht.
Die
sechs Mädels aus Bayern sollen die schönen Seiten der Landwirtschaft
verkörpern, sagte die Vorsitzende der oberfränkischen
Jungbauernschaft Katrin Engelbrecht. Sie nannte den Kalender ein
fotografisches Kunstwerk, das durchaus auch das neue
Selbstbewusstsein der Landwirtschaft widerspiegle. Kritik am
Jungbauernkalender ließ Alexandra Krause, Jugendreferentin der
Jungbauernschaft Oberfranken nicht gelten. „Über Schönheit und
Geschmack lässt sich streiten“, erklärte sie, außerdem sei oft auch
Neid im Spiel. Den Spagat zwischen konservativ und modern schaffe
der Kalender in jedem Fall. Ein weit verbreitetes Vorurteil sei es
auch, dass ausschließlich Männer den Kalender erwerben. Freilich
kaufen Frauen den Kalender vor allem deshalb, um ihn (ihren) Männern
zu schenken. Bestellungen lägen im Büro mittlerweile nicht nur aus
ganz Deutschland, sondern auch aus Belgien und Luxemburg vor, eine
Mail hatte das Büro sogar aus Mexiko erreicht..jpg) Nürnberg.
„Nächstes Jahr werden die Landfrauen sicher wieder dabei sein“, sagt Rudolf
Fähnlein, Direktor des BBV Mittelfranken und spricht damit an, was viele
Besucher auf der 57. Consumenta vermissen: das Landfrauencafe des
Bauernverbandes. Wenn am Eröffnungssonntag trotzdem so viele Menschen wie selten
in den vergangenen Jahren auf das Nürnberger Messegelände zu Süddeutschlands
größter Verbrauchermesse gekommen waren, dann deshalb, weil diesmal die
Regionalität das große Thema ist.
Nürnberg.
„Nächstes Jahr werden die Landfrauen sicher wieder dabei sein“, sagt Rudolf
Fähnlein, Direktor des BBV Mittelfranken und spricht damit an, was viele
Besucher auf der 57. Consumenta vermissen: das Landfrauencafe des
Bauernverbandes. Wenn am Eröffnungssonntag trotzdem so viele Menschen wie selten
in den vergangenen Jahren auf das Nürnberger Messegelände zu Süddeutschlands
größter Verbrauchermesse gekommen waren, dann deshalb, weil diesmal die
Regionalität das große Thema ist..jpg) Während
die Heusingers für Spezialitäten aus „Bayerns hohen Norden“ warben, setzte die
Entwicklungsgesellschaft Fränkische Moststraße gleich nebenan auf Produkte aus
„Frankens fruchtigem Süden“. Jutta und Herbert Grießer sowie Apfelkönigin Anna
Sauber aus Obermögersheim bei Wassertrüdingen verteilten Kostproben des
hochwertigen Obstes aus der Region Hesselberg und zeigten wie daraus
Direktsäfte, Schorlen, Seccos und Sekt gemacht werden.
Während
die Heusingers für Spezialitäten aus „Bayerns hohen Norden“ warben, setzte die
Entwicklungsgesellschaft Fränkische Moststraße gleich nebenan auf Produkte aus
„Frankens fruchtigem Süden“. Jutta und Herbert Grießer sowie Apfelkönigin Anna
Sauber aus Obermögersheim bei Wassertrüdingen verteilten Kostproben des
hochwertigen Obstes aus der Region Hesselberg und zeigten wie daraus
Direktsäfte, Schorlen, Seccos und Sekt gemacht werden..jpg) Zwischen
Handwerkern und Baufachleuten hat nebenan in Halle 1 der Forst seine
eindrucksvolle Messepräsentation aufgebaut. Die Forstwirtschaftliche Vereinigung
Mittelfranken, die Bayerische Forstverwaltung und das Walderlebniszentrum
Tennenlohe bei Erlangen wollen zeigen, dass der Wald und sein Hauptprodukt Holz
einen unverzichtbaren Beitrag für ein „Prima Klima“ leisten kann. „Wir möchten
den Besuchern aber auch deutlich machen, dass Waldwege zur Erschließung nötig
sind, denn andernfalls bringen wir den klimafreundlichen Rohstoff Holz gar nicht
raus aus dem Wald“, erläutert Geschäftsführer Armin Heidingsfelder von der FV
Mittelfranken. Ohne funktionierenden Waldwegebau kämen aber auch die
Erholungssuchenden gar nicht erst in den Wald hinein. Unter den ausgestellten
zukunftsfähigen Baumarten seien dabei nicht nur Eichen oder Douglasien, so
Gregor Schießl vom Netzwerk Forst und Holz, sondern auch der aus Nordamerika
stammende Mammutbaum. Dass auch eine Palme unter den Baumarten zu finden ist,
sei vor dem Hintergrund des Klimawandels durchaus als Provokation gedacht,
räumen Gregor Schießl und Susanne Bayerer vom Walderlebniszentrum ein.
Zwischen
Handwerkern und Baufachleuten hat nebenan in Halle 1 der Forst seine
eindrucksvolle Messepräsentation aufgebaut. Die Forstwirtschaftliche Vereinigung
Mittelfranken, die Bayerische Forstverwaltung und das Walderlebniszentrum
Tennenlohe bei Erlangen wollen zeigen, dass der Wald und sein Hauptprodukt Holz
einen unverzichtbaren Beitrag für ein „Prima Klima“ leisten kann. „Wir möchten
den Besuchern aber auch deutlich machen, dass Waldwege zur Erschließung nötig
sind, denn andernfalls bringen wir den klimafreundlichen Rohstoff Holz gar nicht
raus aus dem Wald“, erläutert Geschäftsführer Armin Heidingsfelder von der FV
Mittelfranken. Ohne funktionierenden Waldwegebau kämen aber auch die
Erholungssuchenden gar nicht erst in den Wald hinein. Unter den ausgestellten
zukunftsfähigen Baumarten seien dabei nicht nur Eichen oder Douglasien, so
Gregor Schießl vom Netzwerk Forst und Holz, sondern auch der aus Nordamerika
stammende Mammutbaum. Dass auch eine Palme unter den Baumarten zu finden ist,
sei vor dem Hintergrund des Klimawandels durchaus als Provokation gedacht,
räumen Gregor Schießl und Susanne Bayerer vom Walderlebniszentrum ein. Willersdorf
- Zum Start der Karpfensaison 2010 können sich alle Fischfreunde auf eine
ausgezeichnete Karpfenernte freuen. Durch den kühlen August seien die
Karpfen heuer nur langsam gewachsen, was für eine ausgezeichnete Qualität
spricht, sagt Landwirtschaftsminister Helmut Brunner bei der Eröffnung der
Karpfensaison in der oberfränkischen Gemarkung Willersdorf, Gemeinde
Hallerndorf im Landkreis Forchheim. Die zu erwartende Erntemenge bezifferte
Brunner auf rund 6000 Tonnen, was dem langjährigen Durchschnitt entspreche.
Willersdorf
- Zum Start der Karpfensaison 2010 können sich alle Fischfreunde auf eine
ausgezeichnete Karpfenernte freuen. Durch den kühlen August seien die
Karpfen heuer nur langsam gewachsen, was für eine ausgezeichnete Qualität
spricht, sagt Landwirtschaftsminister Helmut Brunner bei der Eröffnung der
Karpfensaison in der oberfränkischen Gemarkung Willersdorf, Gemeinde
Hallerndorf im Landkreis Forchheim. Die zu erwartende Erntemenge bezifferte
Brunner auf rund 6000 Tonnen, was dem langjährigen Durchschnitt entspreche. Himmelkron. Auf eine durchschnittliche, in weiten Bereichen eher
unterdurchschnittliche Ernte müssen die oberfränkischen Bauern in diesen Tagen
zurückblicken. Schuld daran ist das Wetter, wie BBV-Bezirkspräsident Werner Reihl und Bauernverbandsdirektor Dr. Wilhelm Böhmer in Himmelkron erläutert
haben. Angefangen von einem lang andauernden Winter über ein feuchtes Frühjahr
bis hin zu extremer Trockenheit und Hitze in den zurückliegenden Wochen hätten
die Wetterkapriolen die Landwirte in diesem Jahr in Schach gehalten.
Ausgerechnet zur Erntezeit sei dann auch noch eine Schlechtwetterphase
eingetreten.
Himmelkron. Auf eine durchschnittliche, in weiten Bereichen eher
unterdurchschnittliche Ernte müssen die oberfränkischen Bauern in diesen Tagen
zurückblicken. Schuld daran ist das Wetter, wie BBV-Bezirkspräsident Werner Reihl und Bauernverbandsdirektor Dr. Wilhelm Böhmer in Himmelkron erläutert
haben. Angefangen von einem lang andauernden Winter über ein feuchtes Frühjahr
bis hin zu extremer Trockenheit und Hitze in den zurückliegenden Wochen hätten
die Wetterkapriolen die Landwirte in diesem Jahr in Schach gehalten.
Ausgerechnet zur Erntezeit sei dann auch noch eine Schlechtwetterphase
eingetreten.001.jpg) Schirnding. Die Entdeckung der Langsamkeit ist es, da sind sich Fritz Müller
(61) und Reiner Wohlrab (54) einig, was die eigentliche Faszination
ausmacht. Doch anders als in dem gleichnamigen Roman des
Schriftstellers Sten Nadolny sind Müller, Wohlrab und ihre rund 25
weiteren Mitstreiter weder Hochseekapitäne noch Polarforscher. Ihnen
macht es einfach Spaß, mit historischen Traktoren über Land zu
fahren, an den alten Stahlrössern zu basteln und zu schrauben und am
Wirtshaustisch über ihr Hobby zu fachsimpeln.
Schirnding. Die Entdeckung der Langsamkeit ist es, da sind sich Fritz Müller
(61) und Reiner Wohlrab (54) einig, was die eigentliche Faszination
ausmacht. Doch anders als in dem gleichnamigen Roman des
Schriftstellers Sten Nadolny sind Müller, Wohlrab und ihre rund 25
weiteren Mitstreiter weder Hochseekapitäne noch Polarforscher. Ihnen
macht es einfach Spaß, mit historischen Traktoren über Land zu
fahren, an den alten Stahlrössern zu basteln und zu schrauben und am
Wirtshaustisch über ihr Hobby zu fachsimpeln.001.jpg) „Die
alte Technik ist eben auch ein Stück Kulturgut, deshalb fasziniert
sie so viele Menschen“, ist sich Fritz Müller sicher. Der gelernte
Maschinenschlosser, der auf dem Wertstoffhof tätig ist und im
Arzberger Ortsteil Schlottenhof einen Ferienhof mit Urlaub auf dem
Bauernhof betreibt, kann insgesamt neun historische Schlepper sein
Eigen nennen. Höhepunkte seiner Sammlung sind ein 15er Deutz LF1
Baujahr 1950 mit 50 PS sowie ein Röhr, Baujahr 1950, der im
niederbayerischen Landshut produziert wurde. Überhaupt habe damals
ja fast jede Maschinenfabrik ihre eigenen Traktoren gebaut. Die Zeit
der Spezialisierung kam erst später. Tatsächlich mag es für heutige
Automobilfans kurios klingen, dass ausgerechnet der
Sportwagenhersteller Porsche etwa zwischen 1955 und 1960 auch
Traktoren produziert hat.
„Die
alte Technik ist eben auch ein Stück Kulturgut, deshalb fasziniert
sie so viele Menschen“, ist sich Fritz Müller sicher. Der gelernte
Maschinenschlosser, der auf dem Wertstoffhof tätig ist und im
Arzberger Ortsteil Schlottenhof einen Ferienhof mit Urlaub auf dem
Bauernhof betreibt, kann insgesamt neun historische Schlepper sein
Eigen nennen. Höhepunkte seiner Sammlung sind ein 15er Deutz LF1
Baujahr 1950 mit 50 PS sowie ein Röhr, Baujahr 1950, der im
niederbayerischen Landshut produziert wurde. Überhaupt habe damals
ja fast jede Maschinenfabrik ihre eigenen Traktoren gebaut. Die Zeit
der Spezialisierung kam erst später. Tatsächlich mag es für heutige
Automobilfans kurios klingen, dass ausgerechnet der
Sportwagenhersteller Porsche etwa zwischen 1955 und 1960 auch
Traktoren produziert hat.001.jpg) Freilich
geht halt alles langsamer, so Fritz Müller und Rainer Wohlrab.
Kollegen von ihnen, seien mit dem Schlepper schon an den Chiemsee
gefahren und hätten dort Urlaub gemacht. Die Polizei musste die
Schlepper damals durch Regensburg lotsen, was für großes Aufsehen
gesorgt habe. Anders als im Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“
haben die Traktorfreunde aus Schirnding und Umgebung keine
Schwierigkeiten, mit der Schnelllebigkeit ihrer Zeit Schritt zu
halten. Doch genauso wie im Roman sind sie aufgrund ihrer
Beharrlichkeit mittlerweile zu großen Entdeckern geworden. Vor allem
wenn es darum geht, ihre Umgebung genauer wahrzunehmen, Land und
Leute kennen zu lernen und persönliche Kontakte zu knüpfen.
Freilich
geht halt alles langsamer, so Fritz Müller und Rainer Wohlrab.
Kollegen von ihnen, seien mit dem Schlepper schon an den Chiemsee
gefahren und hätten dort Urlaub gemacht. Die Polizei musste die
Schlepper damals durch Regensburg lotsen, was für großes Aufsehen
gesorgt habe. Anders als im Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“
haben die Traktorfreunde aus Schirnding und Umgebung keine
Schwierigkeiten, mit der Schnelllebigkeit ihrer Zeit Schritt zu
halten. Doch genauso wie im Roman sind sie aufgrund ihrer
Beharrlichkeit mittlerweile zu großen Entdeckern geworden. Vor allem
wenn es darum geht, ihre Umgebung genauer wahrzunehmen, Land und
Leute kennen zu lernen und persönliche Kontakte zu knüpfen. Hof.
Chips, Popcorn, Cola oder gar Döner: So sah allen Ernstes das Frühstück einiger
Zehntklässer an der Christian-Wolfrum-Hauptschule in Hof noch Anfang des Jahres
aus. Die Wende läutete allerdings Anfang März der Punkt „Schülerfirma“ im
Lehrplan ein. Anstatt Pizzabrötchen zu vermarkten, wie die Abschlussklassen in
den Jahren zuvor, gründeten die 24 Schülerinnen und Schüler der 10M das
„Kuhwerk“, eine echtes Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hatte, den über
600 Grund- und Hauptschülern ein gesundes und nahrhaftes Frühstück zum kleinen
Preis anzubieten und damit auch den Absatz von Milch und Milchprodukten
anzukurbeln.
Hof.
Chips, Popcorn, Cola oder gar Döner: So sah allen Ernstes das Frühstück einiger
Zehntklässer an der Christian-Wolfrum-Hauptschule in Hof noch Anfang des Jahres
aus. Die Wende läutete allerdings Anfang März der Punkt „Schülerfirma“ im
Lehrplan ein. Anstatt Pizzabrötchen zu vermarkten, wie die Abschlussklassen in
den Jahren zuvor, gründeten die 24 Schülerinnen und Schüler der 10M das
„Kuhwerk“, eine echtes Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hatte, den über
600 Grund- und Hauptschülern ein gesundes und nahrhaftes Frühstück zum kleinen
Preis anzubieten und damit auch den Absatz von Milch und Milchprodukten
anzukurbeln.